Die Befreiung des deutschen Volkes vom Faschismus durch die Sowjetunion und ihre Verbündeten. Die Gründung der UNO, die Herausbildung des sozialistischen Weltsystems und die Machteinbuße des Imperialismus. Die antifaschistisch-demokratische Umwälzung und das Ringen um demokratische Einheit Deutschlands und Frieden. Der kalte Krieg, die restaurative Neuordnung und die Bildung der BRD. Die Entstehung der DDR.
Die Pariser Kommune und der Frankfurter Friedensvertrag
Inhaltsverzeichnis
- 1 Die Pariser Kommune und der Frankfurter Friedensvertrag
- 1.1 Die Revolution in Paris und die Solidaritätsbewegung der deutschen Arbeiter
- 1.2 Die Hetzkampagne gegenüber der Kommune und die Erpressungspolitik gegenüber Frankreich
Die Revolution in Paris und die Solidaritätsbewegung der deutschen Arbeiter
Während das französische Volk in den Monaten des Krieges große Opfer gebracht hatte und nach der Schlacht von Sedan für die nationale Unabhängigkeit kämpfte, hatte die Unfähigkeit der Bourgeoisie bzw. ihrer Politiker und Militärs, die nationalen Interessen wahrzunehmen, die sozialen Spannungen in Frankreich verschärft. Der Verdacht breiter Volksschichten, daß die verlustreichen militärischen Aktionen vom 14. und 19.Januar 1871 in Paris nur zur Zermürbung der Widerstandsfähigkeit der eigenen Truppen eingeleitet worden waren und daß die Regierung aus Furcht vor dem eigenen Volk sehr schnell den Frieden mit dem Deutschen Reich ausgehandelt hatte, bestätigte sich immer mehr. Denn nun, nachdem ihnen der Abschluß des Präliminarfriedens freie Hand gegeben hatte, gingen die in Versailles residierende Regierung und die zunächst in Bordeaux tagende Nationalversammlung rigoros gegen die gefürchteten Massen vor. Die Sperrung des Soldes für die Nationalgarde, ein Beschluß über Mietpreiserhöhungen und schließlich der Versuch der Regierung, in einer Nachtund Nebelaktion die Geschütze der Pariser Nationalgarde zu entführen und damit das Volk zu entwaffnen, brachten das Faß zum Überlaufen. Die Regierungstruppen wurden verjagt, und am 18. März 1871 übernahm das Zentralkomitee der Nationalgarde, gewählt von den Delegierten ihrer verschiedenen Einheiten, die Macht in Paris. Alle wichtigen Gebäude wurden besetzt und auf dem Stadthaus die rote Fahne gehißt. Die erste proletarische Revolution in der Weltgeschichte hatte begonnen.
Das Zentralkomitee der Nationalgarde schrieb für den 26. März Wahlen zu einem Rat der Kommune aus. Am 28. März nahm dieser Rat die Arbeit auf. Zum Rat der Kommune gehörten etwa 30 Arbeiter, darunter die Mitglieder der I. Internationale Eugene
Die Revolution in Paris. Transport zurückeroberter Kanonen nach dem Montmartre. Holzstich nach einer Zeichnung Won L. von Elliot aus „Illustrierte Zeitung“, 1871
Varlin, Albert Theizs und Leo Franckel, 35 Handwerker, Angestellte und Vertreter der Intelligenz sowie ca. 20 bürgerliche Mitglieder, die den Rat bald wieder verließen. Dieser Rat war, da er im Plenum Dekrete erließ, legislatives Organ und zugleich Exekutive, da seine Mitglieder in zehn Kommissionen — Ministerien gleich — arbeiteten und jeweils für einen gesellschaftlichen Bereich verantwortlich waren.
Bereits am 20. März war die Konskription, die Grundlage für das alte Berufsheer, beseitigt worden, und ein Volksheer für alle Männer zwischen 19 und 40 Jahren unter dem Kommando der Kommune entstand. Die Verwaltung wurde völlig neu aufgebaut.
Die Kommune erließ sofort Dekrete, die die soziale Lage der Werktätigen verbesserten. Am 16. April wurden alle von ihren Besitzern verlassenen Werkstätten und Fabriken an Arbeitergenossenschaften übergeben und damit Anfänge gesellschaftlichen Eigentums geschaffen. Daneben dekretierte die Kommune die Trennung von Staat und Kirche, begann mit der Reorganisation des Schulwesens und schuf neue Formen und Möglichkeiten der Arbeit von Wissenschaftlern und Künstlern.
Bedeutungsvoll — auch für die internationale proletarische Bewegung — waren die Maßnahmen der Kommune zur Durchsetzung der Gleichberechtigung der Frauen. Das betraf die Mitarbeit in allen politischen Organen, vor allem aber auch die sozialen Bedingungen. So wurden die Frauen in die Berufsausbildung einbezogen, die diskriminierenden Bestimmungen über uneheliche Kinder beseitigt und Maßnahmen durchgesetzt, die die Prostitution liquidierten.
Die Hauptsorge der Kommune galt der Verteidigungsbereitschaft, da die Versailler Regierung keinen Zweifel über ihre Pläne für eine bewaffnete Auseinandersetzung ließ.
So sehr die politische und soziale Umgestaltung durch innere Schwierigkeiten gehemmt wurde — denn im Rat wirkten unterschiedliche politische Kräfte, und es gab keine proletarische Partei —, so schwierig sich auch die materielle Lage in Paris gestaltete — vor allem weil der Ring des preußisch-deutschen Militärs um Paris weiterbestand -, so deutlich trat jedoch der internationalen Öffentlichkeit vor Augen, daß in Paris eine revolutionäre Entwicklung begann, die völlig neue Maßstäbe setzte.
„Der Kampf der Arbeiterklasse mit der Kapitalistenklasse und ihrem Staat“, schrieb Karl Marx an seinen Freund Ludwig Kugelmann in Hannover, „ist durch den Pariser Kampf in eine neue Phase getreten. Wie die Sache auch unmittelbar verlaufe, ein neuer Ausgangspunkt von welthistorischer Wichtigkeit ist gewonnen.
Die Pariser Kommune schloß die Epoche der bürgerlichen Umwälzung in Europa ab. Sie kennzeichnete zugleich die Grenzen, die der historischen Perspektive der Bourgeoisie und deren gesellschaftlicher Leistungsfähigkeit gesetzt waren. Marx sprach von „welthistorischer Wichtigkeit“, weil die Kommune den Ausgangspunkt für die historische Tendenz des Niedergangs der Bourgeoisie und des Aufstieges der Arbeiterklasse zur schließlich bestimmenden Klasse markierte.
Seit dem 21. März beschäftigte sich in London der Generalrat der I. Internationale unter Leitung von Marx und Engels ständig mit den Ereignissen in Paris. Marx und Engels knüpften Verbindungen zu den Kommunarden, gaben Ratschläge und informierten vor allem die Sektionen der Internationale in den verschiedenen Ländern, um eine allgemeine Solidaritätsbewegung zu initiieren.
Die Revolution in Paris förderte die Aktivität der deutschen Arbeiter. Ende März entwickelte sich eine Welle der Solidarität, die im April einen ersten Höhepunkt erlebte und dann Ende Mai und im Juni eine große Breite gewann. Dabei waren spontanes Reagieren und bewußtes Handeln, das elementare Gefühl der Solidarität mit der Erkenntnis von Zusammenhängen des Klassenkampfes eng verknüpft. Die Solidaritätsbewegung wurde von den Arbeiterorganisationen ADAV und SDAP getragen, wirkte sich aber unterschiedlich und zum Teil widersprüchlich aus. In den Solidaritätsaktionen des ADAV, die sich auf die Haupteinflußgebiete der Organisation, auf das Rheinland, Hamburg-Altona und Berlin, konzentrierten, wurde die antikapitalistische Grundhaltung der Mitglieder gestärkt. Der „große Gedanke, Befreiung der Arbeiter von den Sklavenketten der Kapitalherrschaft“, so hieß es, werde den Kampf auch weiterhin bestimmen.!” Zugleich wurde der Kampfruf des Kommunistischen Manifests „Proletarier aller Länder, vereinigt Euch!“ aufgegriffen und mit diesem Bekenntnis zum proletarischen Internationalismus die nationalistische Enge der lassalleanischen Doktrin durchbrochen.
Am 24. März 1871 kündigte der Präsident des ADAV, Schweitzer, seinen Rücktritt an. Offenbar hatte die Wahlniederlage aller Kandidaten des ADAV vom 3. März seine Illusion von der Monopolstellung des Vereins in der Arbeiterbewegung zerstört. Auch der „Social-Demokrat“, der Schweitzers Eigentum war, stellte Ende April sein Erscheinen ein. Erst nach der Generalversammlung des ADAV vom 18. bis 25. Mai, auf der Wilhelm Hasenclever zum Präsidenten gewählt wurde, erschien ab 2. Juli der „Neue Social-Demokrat“ als Vereinsorgan. Das Fehlen des Organs während der zwei Monate wirkte sich auf die Organisation negativ aus und trug auch dazu bei, daß die Solidaritätsbewegung für die Kommune zurückging.
Die Welle von Solidaritätsveranstaltungen, die von der SDAP organisiert wurden, erreichte im April ihren ersten Höhepunkt. Insbesondere in Sachsen kam es zu einer Vielzahl von Veranstaltungen, so in Chemnitz, wo sich auf einer großen Kundgebung 18000 bis 20000 Teilnehmer versammelten, und in Leipzig, wo Versammlungen mit 9000 Teilnehmern stattfanden. Von den Zentren Leipzig, Dresden und Chemnitz ausgehend, wurden viele kleinere Orte erfaßt. Auch im Rheinland, wo in den Industriestädten Barmen, Köln, Solingen, Essen und anderen Kundgebungen stattfanden, gewann die SDAP Einfluß. Braunschweig wurde zu einem weiteren Zentrum der Solidaritätsbewegung, und auch in Schlesien trat die SDAP mit Kundgebungen hervor.
Die von den Eisenachern getragene Solidaritätsbewegung für alle Kommunarden stärkte das Selbstbewußtsein der Arbeiter und führte zur Wiederbelebung der SDAP-Organisation, in manchen Gebieten auch zu Neugründungen von sozialdemokratischen Vereinen. Die darin zum Ausdruck kommende politische und organisatorische Festigung der Partei spiegelte sich deutlich im sprunghaften Anstieg der Abonnentenzahl des Parteiorgans „Der Volksstaat“ wider. Konnten im ersten Quartal 1871 erst 2.790 Abonnenten gezählt werden, so waren es Ende des Jahres schon 4.480.
Der „Volksstaat“, seit Ende März wieder von Wilhelm Liebknecht geleitet, spielte eine entscheidende Rolle bei der inhaltlichen Ausrichtung der Solidaritätsbewegung. Seit dem 22. März berichtete die Zeitung über die Pariser Ereignisse. Aus der Analyse der schwierig zu erlangenden Nachrichten versuchte das Parteiorgan eine Gesamteinschätzung zu gewinnen. Am 15. April 1871 charakterisierte es die Pariser Kommune als „eine Arbeiterregierung im eigentlichen Sinne des Wortes“.!8 Diese grundsätzliche Aussage stellte für die weitere Solidaritätsbewegung, für die Kundgebungen der Partei und die Stellungnahmen ihrer Führer einen entscheidenden Bezugspunkt dar. Sie trug auch zur Bestimmung der Positionen gegenüber den herrschenden Klassen in Deutschland bei, deren Politik in dieser Zeit mit der endgültigen Gestaltung der Reichsverfassung und dem Abschluß des Friedens mit Frankreich den Charakter des Deutschen Reiches prägte.
Die Hetzkampagne gegenüber der Kommune und die Erpressungspolitik gegenüber Frankreich
Die herrschenden Klassen in allen europäischen Ländern begriffen oder ahnten, daß mit der Pariser Kommune für sie eine völlig neue, existentiell bedeutsame Frage aufgeworfen war. In allen Hauptstädten bangten die Machthaber um die innere Ordnung Frankreichs und wünschten eine schnelle Lösung. Nächst der französischen Bourgeoisie waren die herrschenden Klassen Deutschlands in besonderem Maße mit den Pariser Ereignissen konfrontiert: Die proletarische Revolution in Frankreich vollzog sich ja unter den Augen der deutschen Truppen; vor allem aber war der Friedensvertrag noch nicht unter Dach und Fach.
Proklamation der Kommune auf dem Platz vor dem Pariser Rathaus am 28. März 1871. Zeitgenössischer Holzstich nach einer Zeichnung von Lamy
Die herrschenden Klassen Deutschlands inszenierten eine wüste Hetzkampagne, die vor allem von der Presse getragen wurde. Hatten sie zunächst Schadenfreude über die Schwierigkeiten der französischen Großbourgeoisie bekundet, so war diese doch sehr bald der Besorgnis gewichen, daß die Kommune die materielle Ausplünderung Frankreichs beeinträchtigen könnte. „Was Deutschland betrifft“, so schrieb die „National-Zeitung“ bereits am 23. März, „so ist es durch diesen kläglichsten aller Aufstände vorerst nur in seiner Stellung als Gläubiger Frankreichs berührt …“ Man wünsche, daß Frankreich solvent bleibe, und sei „weit entfernt, an kommunistischen Verwüstungen, die unsere eigene Tasche mit angehen, Gefallen zu finden“
Ob die international renommierte Augsburger „Allgemeine Zeitung“, ob die Berliner Tagespresse oder irgendwelche Provinzblättchen sie alle ergingen sich in Verunglimpfungen der französischen Nation und des französischen Volkes. Das Vokabular reichte von der „sittlichen Fäulnis Frankreichs“ über angebliche „Schlächtereien“ bis hin zur generellen „Unwürdigkeit des französischen Volkes“. Die nationalistische Hetze richtete sich vor allem gegen das Frankreich der Revolutionen von 1789, von 1830, von 1848 und nun von 1871 -, die man als Ausfluß einer angeblichen Demoralisation und nationalen Degeneration hinstellte. Mit der Niederschlagung der Kommune und der Knebelung Frankreichs durch einen Friedensvertrag werde, so schrieb hoffnungsvoll das nationalliberale Wochenblatt „Die Gegenwart“, die Zeit vorbei sein, in der alle Blicke „ängstlich auf Paris gerichtet waren“, denn „die Rückwirkung einer jeden Revolution, die in Frankreich stattfand“, sei „von Lissabon bis Petersburg gespürt“ worden.?? Die „Neue Preußische (Kreuz-)Zeitung“, das Organ der Junker, verfehlte nicht, auch der Bourgeoisie einen Seitenhieb zu versetzen, indem sie am 23. März anmerkte, die Bourgeoisie habe jede frühere Revolution „unbesehen als einen Akt glorreichen bürgerlichen Mutes mit Begeisterung begrüßt“. Solche Anwürfe bewirkten, daß die deutschen Bourgeoisideologen die Vergangenheit ihrer eigenen Klasse noch mehr verleugneten. Die Kehrseite des antirevolutionär motivierten Nationalismus war ein Lobgesang auf die angeblich in ruhigeren Bahnen verlaufende deutsche Geschichte, auf eine Entwicklung, die von Kontinuität und Selbstbeherrschung, von der Anerkennung der geschichtlich gewachsenen Vielfalt gekennzeichnet sei. An den „Zuckungen Frankreichs“ erkenne man die „Erlösung, welche die Kraft Deutschlands der zivilisierten Welt gebracht hat“, hieß es in der „National Zeitung“ vom 23. März 1871.
Angesichts der von Berlin aus betriebenen praktischen Politik. gegenüber Frankreich enthüllten sich die Formeln von der „Erlösung“ oder auch einer „europäischen Mission“ des neuen Reiches als offener Zynismus. So nervös auch die politische und militärische Führung auf den Ausbruch der Revolution in Paris reagierte, der Reichskanzler gedachte die Situation in mehrfacher Richtung zu nutzen. Schon am 30. März erschien in der Augsburger „Allgemeinen Zeitung“ ein Artikel mit der Überschrift „Die ersten Verdienste des Deutschen Reiches um Europa“, in dem es hieß: „Die deutsche Macht schützt Europa gegen die Überflutungen des französischen Wahnsinns und wird wahrscheinlich durch ihre bloße Gegenwart auf französischem Boden dazu beitragen, den gesunden Elementen der Nation den Sieg über den roten Fortschritt zu erleichtern.“?! Damit war sehr deutlich die seit September 1870 von Bismarck gegenüber den europäischen Mächten vertretene Position angesprochen, mit der die Reichsgründung und die Annexionspolitik gegenüber Frankreich außenpolitisch abgesichert werden sollte. Die Politik der antirevolutionären Solidarität der monarchischen Staaten hatte angesichts der Pariser Kommune Erfolg. Schon am 6. April berichtete der russische Botschafter in Berlin darüber, daß der Bürgerkrieg in Frankreich für die Politik Bismarcks eigentlich vorteilhaft sei. Die Ereignisse in Frankreich ziehen „die öffentliche Meinung Europas zu Deutschland herüber, denn alle Länder, einschließlich England, das sich gegen seinen alten Alliierten zu kehren begann, können nur mit Schrecken den Triumph der ungesunden, von der Pariser Kommune gepriesenen Theorien ansehen“. Ähnlich berichtete der österreichische Geschäftsträger in Versailles. Und
Ende Mai bestätigte der russische Außenminister Alexander Michailowitsch Fürst Gortschakow gegenüber dem österreichisch-ungarischen Gesandten die vom deutschen Reichskanzler lancierte Auffassung, „wie wünschenswert ein solidarisches Zusammenhalten der monarchischen Staaten gegenüber den von Frankreich und der Schweiz aus drohenden revolutionären Gefahren wäre“. Auch in England setzte sich nun diese Auffassung durch. Damit war für Bismarck die Gefahr einer Einmischung der europäischen Mächte zugunsten Frankreichs zunächst gebannt.
Die preußisch-deutsche Führung gewährte der französischen Regierung sofort auch aktive Hilfe. Nach den Festlegungen des Präliminarfriedens durfte die französische Armee die Loire nicht überschreiten; nur eine Streitmacht von 40.000 Mann war von dieser Bestimmung ausgenommen. Nach einer Konvention vom 28. März durften die Regierungstruppen vor Paris auf 80.000 Mann verstärkt werden; am 5. April gestattete der deutsche Generalgouverneur in Frankreich der Regierung Thiers eine Verstärkung der Truppen auf 100.000 Mann. Dazu wurden französische Kriegsgefangene beschleunigt aus Deutschland zurückgeführt, darunter der Marschall Patrice Maurice Mac Mahon, der den Oberbefehl der französischen Truppen vor Paris übernahm.
Angesichts dieser direkten Unterstützung der reaktionären französischen Regierung charakterisierte das Zentralorgan der SDAP die Politik des Reiches am 15. April sehr deutlich: „Preußendeutschland brennt vor Begierde, seine internationale Polizeimission an der Pariser Kommune zu vollbringen.
Die Klassensolidarität mit der französischen Großbourgeoisie verband Bismarck mit der Forderung nach einem möglichst schnellen Abschluß des endgültigen Friedensvertrages und der Annahme der deutschen Bedingungen. Da die französische Regierung offenbar hoffte, die Bürgerkriegssituation für eine Reduzierung der deutschen Forderungen nutzen zu können, und daher bei den seit dem 28. März 1871 in Brüssel stattfindenden Verhandlungen von Bevollmächtigten beider Seiten über den Friedensvertrag Schwierigkeiten bereitete, übte Bismarck entsprechenden Druck aus. Zu diesem Zwecke nahm er sogar Scheinkontakte mit der Pariser Kommune auf. Von der Versailler Regierung forderte er zugleich energisches Vorgehen gegen die Kommune, drohte ihr mit einem deutschen Angriff auf Paris und ließ sie über den deutschen Generalgouverneur wissen, „daß unsere Entschädigung in dem Präliminarfrieden bemessen ist nach der damaligen Sachlage und unseren damaligen Kosten und daß wir für Verzögerung, welche durch den Mangel an Voraussicht und Entschlossenheit der französischen Regierung entsteht, neue Entschädigungsrechnungen aufstellen müssen“. Unter dem Schirm dieser Politik der Erpressung verhandelte auch die Grenzregulierungskommission, in der Wilhelm Hauchcorne der entscheidende Mann war. Im Zusammenhang mit der Bemessung des bei Frankreich verbleibenden Gebietes um Belfort forderte die deutsche Seite eine entsprechende Annexionsausweitung im lothringischen Erzgebiet, wobei die Eingaben der deutschen Eisenindustriellen berücksichtigt wurden.
Sitzung der Friedenskonferenz in Frankfurt am Main am 10. Mai 1871. Holzstich aus „Illustrierte Zeitung“, 1871
Die französische Regierung geriet immer mehr unter Druck. Zwar konnte sie den Ring um Paris mit Regierungstruppen schließen, aber die Kommunarden kämpften mutig und entrissen den Versailler Truppen Anfang Mai sogar ein wichtiges Fort. Unter diesen Bedingungen sah sich die französische Regierung gezwungen, schnell zu handeln. Sie entsandte ihren Außenminister Jules Favre nach Frankfurt am Main. Nach dessen Ankunft am 5.Mai begann die Endphase der Friedensverhandlungen.
### Der Friedensvertrag mit Frankreich und die Niederschlagung der Kommune
Bereits zu Beginn der Friedensverhandlungen forderte Bismarck ultimativ die Unterzeichnung des von ihm vorgelegten Vertrages. Am 10. Mai 1871 setzten beide Seiten im Frankfurter Hotel „Zum weißen Schwan“ ihre Unterschrift unter das Dokument.
Trotz intensiver Bemühungen der französischen Seite um Minderung der Kontributionssumme blieb es bei einer französischen Kriegskontribution von 5 Milliarden Francs — etwa 4 Milliarden Mark -, die in Goldmünzen oder Papieren sicherer Banken zu entrichten waren. Bis zur Überweisung der letzten 3 Milliarden Francs im März 1874 sollten bestimmte Departements von deutschen Truppen besetzt bleiben. Das Elsaß und große Teile Lothringens wurden von Deutschland annektiert. Zudem hatten die deutschen Unterhändler noch über die im Präliminarfrieden festgelegten Grenzen hinausgehende Annexionen in Lothringen durchgesetzt. Insgesamt drei Viertel der Eisenproduktion des ehemaligen Moseldepartements kamen unter deutsche Herrschaft. Frankreich verlor durch die Annexion ungefähr ein Viertel seiner gesamten Bergwerksindustrie.
Als einziger Abgeordneter des Deutschen Reichstags protestierte August Bebel gegen diese räuberische Politik. Am 25. Mai kennzeichnete er die Annexion von Elsaß-Lothringen als ein Verbrechen gegen das Völkerrecht und einen Schandfleck in der deutschen Geschichte.
Für Frankreich bedeuteten die Frankfurter Festlegungen nicht nur eine schwere materielle Belastung, die vor allem die arbeitenden Klassen zu tragen hatten, sondern — nicht zuletzt durch die Annexion von Eilsaß-Lothringen — auch eine außerordentlich schwere nationale Demütigung. Die reaktionäre französische Regierung nahm das in Kauf, um das revolutionäre Paris möglichst schnell niederzwingen zu können und damit alle Ansätze einer Ausbreitung der Revolution im Keim zu ersticken.
Im Friedensvertrag selbst wurde der französischen Großbourgeoisie insofern eine Rückendeckung dafür gegeben, als die deutsche Regierung die Räumung des Gebietes um Paris erst beginnen wollte, wenn die Ordnung in Frankreich bzw. in Paris sichergestellt sein werde. Zusätzlich waren in einer geheimen und mündlichen Vereinbarung Maßnahmen festgelegt worden, die eine Offensive der Regierung und ihrer Truppen ermöglichen sollten: „Durchlaß durch unsere Linie vor Paris, Aufforderung an Commune, den Stadtwall zu entwaffnen, Absperrung der Lebensmittel und mehr Gefangene für die großen Städte im Süden“, so beschrieb Bismarck die französischen Forderungen während der Verhandlungen in Frankfurt am Main, denen von deutscher Seite bereitwillig entsprochen wurde.
Bereits am 11. Mai wurden zwischen dem preußischen General Ludwig Freiherr von Schlotheim und dem Stabschef der Versailler Regierung die Einzelheiten der Zusammenarbeit im Kampf gegen die Kommune festgelegt. Vor allem die Hungerblockade von Paris und der Durchlaß der Regierungstruppen durch deutsches Besatzungsgebiet begünstigten die Konterrevolution.
Am 18.Mai erfolgte die Ratifizierung des Friedensvertrages durch die französische Nationalversammlung. Am 21. Mai leitete die Regierung Thiers mit einem großangelegten Angriff die „Blutige Maiwoche“ zur Niederschlagung der Kommune ein. Trotz heroischer Gegenwehr der Pariser Revolutionäre erlagen sie der militärischen Übermacht. Am 27. Mai begann der letzte heldenhafte Kampf der Kommunarden auf dem Friedhof Pre Lachaise; einen Tag darauf herrschte Friedhofsruhe in ganz Paris. 30000 Pariser waren gefallen oder meuchlings ermordet worden. 40000 Kommunekämpfer wurden eingekerkert oder zur Zwangsarbeit verurteilt. Tausende mußten emigrieren.
Mit dem Frankfurter Friedensvertrag und der Hilfe für die Henker der Kommune hatte das Deutsche Reich als „Bannerträger der Eroberung und Konterrevolution“ seinen ersten Auftritt auf der politischen Bühne Europas vollbracht.
Die herrschenden Klassen in Deutschland frohlockten angesichts der Niedermetzelung der Kommunarden. Die Zeitungen rechtfertigten die Massaker der Versailler Regierungstruppen und wollten noch aus den Urteilen der Kriegsgerichte die Verderbtheit der Kommune beweisen. Karl Marx kennzeichnete die Haltung der deutschen Bourgeoisie und ihrer Presse, als er schrieb: „In jedem ihrer blutigen Triumphe über die selbstopfernden Vorkämpfer einer neuen und bessern Gesellschaft übertäubt diese, auf die Knechtung der Arbeit gegründete, schmähliche Zivilisation das Geschrei ihrer Schlachtopfer durch einen Hetzruf der Verleumdung, den ein weltweites Echo widerhallt.
Den nationalistischen Beschimpfungen der Kommune in der bürgerlichen Presse setzten die klassenbewußten Arbeiter unter Führung der SDAP ihre Solidaritätsbekundungen für die Kommunarden entgegen. In zahlreichen Versammlungen und in ihren Zeitungen, wie dem „Volksstaat“, dem „Crimmitschauer Bürgerund Bauernfreund“, der „Chemnitzer Freien Presse“ und dem „Braunschweiger Volksfreund“, erneuerten sie ihr Bekenntnis zum proletarischen Internationalismus und verurteilten zugleich die schändliche Rolle des preußisch-deutschen Militarismus bei der Erwürgung der Kommune. Der „Volksstaat“ erklärte die Parteinahme für die Pariser Kommune als Pflicht und Bedingung der Parteimitgliedschaft. Im Reichstag erhob August Bebel seine Stimme. Dem von den herrschenden Klassen verbreiteten Glauben an die Unveränderlichkeit der gesellschaftlichen Ordnung setzte er das Bekenntnis zum revolutionären Kampf für die Befreiung der Arbeiterklasse entgegen. Paris werde zwar unterdrückt, rief er am 25. Mai den Reichstagsabgeordneten zu, aber das ändere nichts daran, „daß der Kampf in Paris nur ein kleines Vorpostengefecht ist, daß die Hauptsache in Europa uns noch bevorsteht und daß, ehe wenige Jahrzehnte vergehen, der Schlachtruf des Pariser Proletariats: ‚Krieg den Palästen, Friede den Hütten, Tod der Not und dem Müßiggange!‘ der Schlachtruf des gesamten europäischen Proletariats werden wird.
Zeitgenössische Karikatur auf Bismarck und Bebel. Holzstich aus „Berliner Wespen“, 1871
Als August Bebel diese mutige Rede zur Verteidigung der ersten proletarischen Revolution hielt, glaubten einige Abgeordnete ihr Unverständnis für den Lauf der Geschichte durch Gelächter demonstrieren zu müssen. Nur wenige Bourgeoispolitiker wurden nachdenklich. In seiner grundlegenden Analyse der Revolution in Paris und ihrer historischen Stellung in der Schrift „Der Bürgerkrieg in Frankreich“ schrieb Karl Marx: „Daß nach dem gewaltigsten Krieg der neueren Zeit die siegreiche und die besiegte Armee sich verbünden zum gemeinsamen Abschlachten des
Proletariats — ein so unerhörtes Ereignis beweist, nicht wie Bismarck glaubt, die endgültige Niederdrükkung der sich emporarbeitenden neuen Gesellschaft, sondern die vollständige Zerbröckelung der alten Bourgeoisgesellschaft.“ Damit kennzeichnete Marx eine geschichtliche Tendenz, deren Wirkung allerdings nicht sofort und auch nicht in allen gesellschaftlichen Bereichen sichtbar wurde.
An der Wegscheide deutscher Geschichte
1945 blickten die Deutschen zurück auf sechs Jahre eines furchtbaren Krieges, den zweiten bereits innerhalb einer Generation, und auf zwölf Jahre faschistischer Diktatur. Was vor ihnen lag, war ungewiß. Wieder einmal stand zur Entscheidung, welchen Weg die deutsche Nation einschlagen wird – diesmal jedoch in einer Situation, deren hervorstechende Kennzeichen der Sieg der Sowjetunion und der an ihrer Seite kämpfenden Völker der Anti-Hitler-Koalition über den faschistischen deutschen Imperialismus und eine neue Welle von Revolutionen und Befreiungsbewegungen waren.

Der mit der Großen Sozialistischen Oktoberrevolution eingeleitete Übergang vom Kapitalismus zum Sozialismus war in ein neues Stadium eingetreten. In Deutschland brachen die Widersprüche, die die Novemberrevolution nicht zu lösen vermocht hatte, unter veränderten Bedingungen erneut auf.
Nicht daß es dies gewesen wäre, was die Mehrheit des deutschen Volkes im Mai 1945 vorrangig bewegte. Von denen, die dem Krieg entronnen waren, dachten die meisten zunächst nur ans bloße Überleben. Dennoch hing ihr Schicksal als Individuen und als Volk davon ab, welche Beantwortung die großen Fragen der Zeit in den unausweichlichen Auseinandersetzungen des nun anbrechenden neuen Abschnitts deutscher Geschichte finden würden.

Am 8. Mai 1945 hatten die Vertreter des Oberkommandos der faschistischen Wehrmacht in Berlin-Karlshorst die Urkunde über die bedingungslose Kapitulation unterzeichnet. Dem „totalen Krieg“ war die totale Niederlage gefolgt. An den Folgen hatte das deutsche Volk in seiner Gesamtheit und in allen Sphären zu tragen – materiell, völkerrechtlich, politisch und moralisch. Dennoch war dies zuerst und vor allem die Niederlage des faschistischen deutschen Imperialismus. Gegen ihn hatten die Völker der Anti-Hitler-Koalition im Kriege gestanden, über ihn hatten sie ihren großartigen Sieg errungen.
Es war die Rote Armee gewesen, die, gestützt auf die Arbeitsleistungen der sowjetischen Werktätigen im Hinterland, den faschistischen Aggressoren die kriegsentscheidenden Niederlagen bereitet hatte. Die mit dem Sieg der Sowjetunion im Großen Vaterländischen Krieg vollbrachte Befreiertat strahlte auf ganz Europa und weite Teile des asiatischen Kontinents aus. Ein neuer historischer Boden war gewonnen, auf dem das Ringen zwischen Fortschritt und Reaktion unter in vielen Ländern nun weitaus günstigeren Bedingungen für die progressiven Kräfte ausgetragen werden konnte. Das galt auch für Deutschland.
Das Frühjahr 1945 brachte den Völkern Europas und auch dem deutschen Volke das Ende der Kriegshandlungen. Kein deutscher Soldat konnte mehr für die Interessen faschistischer Machthaber und ihrer Hinterleute in den Tod getrieben werden. Niemand in Deutschland brauchte mehr zu bangen, daß Bomben sein Hab und Gut, ihn selbst und seine Familie unter Trümmern begruben. Mit dem 8. Mai 1945 war die faschistische Diktatur endgültig hinweggefegt. Keiner brauchte mehr den Terror des nazistischen Gewaltapparates zu fürchten. Von den Werktätigen war der Druck eines allgegenwärtigen Systems der Unterwerfung, der Gleichschaltung und Bespitzelung genommen. Für Zehntausende der besten Söhne und Töchter des deutschen Volkes öffneten sich die Tore der Gefängnisse und Konzentrationslager. Die Stunde der Verfolgten und Verfemten war angebrochen, die Stunde, die alle deutschen Antifaschisten herbeigesehnt hatten.
Wie schwer sich auch die Lage vieler Menschen in Deutschland gestaltete, wie eng auch die Grenzen politischer und persönlicher Bewegungsfreiheit in dem militärisch besiegten und besetzten Deutschland zwangsläufig zunächst gezogen waren – der 8. Mai 1945 war und ist der Tag der Befreiung. Er ist das Datum, mit dem das verhängnisvollste Kapitel deutscher Geschichte seinen Abschluß fand und das für die Chance eines neuen Beginnens steht. So kann es nicht überraschen, wenn sich fortschrittliche und reaktionäre deutsche Geschichtsschreibung in ihrer Bewertung des 8. Mai 1945 unversöhnlich gegenüberstehen. Jene, die ihre „großdeutschen Träume“ noch nicht aufgegeben haben, sprechen von „Zusammenbruch“, „Katastrophe“, „Unglück“. Historiker, die für Fortschritt und Erneuerung Partei ergriffen haben, verstehen den 8. Mai 1945 als Tag der Befreiung, der Wende, des Aufbruchs.

Was von der schlimmen Hinterlassenschaft der zwöIfjährigen Naziherschaft für das deutsche Volk am schmerzlichsten fühlbar wurde, das waren die riesigen Menschenverluste und die unsäglichen Zerstörungen. Ein großer Teil der Bevölkerung lebte in zerbombten Städten oder verwüsteten Dörfern. Die meisten Familien trauerten um Verwandte und Freunde. Sechs Millionen Deutsche, fast 9 Prozent der Vorkriegsbevölkerung, hatte der vom faschistischen deutschen Imperialismus verschuldete zweite Weltkrieg dahingerafft, und mehr noch hatten ihre Gesundheit eingebüßt. Millionen ehemalige Angehörige der Wehrmacht und anderer bewaffneter faschistischer Verbände befanden sich in Kriegsgefangenschaft. Millionen Deutsche hatten ihre Heimat verloren. Kinder suchten ihre Eltern, Eltern ihre Kinder. Viele Frauen wußten nicht, ob der Ehemann noch unter den Lebenden weilt. Obdachlose brauchten eine Bleibe. Hunger und Seuchen drohten. Die Produktion war nahezu völlig zum Erliegen gekommen. Die meisten Verkehrswege und Nachrichtenverbindungen waren unterbrochen. Die deutsche Bevölkerung hatte sich auf das Leben in einem von den alliierten Siegermächten besetzten, territorial verkleinerten Lande einzurichten, dem ein mühseliges Aufbauwerk bevorstand. Schwer hatte sie an dem Erbe zu tragen, das ihr jene hinterließen, die nach der Weltherrschaft greifen wollten. Dafür aber bot sich ihr die einzigartige Möglichkeit, von Grund auf neu zu beginnen, ein neues Leben aufzubauen, sich auf neue Weise eine Zukunft in Frieden und sozialem Fortschritt zu erobern.
Aktivisten der ersten Stunde
Im Mai 1945 stimmten die von den alliierten Mächten besetzten Gebiete noch nicht mit den von ihnen vereinbarten Besatzungszonen überein. Die Rote Armee war bis zu einer Linie vorgedrungen, die östlich von Schwerin, dann entlang der Elbe bis Dessau und von dort in südlicher Richtung westlich von Chemnitz zur Grenze der Tschechoslowakei verlief. Das bedeutete, daß etwa ein Drittel des für die sowjetische Besatzungszone vorgesehenen Territoriums zunächst durch amerikanisches und britisches Militär besetzt war. Andererseits standen sowjetische Truppen in für eine amerikanische bzw. britische Besetzung vorgesehenen Gebieten Österreichs. Auch für Amerikaner, Briten und Franzosen stand die Rückführung von Truppen, die außerhalb ihrer künftigen Besatzungszonen Operationen durchgeführt hatten, noch aus. Im Westerzgebirge blieb sogar ein Gebiet, das vor allem Schwarzenberg, Stollberg, Aue und die umliegenden Gemeinden umfaßte, aus bisher nicht eindeutig geklärten Gründen unbesetzt. Wie unterschiedlich die Bedingungen in den befreiten Gebieten demzufolge auch waren – überall schritten deutsche Antifaschisten, die schon in den letzten Tagen des Krieges ihre Anstrengungen vervielfacht hatten, zur Tat. Gruppen der KPD traten aus der Illegalität hervor. Sie formierten ihre Reihen so, wie es die Bedingungen in den jeweiligen Besatzungsgebieten elaubten.
Vielerorts schufen sich die Kommunisten jetzt wieder feste Parteiorganisationen, deren Leitungen von den aktivsten Kämpfern gebildet wurden. In einigen Städten konstituierten sich Unterbezirks- oder Bezirksleitungen. In die Bewegung zur Reorganisation der KPD und zur Herausbildung einer breiten antifaschistisch-demokratischen Front reihten sich sofort auch ehemalige politische Häftlinge der Konzentrationslager Buchenwald, Dachau und Sachsenhausen, des Zuchthauses Brandenburg-Görden sowie anderer Lager und Strafvollzugsanstalten ein.
Auch Sozialdemokraten hatten mit dem Neuaufbau ihrer Partei begonnen. Typisch war, daß gerade jene unter ihnen, die als erste wieder politisch, tätig wurden, in engem Kontakt mit Kommunisten handelten. Oft bekundeten sie sogar die Bereitschaft, sich mit den KPD-Mitgliedern in einer Partei zu vereinen oder sich der KPD anzuschließen.
Diese Kommunisten und Sozialdemokraten bildeten in der Regel den Kern der bereits im Mai 1945 aktiven und nach Hunderten zählenden antifaschistischen Ausschüsse, um den sich parteilose Werktätige und Antifaschisten aus bürgerlichen Kreisen sammelten. Zum Teil waren diese Ausschüsse bereits in den letzten Tagen und Wochen der faschistischen Herrschaft entstanden mit dem Ziel, die Durchhaltepolitik und die Taktik der verbrannten Erde, das weitere Hinopfern von Menschenleben, die von der Hitlerclique angeordnete Vernichtung von Produktionsstätten, Kulturgütern, Wohnsiedlungen, von Brücken und Verkehrseinrichtungen zu verhindern. Den einrückenden alliierten Truppen boten deutsche Antifaschisten sofort ihre Mitarbeit an, um durch ihren Beitrag das Überleben der Bevölkerung gewährleisten zu helfen. Sie kümmerten sich um die Versorgung mit Lebensmitteln, um Milch für die Kinder, um medizinische Hilfe und um die Unterbringung von Obdachlosen. Sie waren die ersten, die mit der Säuberung der Betriebe und Ämter von aktiven Faschisten begannen und Naziverbrecher dingfest machten.
Diese antifaschistischen Aktivitäten gab es unter allen Besatzungsbedingungen, so – um nur die wichtigsten Zentren zu nennen – in Berlin und seiner Umgebung, in den Städten und Industrieorten Sachsens und Thüringens, im Mansfelder Land, am Niederrhein, an der Ruhr und am Bodensee, in Braunschweig, in Bremen, in Frankfurt am Main und in Stuttgart. Die Ausschüsse, die hier und an anderen Orten entstanden und die unterschiedlichsten Bezeichnungen führten, vereinten Zehntausende aktiver Antifaschisten, größtenteils aus den Reihen der Arbeiterklasse. Wo sie an Einfluß gewannen und von den Besatzungsorganen nicht behindert wurden, gingen sie daran, die Machtverhältnisse zu verändern.
In einigen Industriebetrieben begann auch sofort der Wiederaufbau der Betriebsräte, einer vielen Werktätigen noch aus der Novemberrevolution und den Klassenkämpfen der Weimarer Republik vertrauten Organisationsform. Sie bewahrten Produktionsstätten vor Verfall und Ausplünderung. Im Bergbau war ihnen die Rettung mancher Grube vor dem Absaufen, in Elektrizitäts- und Wasserwerken die Organisation von Notdiensten zu danken.
Zu all diesen antifaschistischen Aktivitäten nahmen die alliierten Siegermächte unterschiedliche Haltungen ein.
Die sowjetischen Besatzungsorgane förderten das Handeln deutscher Antifaschisten, in dem sie eine Voraussetzung Iür die rasche Befriedung des Landes, einen Beitrag zur baldigen Normalisierung der elementaren Lebensbedingungen der Bevölkerung und zur Bewältigung der faschistischen Vergangenheit sahen. So hatten – ermöglicht durch diese Haltung der UdSSR – noch vor der bedingungslosen Kapitulation in den durch die Rote Armee befreiten Gebieten Gruppen von Beauftragten des Zentralkomitees der KPD und von Mitstreitern des Nationalkomitees „Freies Deutschland“ ihre Arbeit aufnehmen können.
Grundlage für die Tätigkeit dieser Gruppen bildeten die Orientierungen, die unter Leitung des Vorsitzenden des Zentralkomitees der KPD, Wilhelm Pieck, von der in Moskau tätigen Parteiflihrung erarbeitet worden waren. Wilhelm Pieck – für die Zeit der Inhaftierung Ernst Thälmanns zum Parteivorsitzenden berufen – hatte nach dessen Ermordung seine Nachfolge angetreten. Der in Guben (Niederlausitz) geborene Sohn eines Kutschers gehörte nunmehr bereits fünf Jahrzehnte der revolutionären Vorhut der deutschen Arbeiterklasse an. Tischler von Beruf, hatte er während seiner Wanderjahre zur Partei August Bebels und Wilheln Liebknechts gefunden und sich von seinem 30. Lebensjahr an voll und ganz der Parteiarbeit gewidmet. An der Seite Karl Liebknechts und Rosa Luxemburgs zählte er zu den entschiedensten Kämpfern gegen Imperialismus und Militarismus sowie gegen den Opportunismus in der deutschen Arbeiterbewegung. Maßgeblich an der organisatorischen Zusammenführung der deutschen Linken beteiligt, gehörte er zu den Mitbegründem der Kommunistischen Partei Deutschlands. In der Novemberrevolution, bei der Niederschlagung des Kapp-Putsches, in den Kämpfen um Lohn und Brot, gegen die Militarisierung der Weimarer Republik und gegen die faschistische Gefahr – immer hatte Wilhelm Pieck in seiner Partei auf verantwortungsvollen Posten gestanden. Zugleich war er von dieser in höchste Funktionen der Kommunistischen Internationale delegiert worden. Nachdem er 1933 auf Beschluß der Partei Deutschland verlassen hatte, setzte er seinen Kampf gegen den Hitlerfaschismus vom Exil aus fort. Die Ausarbeitung der vom VII. Kongreß der Kommunistischen Internationale beschlossenen Strategie und Taktik, mehr noch deren Umsetzung durch die Politik der KPD, sind eng mit dem Namen Wilhelm Pieck verknüpft. Nach dem Überfall Hitlerdeutschlands auf die Sowjetunion gehörte er zu den Mitbegründern des Nationalkomitees „Freies Deutschland“. In Wilhelm Pieck personifizierte sich das „andere Deutschland“. Er war Repräsentant jener Deutschen, die sich unbeirrt dem verhängnisvollen Marsch in den Faschismus und in den Krieg widersetzt hatten. In diesen Kämpfen hatte sich sein starker Charakter geformt, seine Vertrauen einflößende Klarheit und Entschiedenheit.
Unter Leitung Wilhelm Piecks hatte sich die KPD gründlich auf das neue Stadium des Ringens um ein friedliebendes, antifaschistisch-demokratisches Deutschland vorbereitet. Im Mai 1945 verfügte die Führung der KPD über klare Vorstellungen darüber, wie die antifaschistische Tätigkeit in den wichtigsten Bereichen zu gestalten war. In mehrmonatigen Diskussionen gereift und in Auswertung der Resultate der Krimkonferenz der UdSSR, der USA und Großbritanniens präzisiert, hatten sie ihren Niederschlag in Dokumenten über die Agrarpolitik, über die ideologische Aufklärungsarbeit, die Aufgaben lokaler Volksausschüsse, in Vorschlägen für die Bereiche Film, Theater und Volksbildung sowie in Anweisungen für die ersten Schritte zum Aufbau der kommunistischen Parteiorganisationen gefunden. Wesentliche Übelegungen waren in den am 5. April 1945 beschlossenen „Richtlinien für die Arbeit der deutschen Antifaschisten in dem von der Roten Armee besetzten deutschen Gebiet“ zusammengefaßt.
Dieses Dokument diente den in das von der Roten Armee besetzte Gebiet entsandten „Initiativgruppen“ von Beauftragten des Zentralkomitees der KPD als Anleitung. Obwohl es Iür die Endphase des Krieges, in der befreite und noch von den Faschisten beherrschte Gebiete nebeneinander bestanden, konzipiert war, behielt es auch danach noch seine Geltung. Denn die Richtlinien umrissen jene dringendsten Aufgaben, die in Angriff genornmen werden mußten, bis eine sowjetische Militäradministration und deutsche Verwaltungen aufgebaut waren, Parteien und Gewerkschaften ihre legale Tätigkeit aufgenommen hatten.
Die erste in Deutschland eintreffende Gruppe von Beauftragten des Zentalkomitees der KPD, die Walter Ulbricht leitete, begab sich in den Bereich der 1. Belorussischen Front. Sie war am 30.April 1945 bei Kalau gelandet und hatte – noch bevor die Kampfhandlungen beendet waren – Anfang Mai mit der Organisierung der antifaschistischen Arbeit in Bedin und Umgebung begonnen. Mit ihrer Hilfe entstanden bereits vor der Kapitulation Bedins in den Randgdbieten und in befreiten Stadtbezirken die ersten antifaschistischen Verwaltungen, wurden die ersten antifaschistischen Bezirksbürgermeister eingesetzt.
Im Bereich der 1. Ukrainischen Front nahm die von Anton Ackermann geleitete Gruppe ihre Tätigkeit auf, die ihre Reise am 1. Mai 1945 angetreten hatte. Nach dem Einrücken sowjetischer Truppen in Dresden organisierte sie von diesem Zentrum aus ihre Arbeit in einem Territorium, das sich bis nach Görlitz, Cottbus und Wittenberg erstreckte.
Eine dritte Gruppe, die am 6. Mai eintraf und von Gustav Sobottka geleitet wurde, ergriff die Initiative zur Sammlung der antifaschistischen Kräfte in Mecklenburg und Vorpommern, im Operationsgebiet der 2. Belorussischen Front.
Zu den wichtigsten Aufgaben, denen sich alle drei Gruppen widmeten, gehörten die Auswahl von Antifaschisten für den Aufbau neuer Verwaltungen; die Versorgung der Bevölkerung mit Lebensmitteln; die Sicherung der Wiederaufnahme bzw. die Gewährleistung der Arbeit in Wasser-, Elektrizitäts- und Gaswerken, Krankenhäusern und anderen medizinischen Einrichtungen; die antifaschistische Aufklärungsarbeit und die Gewinnung neuer Mitstreiter nicht nur aus den Reihen der Arbeiterbewegung, sondern auch aus bürgelich-demokratischen Kreisen. Vielerorts stießen die Beauftragten des ZK der KPD auf kommunistische Parteiorganisationen oder auf aktive Antifaschisten, die sich in Ausschüssen und Komitees zusammengeschlossen hatten. Mit ihnen gemeinsam begannen sie neue Verwaltungen aufzubauen. Schon bald war auch der Kontakt zu den aus Konzentrationslagern und Zuchthäusern befreiten Antifaschisten hergestellt. Größte Schwierigkeiten bereitete die Sicherung der Ernährung. Sie war vor allem für die schwer zerstörten Großstädte, wie Berlin, Dresden und andere, von den deutschen Antifaschisten allein nicht zu meistern.

In den antifaschistischen Ausschüssen sahen sowjetische Kommandanturen das Reservoir, aus dem sich die Mitarbeiter einer neuen Verwaltung, die verantwortlichen Leiter für von ihren Besitzern verlassene Betriebe, die Angehörigen einer neuen Polizei, die Funktionäre der künftigen legalen Parteien, Gewerkschaften und anderen Massenorganisationen rekrutieren konnten.
Auch die westlichen Alliierten übernahmen ihre Besatzungsfunktionen in Übereinstimmung mit den Zielen der Anti-Hitler-Koalition. Ihre ersten Maßnahmen dienten vor allem der Durchsetzung der Bestimmungen der Kapitulationsurkunde, der Entmilitarisierung und Befriedung des Landes, der Ausschaltung nazistischer Elemente. Doch zeigten sie wenig Neigung, diese Aufgaben gemeinsam mit den aktiv hervortretenden deutschen Antifaschisten zu lösen. Wenn deren Mitarbeit bei den ersten und dringlichsten Säuberungsmaßnahmen und beim Ausfindigmachen von Naziverbrechern den Militärbehörden auch bis zu einem gewissen Grade willkommen war, so räumten diese jedoch den organisierten Antifaschisten in der Regel keinen Einfluß auf die Besetzung der Verwaltungen ein. Als ihnen klar wurde, daß in der antifaschistischen Bewegung die Kommunisten die aktivste Rolle spielten und mit ihrem umsichtigen Vorgehen Anklang in der Bevölkerung fanden, schritten die Besatzungsorgane ein. Schon Mitte April sprachen sie die ersten Verbote antifaschistischer Zusammenschlüsse aus. Im Mai 1945 kam es zu einer regelrechten Verbotswelle, die sich im Juni fortsetzte. Von diesen Verboten waren die Antifaschisten in Braunschweig, Bremen, Erfurt, Essen, Frankfurt am Main, Halle, Hamburg, Hannover, Jena, Leipzig, Lübeck, Solingen, Stuttgart, Zwickau und anderen Städten und Orten betroffen. Sie stellten eine massive Behinderung für die deutschen Antifaschisten dar. Doch bewirkten sie nirgendwo – und das war wesentlich der Entschlossenheit von Kommunisten und klassenbewußten Sozialdemokraten zu danken – eine anhaltende Unterbrechung des organisierten antifaschistischen Handelns.
Die Kommunisten in den von westalliierten Truppen besetzten Gebieten stellten sich auf eine Situation ein, die sich als Halblegalität charakterisieren läßt. Unter Beachtung der Regeln konspirativer Tätigkeit festigten sie ihre Parteiorganisationen oder konstituierten sie diese erneut. Vor allem dort, wo sie die Unterstützung von aus der Schweiz und aus Frankreich zurückkehrenden oder aus den Konzentrationslagern und Haftanstalten heimkehrenden Genossen erhielten, gingen die Formierung der Partei und die Verständigung über die Lage, die dringlichsten Aufgaben und die nächsten Ziele gut voran.
Auch in dem zeitweilig besatzungsfreien Gebiet um Schwarzenberg begannen Kommunisten und andere Antifaschisten sofort mit der demokratischen Aufbauarbeit. Auch hier widmeten sich Kommunisten, Sozialdemokraten und parteilose Antifaschisten den nächstliegenden Aufgaben, um die Ernährung zu sichern, Obdachlose unterzubringen, Ordnung und Sicherheit zu gewährleisten. Sie schufen sich ihre Betriebsräte und begannen mit dem Aufbau der Gewerkschaften, warben Jugendliche und Frauen zur Mitarbeit. Die Antifaschisten dieses Gebietes bewiesen, daß sie sich bewußt waren, welche Bedeutung der Bildung antifaschistisch-demokratischer Verwaltungen als Keimzellen einer künftigen Macht der Werktätigen zukam.
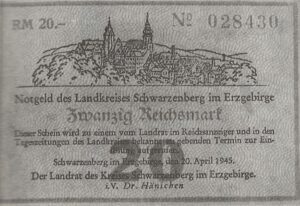
Die Männer und Frauen, die in den Frühjahrstagen des Jahres 1945 sofort zur Tat schritten, sind unter dem Ehrennamen „Aktivisten der ersten Stunde“ in die deutsche Geschichte eingegangen. Sie stellten unter Beweis, daß es das „andere Deutschland“ tatsächlich gab, daß Deutschland über Menschen verfügte, die bereit waren, an der Seite der Alliierten die antifaschistischen Ziele der Anti-Hitler-Koalition zu verwirklichen. Es zeigte sich, daß die Kommunistische Partei Deutschlands ungebrochen und als erste politische Organisation sofort den neuen Bedingungen entsprechend aktionsflähig war, daß der Gedanke der Gemeinsamkeit und des vereinten Handelns von Kommunisten, Sozialdemokraten und Antifaschisten aus dem bürgerlichen Lager Wurzeln geschlagen hatte. Die Vorstellung von einem deutschen Anteil an der Anti-Hitler-Koalition war keine Fiktion, sondern ein mit dem Märtyrertod der Besten des deutschen Volkes besiegelter und durch die Taten der Aktivisten der ersten Stunde bekräftigter legitimer Anspruch.
Das Beispiel Berlin
Am sinnfälligsten trat das Ineinandergreifen von Maßnahmen der sowjetischen Besatzungsorgane und Aktivitäten deutscher Antifaschisten in Berlin zutage. Die ehemalige Reichshauptstadt gehörte zu den vom Kriege am meisten heimgesuchten Städten. Hier hatte die letzte große Schlacht auf dem europäischen Kriegsschauplatz getobt. Meter um Meter hatten sich die Rotarmisten in das durch Bombardierungen amerikanischer und britischer Luftstreitkräfte bereits zertrümmerte Stadtinnere vorkämpfen müssen, bis sie auf dem Reichstagsgebäude die rote Fahne des Sieges hissen konnten.
Als die letzten Schüsse verhallt waren, glich Berlin einer gespenstischen Ruinenlandschaft, über die Schwaden von Qualm und Rauch zogen und in der sich der Geruch von Verwesung ausbreitete. Mehr als 28,5 Quadratkilometer bebauter Stadtfläche waren zerstört. Der historische Kern der Stadt war nicht mehr wiederzuerkennen. Es gab kein Gas und keinen Strom. Wie vor hundert Jahren holte die Bevölkerung ihr Wasser an den noch vorhandenen Handpumpen. Der Verkehr lag still, blockiert wegen verschütteter Straßen, gesprengter Brücken, überfluteter U-Bahn-Schächte, sich aufwerfender Gleise, ausgebrannter Waggons. In dieser Stadt, in der kaum noch etwas an einstige kulturelle und wirtschaftliche Blüte erinnerte, lebten zweieinhalb Millionen Menschen – nur noch reichlich die Hälfte der Vorkriegsbevölkerung. In Berlin stauten sich Truppen der Roten Armee, die diese letzte Feste des Faschismus niedergerungen hatten, und deutsche Kriegsgefangene, die auf ihren Abtransport warteten. Die Verantwortung für die Stadt und ihre Bürger war mit der Funktion des Stadtkommdanten Generaloberst Nikolai Bersarin übertragen worden.



Der rastlos aktive sowjetische Kommunist im Soldatenrock nahm sich der Geschicke Berlins an, als handle es sich um seine Vaterstadt. Er hat sich die Sympathien zahlreicher Berliner erworben und sich unvergeßlich in die Annalen der Stadt eingetragen, obwohl er schon wenige Wochen nach Übernahme seiner Funktion an den Folgen eines Motorradunfalls verstarb.
Nikolai Bersarin versicherte sich sofort der Mitarbeit jener deutschen Antifaschisten, die sich in Berlin-Lichtenberg unweit der sowjetischen Stadtkommandantur um die von Walter Ulbricht geleitete Initiativgruppe gesammelt hatten. Mit Walter Ulbricht hatte die KPD einen ihrer erfahrensten und energischsten Führer in die vom Faschismus befreite Metropole entsandt, der gut mit der Bqrliner Arbeiterbewegung vertraut war. 1893 in Leipzig geboren, hatte er den Beruf eines Möbeltischlers ergriffen und sich 1912 der SPD angeschlossen. In den Jahren des ersten Weltkrieges kämpfte er mit aller Entschiedenheit gegen die Kriegspolitik des deutschen Imperialismus. In seiner Vaterstadt gehörte er zu den Mitbegründem der KPD. Seine Partei betraute den einsatzbereiten kommunistischen Funktionär mit vielfültigen Aufgaben und delegierte ihn in führende Gremien der Kommunistischen Internationale. In den harten Klassenauseinandersetzungen der letzten Jahre der Weimarer Republik stand Walter Ulbricht als Politischer Leiter des Bezirks Berlin-Brandenburg-Lausitz-Grenzmark an der Spitze der wichtigsten regionalen Parteiorganisation der KPD. Im Oktober 1933 verließ er auf Beschluß der Parteiflührung Deutschland, um den Kampf gegen den Faschismus vom Exil her zu führen. Er war wesentlich an der Ausarbeitung der Strategie und Taktik des antifaschistischen Kampfes beteiligt, die in den Beschlüssen der Brüsseler und der Berner Konferenz der KPD und in der Politik des Nationalkomitees „Fteies Deutschland“ ihren Ausdruck fanden. Nun setzte er seine ganze Kraft ein, um in Berlin das Beispiel Iür den antifaschistisch-demokratischen Neuaufbau zu schaffen.
In der ersten Maihälfte des Jahres 1945 waren Walter Ulbricht und die Mitarbeiter der von ihm geleiteten Initiativgruppe ständig unterwegs, um eine neue Stadtverwaltung vorzubereiten. Sie erreichten mit Unterstützung der sowjetischen Kommandanturen, daß Geschäfte wieder öffneten, daß noch erhaltene Kinos wieder spielten, daß mit Aufräumungsarbeiten begonnen wurde. Das Freilegen der Straßen gehörte zu den ersten Voraussetzungen, um die Stadt mit dem Lebensnotwendigsten zu versorgen.
Es war ein hochherziger Entschluß der Sowjetregierung, daß sie, unmittelbar nach der bedingungslosen Kapitulation, A. L. Mikojan, Mitglied des Politbüros der KPdSU(B) und Stellvertreter des Vorsitzenden des Rates der Volkskommissare der UdSSR, mit dem Auftrag nach Deutschland entsandte, an Ort und Stelle Maßnahmen zur Rettung der Bevölkerung Berlins wie auch Dresdens und anderer zertrümmerter Großstädte einzuleiten. Am 9. Mai 1945 traf A. L. Mikojan in Berlin ein. Sofort ergingen Weisuirgen an die Stäbe der Roten Armee, aus ihren Beständen die Versorgung der Bediner und der Bewohner ariderer Großstädte sicherzustellen. Nach seiner Rückkehr erklärte A. L. Mikojan gegenüber der „Prawda“: „Unsere Moral und die Traditionen der Sowjetvölker fordern eine menschliche Behandlung der friedlichen Bevölkerung des besiegten Landes … Viele Einwohner von Berlin drücken der Sowjetregierung und dem Sowjetkommando ihren wärmsten Dank für ihre Fürsorge aus.“1

Nachdem in allen Berliner Stadtbezirken neue Verwaltungen ihre Arbeit aufgenommen hatten, konnte Mitte Mai auch die Vorbereitung eines demokratischen Magistrats für Berlin abgeschlossen werden. Den Vertretern der Initiativgruppe der KPD war es gelungen, Sozialdemokraten, bürgeliche Politiker, Vertreter der Kirchen und parteilose Fachleute zur Mitarbeit zu gewinnen. Im Bediner Magistrat fanden sich Politiker und Fachleute unterschiedlicher Weltanschauung und parteipolitischer Bindung in gemeinsamer Verantwortung für den demokratischen Neuaufbau in einer antifaschistischen Koalition zusammen. An der Spitze des am 19. Mai in sein Amt eingeführten Magistrats stand als Oberbürgermeister der parteilose Demokrat Arthur Werner, der in der Nazizeit manchen Verfolgungen ausgesetzt war. Schon hoch betagt, übernahm der frühere Leiter einer Ingenieurschule sein Amt. Sein Stellvertreter war der Kommunist Karl Maron. Als Sozialdemokrat gehört Joseph Orlopp dem Magistrat an. Hermann Landwehr kam aus dem Kreis der Männer des 20. Juli 1944. Zur Mitarbeit hatten sich auch der Chirurg und Leiter der Charit6 Ferdinand Sauerbruch, der Architekt Hans Scharoun, der ehemalige Zentrumspolitiker und Reichsminister a. D. Andreas Hermes und die Pfarrer Peter Buchholz und Heinrich Grüber bereit erklärt.
Der neue Magistrat leitete sofort eine grundlegende Demokratisierung ein. Mit Hilfe von Straßen- und Hausvertrauensleuten wurden die Verbindungen zur Bevölkerung geknüpft und die ersten Lebensmittelkarten ausgegeben, deren Sätze höher lagen als die Hungerrationen der letzten Kriegswochen. Der Magistrat und die unter seiner Leitung arbeitende neue Stadtverwaltung widmeten sich dem Wiederaufbau des Schulwesens, sie begannen, das Post- und Fernmeldewesen, den Verkehr, die Bewirtschaftung von Wohn- und Gewerberaum, den Arbeitseinsatz, die Finanzen und Steuern, das Versicherungswesen und andere wichtige Bereiche kommunaler Tätigkeit zu ordnen. Bis zum 9. Juli 1945 wurden 15 795 ehemalige Mitglieder der NSDAP aus der Verwaltung und den städtischen Betrieben entlassen. Noch im Mai konstituierte sich die neue Bediner Gerichtsbarkeit, die sich aus Richtern und Staatsanwälten zusammensetzte, die nicht der NSDAP angehört hatten. Unter der Leitung von Paul Markgraf, eines Mitkämpfers des Nationalkomitees „Freies Deutschland“, begann der Aufbau einer neuen Polizei, deren Kern bewährte Hitlergegner, insbesondere klassenbewußte Arbeiter, bildeten. Auch das kulturelle Leben kam wieder in Gang. Bereits am 13. Mai 1945 eab das Berliner Kammerorchester sein erstes Konzert, und am 27 .Mai eröffnete das erste Berliner Theater. In den Kirchen wurde regelmäßig Gottesdienst abgehalten.


„Hier spricht Berlin auf Wellenlänge 356 Meter.“ Mit diesem Rufzeichen meldete sich am Abend des 13. Mai 1.945 der erste antifaschistische deutsche Rundfunksender aus der verwüsteten und erschöpften Metropole mit einer einstündigen Nachrichtenübertragung. Durch ihn wie durch die „Berliner Zeitung“, deren erste Nummer am 21. Mai 1945 erschien, wurde das Bediner Beispiel weit über die Grenzen der Stadt hinaus bekannt. Es kündete vom Lebenswillen der schwer geprüften Bevölkerung und demonstrierte, was gemeinsames Anpacken aller Antifaschisten und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den sowjetischen Besatzungsorganen zu erreichen vermochten.
In den Maitagen fanden sich auch die ersten Arbeiter wieder in ihren Arbeitsstätten ein. Sie warteten nicht auf die Unternehmer, sondern begannen unter Leitung selbstgewählter Betriebsausschüsse mit Aufräumungsarbeiten und – wo Möglichkeiten dafür gegeben waren – mit einer provisorischen Produktion. Während die Rote Armee mit Pioniertechnik den Trümmern zuleibe ging, griffen die Beiliner – nicht immer freiwillig – zur Schippe, um Gehwege und Straßen zu beräumen.
Wie in Berlin, so wurde auch in anderen Städten des sowjetischen Besatzungsgebietes den deutschen Antifaschisten Verantwortung übertragen, legten Besätzungsorgane und neue deutsche Verwaltungen gemeinsam Hand an. Das führte dazu, daß Lethargie und Tatenlosigkeit hier rascher überwunden wurden als in vielen von amerikanischen, britischen und französischen Truppen besetzten Städten und Gemeinden.
Die Welt nach dem Kriege
Das Frühjahr 1945 hatte vielen Entmutigten und Zweifelnden gezeigt: Das Leben geht weiter. Doch die Welt, in der das deutsche Volk lebte, hatte sich grundlegend gewandelt. Alle politischen Kräfte, die willens waren, gestaltend in die künftige Entwicklung einzugreifen, sahen sich mit völlig neuartigen äußeren und inneren Bedingungen und Möglichkeiten konfrontiert.

Wenn auch die Kapitulation Japans und die Waffenruhe in Asien noch ausstanden, so wurde doch der Sieg über den faschistischen deutschen Imperialismus in Europa und in weiten Teilen der Welt bereits als Wende vom Krieg zum Frieden empfunden. Die öffentliche Meinung auf dem ganzen Planeten war von der Überzeugung beherrscht, daß dem mit größten Opfern errungenen Frieden Dauer verliehen werden mußte. Nicht nur die sowjetische Führung, auch realistisch denkende Politiker der Westmächte zeigten sich an einer stabilen Friedensordnung interessiert. Die Mehrheit der Weltbevölkerung hoffte, daß die Anti-Hitler-Koalition, die die Aggressoren bezwungen hatte, als ein friedensbewahrendes Bündnis fortleben werde. Hatten sich doch im Februar 1945 Großbritannien, die USA und die UdSSR auf der Konferenz von Jalta für ein ,,gemeinsames Vorgehen bei der Lösung der politischen und wirtschaftlichen Probleme des befreiten Europas in Übereinstimmung mit demokratischen Prinzipien“2 ausgesprochen und ihre Entschlossenheit bekundet, eine weltumspannende Organisation der Vereinten Nationen ins Leben zu rufen.
Am 26. Juni 1945 unterzeichneten in San Francisco die Vertreter von 50 Staaten die Charta der United Nations Organization (UNO). Deren Satzungen erklärten es zur Hauptaufgabe der in ihr zusammengeschlossenen Nationen, ,,den Weltfrieden und die internationale Sicherheit aufrechtzuerhalten und zu diesem Zweck wirksame Kollektivmaßnahmen zu ergreifen, um Bedrohungen des Friedens zu verhüten und zu beseitigen und Angriffshandlungen oder andere Friedensbrüche zu unterdrücken“.3 Die UNO-Mitgliedstaaten verpflichteten sich, bei der Beseitigung von Faschismus, Kolonialismus und Rassismus zusammenzuwirken und sich für die Entwicklung gleichberechtigter Beziehungen zwischen den Staaten und Völkern einzusetzen. Mit dem Sicherheitsrat der UNO entstand ein Gremium gemeinsamer Verantwortung der zu ständigen Mitgliedern berufenen Mächte der Anti-Hitler-Koalition USA, UdSSR, Großbritannien, Frankreich und China.
Am einvernehmlichen Handeln der Alliierten war das fortschrittliche Deutschland brennend interessiert, denn es bot die günstigsten Voraussetzungen für die vollständige Liquidierung aller Überreste des Faschismus und Militarismus und für’die Schaffung eines friedliebenden, demokratischen deutschen Staates. So stark der Wunsch nach einer stabilen Friedensordnung war, so schwiörig gestaltete sich ihre Verwirklichung, denn in der internationalen Politik zeigten sich schon jetzt zwei Tendenzen: einerseits das Streben der Sowjetunion nach friedlicher Koexistenz der unterschiedlichen sozialen Systemen angehörenden Staaten, das sich mit Vorstellungen realistisch urteilender Kreise der herschenden Klassen der Westmächte zumindest partiell in Einklang befand; andererseits der Kurs reaktionärer, militant antisowjetischer Gruppierungen, die durch den Zuwachs der UdSSR an Kraft, internationalem Ansehen und Einfluß aufgeschreckt waren und rasch zu einer Politik der Konfrontation zurückkehren wollten.
Die dem Imperialismus entspringenden Ursachen moderner Kriege bestanden fort. Der Gegensatz zwischen Kapitalismus und Sozialismus war durch die Anti-Hitler-Koalition nicht aufgehoben. Das Verlangen imperialistischer Politiker, die neue, sozialistische Ordnung wieder aus der Welt zu schaffen, bedeutete eine permanente Bedrohung für die Sowjetunion und andere antiimperialistische Staaten und Bewegungen. Es konnte wie in der Vergangenheit auch in Zukunft in die militärische Aggression umschlagen. Hinzu kamen viele lokale Konfliktherde, die gefährlichen Zündstoff für die Weltpolitik enthielten. Doch wurden die bestehenden Gegensätze nun unter den Bedingungen eines im Vergleich zur Vorkriegszeit wesentlich veränderten internationalen Kräfteverhältnisses ausgetragen. In der Welt waren jene Kräfte erstarkt, die einen dritten Weltkrieg mit allen Mitteln verhindern wollten.
Die internationale Situation war vor allem geprägt durch den Sieg der Sowjetunion und der Völker der Anti-Hitler-Koalition über den deutschen und den italienischen Faschismus und durch die bevorstehende Bezwingung des japanischen Imperialismus.
Der Sieg der Sowjetunion im Großen Vaterländischen Krieg hatte neue, günstigere Bedingungen für den Vormarsch des Sozialismus eröffnet. Die UdSSR hatte selbst angesichts der unter Josef Wissarionowitsch Stalin vollzogenen Fehlentwicklungen die schwerste Prüfung ihrer Geschichte bestanden. Mit ihrer Gesellschaftsordnung und der Moral ihrer Bevölkerung hatte sie sich den imperialistischen Aggressoren überlegen erwiesen. Trotz der schweren Opfer, die ihr abvedangt worden waren, ging die Sowjetunion gefestigt aus dieser beispiellosen militärischen Auseinandersetzung hervor. Ohne ihr Mitwirken konnte kaum eine wichtige Frage der Weltpolitik mehr gelöst werden.
In Europa dominierten die Ideen und Ziele des Antifaschismus. Weitverbreitet war die Auffassung, daß das monopolkapitalistische Wirtschaftssystem überlebt sei und daß es weder eine friedliche Entwicklung noch einen wirtschaftlichen Wiederaufbau bei sozialer Gerechtigkeit gewähdeisten könne. Die Volksmassen forderten überall, daß die Schuldigen am Kriege – die faschistischen Aggressoren -, aber auch die einheimische Mitverantwortlichen an den Verbrechen der Okkupationsregime zur Rechenschaft gezogen werden. Sie wollten jeglichen Expansionsdrang für immer gezügelt und die Zusammenarbeit mit der UdSSR fortgesetzt wissen. In nahezu allen Ländern Europas waren die Linkskräfte im Vormarsch.
Aus dem Kampf der Völker gegen die Aggressoren und die mit diesen kollaborierenden einheimischen Ausbeuter und Unterdrücker war eine neue Welle von Revolutionen hervorgegangen. Sie hatte Albanien, Bulgarien, Jugoslawien, Polen, Rumänien, die Tschechoslowakei und Ungarn erfaßt. In diesen Ländern verwirklichte die Arbeiterklasse unter Führung der kommunistischen und Arbeiterparteien ihre Hegemonie, entriß sie im Bunde mit den werktätigen Bauern und anderen Werktätigen der Großbourgeoisie und den Großgrundbesitzern die Macht. Dieser bald als volksdemokratische Revolution charakterisigrte Umwälzungsprozeß war auch in Griechenland zu beobachten. Doch wurde er hier durch die Intervention britischer Truppen gestoppt, der jahrelange bewaffnete Kämpfe zwischen den antiimperialistisch-demokratischen und den reaktionär-monarchistischen Kräften Griechenlands folgten. Auch in Italien hatte der Kampf gegen den Faschismus Züge einer revolutionären Erhebung angenommen. In Frankreich und Belgien kam es zu heftigen Klassenauseinandersetzungen, in denen die Werktätigen grundlegende Veränderungen der Macht- und Eigentumsverhältnisse forderten. Die faschistischen Diktaturen in Spanien und Portugal wankten.
Nationale und soziale Befreiungsrevolutionen veränderten auch die Lage auf dem asiatischen Kontinent, vor allem im Norden Koreas und in Vietnam. Die Zerschlagung der japanischen Guandongarmee durch sowjetische Truppen, die durch die Armee der Mongolischen Volksrepublik unterstützt wurden, erleichterte den Vormarsch der chinesischen Volksbefreiungsarmee und bereitete den Sieg der Volksrevolution lin China mit vor.
Dieses Voranschreiten der Kräfte des Friedens, der Demokratie und des sozialen Fortschritts, die revolutionären Veränderungen mit sozialistischer Perspektive in mehreren Ländern Europas und Asiens waren das bedeutendste geschichtliche Geschehen nach der Großen Sozialistischen Oktoberrevolution und das hervorstechendste Kennzeichen des neuen internationalen Kräfteverhältnisses.
Von ihm gingen auch wichtige Impulse für einen Aufschwung der revolutionären Arbeiterbewegung in den Ländern des Kapitals aus. Die kommunistischen und Arbeiterparteien erstarkten an Zahl und Einfluß. In Belgien, Chile, Dänemark, Finnland, Frankreich, Island, Italien, Luxemburg, Norwegen und österreich gelangten vor allem dank ihres hervorragenden Anteils am Kampf gegen Faschismus und Kollaboration Kommunisten in die Regierungen. In einigen kapitalistischen Ländern konnten die Werktätigen demokratische Forderungen durchsetzen und ihre politischen und sozialen Rechte erweitern, wurden wichtige Industriezweige nationalisiert, so daß sich die Möglichkeit grundlegender demokratischer Umgestaltungen eröffnete. In Großbritannien, aber auch in anderen Ländern knüpften viele Werktätige hohe Erwartungen an den Wahlsieg der Labour Party, von dem sie sich eine sozialistische Erneuerung erhofften, die auf den Kontinent ausstrahlen werde.
Diese Erfolge waren wesentlich der sich in nationalem und internationalem Rahmen entfaltenden Aktionseinheit der Arbeiterklasse zu danken. In der Slowakei hatten sich die Kommunistische und die Sozialdemokratische Partei bereits im September 1944 zusammengeschlossen, und in einigen westeuropäischen Ländern wurde die Frage der Vereinigung von Kommunisten und Sozialisten in einer Einheitspartei rege diskutiert. Als viele Millionen Mitglieder umfassende internationale Organisationen bildeten sich beim Übergang vom Krieg zum Frieden ein einheitlicher internationaler Gewerkschaftsbund, eine weltumspannende Jugendorganisation und eine weltweite demokratische Frauenöderation sowie weitere internationale demokratische Verbände heraus. Ihr Anliegen war es, die Ideen der antifaschistischen Solidarität in die neue Zeit zu tragen und eine breite Kampffront ftir Frieden, Demokratie und sozialen Fortschritt zu schaffen.
Auch die Kolonien und Halbkolonien wurden von diesem Aufschwung der Arbeiterbewegung und der Fortschrittskräfte erfaßt. Vor allem auf Asien strahlte die Befreiermission der Sowjetunion aus; die nationale Befreiungsbewegung nahm zum Teil die Form revolutionärer Befreiungskriege an. Indien und Burma befanden sich auf dem Wege zu staatlicher Unabhängigkeit. Die Völker Agyptens, Syriens und des Libanons kämpften um ihre volle nationale Souveränität. In Malaya, Indochina, Indonesien und auf den Philippinen entbrannten bewaffnete Kämpfe gegen die Kolonialhenen. Das imperialistische Kolonialsystem begann zu zertallen, wenngleich dies ein Prozeß war, der sich noch über Jahrzehnte hinziehen sollte.
Wie die Weltlage bewies, hatten die Kalkulationen jener antisowjetischen Kreise ein Fiasko erlitten, die darauf spekulierten, Hitlerdeutschland und die Sowjetunion würden einander ausbluten, so daß am Ende des Krieges die uneingeschränkte Herrschaft der imperialistischen Westmächte hergestellt sein werde. Statt dessen zeugten das Ausbrechen weiterer Länder aus dem imperialistischen Machtbereich und die Einschränkung der imperialistischen Kolonialhenschaft davon, daß das kapitalistische System in eine neue Etappe seiner allgemeinen Krise eingetreten war. Dies war mit weitreichenden Kräfteverschiebungen innerhalb des Systems imperialistischer Staaten verbunden, in denen sich die ungleichmäßige Entwicklung des Kapitalismus widerspiegelte. Von den sechs imperialistischen Mächten, die vor dem zweiten Weltkrieg eine beherrschende Stellung in der Welt eingenommen hatten, waren Deutschland, Japan und Italien militärisch geschlagen. Sie waren als Großmächte ausgeschaltet, hatten eroberte,Territorien bzw. Kolonialgebiete verloren, sahen friedensvertraglichen Regelungen entgegen, die ihren Expansionsdrang zügelten und ihnen Wiedergutmachungsleistungen auferlegten. Selbst die Siegeimächte Großbritannien und Frankreich, obwohl noch immer die größten kolonialen Ausbeuter, waren ökonomisch, politisch und militärisch erheblich geschwächt. Demgegenüber gingen die USA beträchtlich gestärkt und als eindeutige Führungsmacht des imperialistischen Systems aus dem zweiten Weltkrieg hervor. Die USA, auf deren Lieferungen und Beistand alle kapitalistischen Länder während des Krieges wie auch für die Nachkriegszeit angewiesen waren, nutzten ihre beherrschende Stellung im imperialistischen System aus, um selbst hochentwickelte Länder in Abhängigkeit zu bringen und in deren bisherige Einflußsphären vor allem in Afrika und Asien vorzustoßen. In vielen Gebieten der Erde waren Truppen der USA stationiert, wo sie häufig die Schirmherrschaft über reaktionäre Regime übernahmen.
So kennzeichnete die Welt beim Übergang vom Krieg zum Frieden eine vielgestaltige und widersprüchliche Konstellation. Diese bot mehrere Entwicklungsmöglichkeiten, so auch die Chance, den Weltfrieden auf der Grundlage konstruktiver Zusammenarbeit der Hauptmächte der Anti-Hitler-Koalition dauerhaft zu sichern und eine neue Ara in den internationalen Beziehungen und in der Menschheitsgeschichte einzuleiten.
Der Untergang des Deutschen Reiches und die alliierte Viermächteadministration für Deuschland
1945 war das mehr als sieben Jahrzehnte zuvor mit Eisen und Blut begründete Deutsche Reich in Schutt und Asche untergegangen. Es war im historischen wie im völkenechtlichen Sinne nicht mehr existent. Die vom Hitlernachfolger Großadmiral Karl Dönitz in Flensburg installierte Reichsregierung wurde von den Mächten der Anti-Hitler-Koalition nicht einmal als Konkursverwalter akzeptiert.
Das Deutsche Reich, 1871 im eroberten Versailles ausgerufen, die Macht von Junkertum und Großbourgeoisie manifestierend, hatte in seiner Geschichte manche Wandlung erfahren. Aus dem von Preußen dominierten Kaiserreich war im Gefolge der Novemberrevolution die kapitalistische Weimarer Republik hervorgegangen, deren Weg schließlich in die faschistische Diktatur, ins faschistische „Großdeutsche Reich“ geführt hatte. Lag in dieser Entwicklung auch keine Zwangsläufigkeit, so entsprang sie doch den in ihren Wesenszügen gleichbleibenden militaristisch-junkerlich-großbourgeoisen Grundlagen des Deutschen Reiches. Nur wenn es gelungen wäre, diese zu beseitigen, hätten sich Reichsidee und demokratische Republik miteinander verbinden, hätte das Deutsche Reich eine progressive Perspektive gewinnen können. Doch der Gang der deutschen Dinge war ein anderer. Mit der Entfesselung zweier Weltkriege demonstrierten die deutschen Imperialisten vor aller Welt, daß das von ihnen beherschte Reich nicht friedlich und gedeihlich mit anderen Völkern und Staaten zusammenleben konnte.
Dieses Deutsche Reich hatte bei all seinen Gebrechen und Verbrechen aber auch den nach langen Kämpfen ereichten einheitlichen bürgerlichen deutschen Nationalstaat verkörpert. Auf seinem Boden hatten sich stürmische Fortschritte von Wissenschaft und Technik und ein rascher Aufschwung der Produktivkräfte vollzogen. Mit ihrem hohen Können vermochten Ingenieure und Facharbeiter den Produkten der deutschen Industrie Ansehen auf allen Kontinenten zu verschaffen. In der deutschen Landwirtschaft war trotz überlebter Eigentumsstrukturen ein vergleichsweise hoher Grad der Mechanisierung und der Anwendung agrarwissenschaftlicher Erkenntnisse erreicht worden. Als Staatsbürger des Deutschen Reiches hatten Schriftsteller, Maler, Bildhauer und Musiker, Theateleute und Filmemacher, Mediziner, Erfinder und Techniker, Natur- und Gesellschaftswissenschaftler Leistungen von Weltgeltung erbracht.
So war bei aller Vielfalt historischer und regionaler Traditionen in Gestalt des Deutschen Reiches ein Nationalverband zu staatlicher Einheit geführt worden, den die überwältigende Mehrheit des Volkes in all seinen Klassen und Schichten bejahte. Unter preußischer Führung zustande gekommen, bedeutete das Reich den Zusammenschluß von Einzelstaaten, zwischen denen erhebliche, doch sich allmählich abschwächende ökonomische, politische und sozial-kulturelle Unterschiede bestanden. Die bürgerliche deutsche Nationalkultur vermochte sich voll auszuprägen, und es entstand eine proletarische Kultur und Lebensweise, in der sich bereits sozialistische Züge ausbildeten. Das Reich bot das Kampffeld, auf dem die gegensätzlichen Klassenkräfte ihre Auseinandersetzungen austrugen. Und so sehr die progressiven Kräfte die reaktionären Grundlagen des Deutschen Reiches bekämpften, so wenig kam es ihnen in den Sinn, den einheitlichen deutschen Nationalstaat in Frage zu stellen.
Trotz allem war das Deutsche Reich, als es von außen zerschlagen wurde, längst von innen heraus zersetzt, durch die antinationale Politik seiner herrschenden Klasse und politischer Abenteurer. Das faschistische „Großdeutsche Reich” bedeutete die Negierung all dessen, was dem Reich durch revolutionären Wandel hätte eine Perspektive geben können. Der Faschismus hatte den tiefen inneren sozialen Riß, der von Anfang an gegeben war, zu einer unüberbrückbaren Kluft verbreitert. Durch ein barbarisches Terrorregime waren große Teile der Bevölkerung ihrer Bürgerrechte beraubt bzw. physisch vernichtet worden – Juden, Kommunisten, Sozialdemokraten und bürgerliche Gegner des Naziregimes. Die Hitlerregierung hatte mit ihrem „Reichsaufbau”, mit der Bildung von „Reichsgauen“ unter der Herrschaft von „Reichsstatthaltem”, ihre Diktatur ausgebaut. Die polnische Minderheit war mit der totalen physischen Vernichtung bedroht, die sorbische Minderheit einer sich verschärfenden Germanisierungspolitik unterworfen worden. Indem die nazistische Führung den zweiten Weltkrieg vom Zaune brach und riesige Gebiete vor allem im Osten und Süden annektierte, fügte sie nicht nur anderen Völkern nicht wiedergutzumachendes Unrecht zu, sondern hob sie auch den ursprünglich weitgehend einheitlichen national-ethnischen Bestand des Deutschen Reiches auf. Der bis fünf Minuten nach zwölf geführte, in der bedingungslosen Kapitulation endende Krieg war der letzte Akt des Zerstörungswerkes der herrschenden Klasse am Deutschen Reich.
Den Untergang des Deutschen Reiches als Inkarnation reaktionärer Herrschaft brauchte das demokratische Deutschland nicht zu bedauern, wohl aber mußte es die Gefahr beunruhigen, daß mit dem Reich auch die Möglichkeit zur Bildung eines neuen Nationalstaates und die Einheit der Nation vedorengingen Derartige Folgen der faschistischen Politik hatten deutsche Antifaschisten – Kommunisten, Sozialdemokraten, bürgerliche Humanisten, Hitlergegner aus christlicher Verantwortung und patriotische Offiziere – im antifaschistischen Widerstandskampf abzuwenden versucht. Doch die von ihnen erstrebte Befreiung vom Faschismus aus eigener Kraft war nicht gelungen. Die Katastrophe des Deutschen Reiches vermochten sie nicht abzuwenden.
Der Untergang des Reiches erschütterte das Nationalbewußtsein der Deutschen auf bedrohliche Weise. Aus den chauvinistischen Verirrungen herauszufinden, die Mitschuld des deutschen Volkes am Geschehenen zu erfassen und in einem von den Siegermächten regierten Land die eigene nationale Identität neu zu bestimmen war in höchstem Grade schwierig. Um so größer war die Versuchung, sich mit nihilistischer nationaler Selbstverleugnung in die Arme eines nebulosen Kosmopolitismus oder Europäertums zu werfen. Nur aus dem Kampf des „anderen Deutschlands“ gegen die braune Tyrannei ließ sich ein würdiger Patriotismus begründen, der mit internationalistischem Denken in Einklang stand. Aber diesem Kampf hatte die überwältigende Mehrheit des deutschen Volkes ferngestanden, und auch nach der Befreiung konnte es sich dessen Traditionen nur schrittweise nähern.
Die Anti-Hitler-Koalition hatte sich bei der Fixierung ihrer Kriegsziele davon leiten lassen, daß das Deutsche Reich, das zweimal in diesem Jahrhundert einen völkermordenden Krieg begonnen hatte und in dessen Namen die scheußlichsten Verbrechen der Mensch“ heitsgeschichte begangen worden waren, seine Daseinsberechtigung verwirkt habe. Die Beseitigung des „Großdeutschen Reiches“ und die ,,Auflösung Preußens“, des Rückgrates des Reiches, gehörten zu ihren Kriegszielen. Damit setzten die alliierten Siegermächte im praktischen wie im völkerrechtlichen Sinne den Schlußpunkt für die Existenz des Deutschen Reiches.
Auch wenn dies von Historikern und Völkerrechtlern der BRD immer wieder bestritten wird – es gibt keine Fortexistenz des Deutschen Reiches als Subjekt des Völkerrechts. Am Ende des zweiten Weltkrieges war keine deutsche Staatsgewalt vorhanden, die in der Lage gewesen wäre, das Leben des deutschen Volkes zu organisieren und die berechtigten Forderungen der Anti-Hitler-Koalition zu erfüllen. Die Überreste des faschistischen Staatswesens waren dafür nicht nur nicht kompetent, sondern geradezu das größte Hindernis und deshalb schnellstens zu beseitigen Der antifaschistische deutsche Widerstand hatte bei allem Einsatz und bei allen Opfer keine neue, für die Anti-Hitler-Koalition akzeptable Regierungsgewalt hervorgebracht. Geblieben war das deutsche Volk, war sein Selbstbestimmungsrecht, wie es die Charta der Vereinten Nationen allen Völkern zugebilligt hatte. Ihm war die Chance eingeräumt, in Übereinstimmung mit den Forderungen der Alliierten die Voraussetzungen für den Aufbau eines friedliebenden, antifaschistisch-demokratischen deutschen Staates zu schaffen. Doch konnte dieser Staat weder mit dem Deutschen Reich identisch sein noch dessen Existenz fortsetzen.
Am 5. Juni 1945 unterzeichneten die Oberbefehlshaber der verbündeten Armeen, Dwight D. Eisenhower, Georgi Konstantinowitsch Schukow, Bernard L. Montgomery und Jean de Lattre de Tassigny, in Berlin-Wendenschloß die „Erkärung in Anbetracht der Niederlage Deutschlands und der Übernahme der obersten Regierungsgewalt hinsichtlich Deutschlands durch die Regierungen des Vereinigten Königreiches, der Vereinigten Staaten von Amerika und der Union der Sozialistischen Sowjet-Republiken und durch die Provisorische Regierung der Französischen Republik“. In diesem Dokument wurde in Übereinstimmung mit der Krimdeklaration vom Februar 1945 festgestellt: „Es gibt in Deutschland keine zentrale Regierung oder Behörde, die fähig wäre, die Verantwortung für die Aufrechterhaltung der Ordnung, für die Verwaltung des Landes und für die Ausführung der Forderungen der siegreichen Mächte zu übernehmen … Die Regierungen des Vereinigten Königreichs, der Vereinigten Staaten von Amerika, der Union der Sozialistischen Sowjet-Republiken und die Provisorische Regierung der Französischen Republik übernehmen hiermit die oberste Regierungsgewalt in Deutschland einschließlich aller Befugnisse der deutschen Regierung, des Oberkommandos der Wehrmacht und der Regierungen, Verwaltungen oder Behörden der Länder, Städte und Gemeinden. Die Übernahme zu den vorstehend genannten Zwecken der besagten Regierungsgewalt und Befugnisse bewirkt nicht die Annektierung Deutschlands.“4
In den völkerrechtlichen Dokumenten der Anti-Hitler-Koalition wurde dem deutschen Volk das Recht eingeräumt, sein Leben auf demokratischer und friedlicher Grundlage zu gestalten und auf diese Weise seine staatliche Souveränität wiederzuerlangen. Zunächst jedoch übernahmen die vier Mächte die oberste Regierungsgewalt. In der ebenfalls am 5. Juni 1945 verabschiedeten „Feststellung” über das Kontrollverfahren in Deutschland fixierten sie, wie die alliierte Verwaltung funktionieren sollte. Sie beabsichtigten, die ,,oberste Gewalt“ für die Zeit zu übernehmen, „in der Deutschland die sich aus der bedingungslosen Kapitulation ergebenden grundlegenden Forderungen erfüllt“. Die Ausübung der obersten Gewalt sollte auf Anweisung der Regierungen der vier Mächte durch deren Oberbefehlshaber in Deutschland erfolgen, „von jedem in seiner eigenen Besatzungszone und gemeinsam in allen Deutschland als Ganzes betreffenden Angelegenheiten”.5 Hierzu war die Bildung eines Alliierten Kontrollrates mit Sitz in Berlin vorgesehen.
Mit den Dokumenten vom 5. Juni 1945 wurden die bereits im letzten Kriegsjahr von den alliierten Mächten getroffenen Vereinbarungen über die Besetzung und Verwaltung Deutschlands in Kraft gesetzt. Die Sowjetregierung gab die Weisung zur Bildung der Sowjetischen Militäradministration in Deutschland (SMAD) mit Sitz in Berlin-Karlshorst. Die USA schufen in Frankfurt am Main das Office of Military Goverment for Germany United States (OMGUS). Die Briten etablierten in Bad Oeynhausen und Umgebung die Control-Commission for Germany/British Element (CCG/BE). Die Franzosen richteten in Baden-Baden das Conseil de Contrôl de la France pour l’Allemagne ein. In Verbindung mit der vorgesehenen Installierung des Alliierten Kontrollrates in Berlin – so war verei bart worden – sollten in den zwölf westlichen Verwaltungsbezirken der Stadt Besatzungstruppen der westlichen Alliierten stationiert werden. Um das beträchtliche Personal der am Kontrollrat beteiligten Mächte in Berlin unterzubringen, wurde die Stadt in vier Besatzungssektoren eingeteilt, Eine Alliierte Kommandantur sollte die gemeinsame Kontrolle der Verwaltung der Stadt sicherstellen. Für ihren militärischen Zugang nach Berlin wies das sowjetische Oberkommando den Westmächten im Sommer 1945 eine Autobahn- und eine Eisenbahnverbindung und etwas später noch drei Fluglinien, oft als Luftkorridor bezeichnet, zn, wobei sich die sowjetischen Organe die Kontrolle des Verkehrs von Truppenpersonal und Gütern der Westmächte zwischen Bedin und den Westzonen vorbehielten. Beim Alliierten Kontrollrat, der sich am 30.Juli 1945 konstituierte, wurde eine alliierte Luftsicherheitszentrale eingerichtet. Alle diese Regelungen waren an die Ausübung der Besatzungs- und Verwaltungsfunktionen des Alliierten Kontrollrates gebunden. Sie waren also bezogen auf die Verantwortung jeder Siegermacht für die Ausrottung des deutschen Faschismus und Militarismus und für die Demokratisierung Deutschlands. Ein davon losgelöster „Viermächtestatus“ Berlins wurde weder 1945 noch später begründet. Berlin wurde somit kein besonderes, aus der sowjetischen Besatzungszone herausgelöstes Besatzungsgebiet, keine – wie später von westlicher Seite behauptet – ,,fünfte Zone“. Die besonderen Regelungen hoben die oberste Gewalt der SMAD hinsichtlich Bedins nicht auf.
Mit der Bildung von vier Besatzungszonen waren Strukturen und Bedingungen geschaffen, die sich gravierend auf die künftige Entwicklung des deutschen Volkes auswirken mußten. Indem die Besatzungsmächte Befehle, Direktiven und Gesetze erließen und mit der praktischen Ausübung ihrer Verwaltungshoheit als Exekutivorgane tätig wurden, steckten sie zugleich den Rahmen ab, in dem sich Eigeninitiativen politischer und gesellschaftlicher Kräfte des deutschen Volkes entfalten konnten. Eine Lösung der für das Überleben der deutschen Bevölkerung dringlichsten Probleme war zunächst nur auf Basis der einzelnen Besatzungszonen denkbar, und selbst hier wirkten sich die Unterbrechung von Verkehrs- und Nachrichtenverbindungen und regionale Differenziertheit aus. Auch die Direktiven des Alliierten Kontrollrates konnten nur über ihre Umsetzung in den einzelnen Zonen Realität werden. Eine Tendenz zu deren Verselbständigung war somit objektiv gegeben und für die Anfangsphase geradezu unvermeidlich.
Andererseits jedoch bedeuteten die vereinbarte Viermächteverwaltung Deutschlands und die Installierung alliierter Organe eine definitive Absage an die während des zweiten Weltkrieges vor allem von amerikanischer und britischer Seite in unterschiedlichen Varianten vorgetragenen Zerstückelungspläne. Das Besatzungsregime an sich war keine Präjudizierung künftiger staatlicher Entwicklung. Wenn sich alle Besatzungsmächte an die vereinbarten Grundsätze alliierter Deutschlandpolitik hielten und den Abschluß eines Friedensvertrages ernsthaft und in absehbaren Fristen vorbereiteten, waren Dauerfolgen der Äufteilung in Besatzungszonen nicht unvermeidlich.

Innerhalb der einzelnen Zonen kam den Ländern bzw. Provinzen großes Gewicht zu. Sie stellten in der Regel historisch gewachsene Einheiten dar, in deren Rahmen die Bewältigung der Notlage der Bevölkerung am ehesten denkbar schien. Zudem waren sie die oberste Ebene, auf der die Alliierten eine gemäß ihren Direktiven handetnde deutsche Selbstverwaltung gestatteten. Die Besatzungsmächte unterstrichen ihrerseits die Rolle der Länder und Provinzen, indem sie auch auf dieser Ebene Militäradministrationen bzw. -regierungen schufen und in unterschiedlichen Formen mit den jeweils verantwortlichen deutschen Vertretern zusammenarbeiteten.
Fragen der Landespolitik gewannen zudem an Gewicht, weil im Zusamrnenhang mit der beabsichtigten Auflösung des preußischen Staates sowie in Anpassung an die Zoneneinteilung die Umwandlung der preußischen Provinzen in Länder bzw. eine Neuordnung der Länder bevorstand. Vor allem in Territorien, in denen autonomistische oder separatistische Bewegungen Tradition hatten, wie in Bayern, in den links-rheinischen Gebieten oder im Hannoverschen, traten derartige Bestrebungen sofort wieder hervor. Das wurde oft mit der Behauptung motiviert, der Faschismus sei vor allem Ergebnis preußischer Politik und übersteigerter Zentralisation gewesen. Mit ähnlichen Argumenten wurde auöh begründet, daß Berlin in Zukunft nicht mehr deutsche Hauptstadt sein könne. Auch von Vertretern der in der Ober- und Niederlausitz beheimateten sorbischen Minderheit wurden Forderungen erhoben, die auf eine Ausgliederung aus historisch gewachsenen Bindungen zum deutschen Umfeld hinausliefen.
Trat mit dem Untergang des Deutschen Reiches die Regionalisierung historischer Prozesse hervor, so waren andererseits Deutschland und deutsche Politik nun auf neue Weise in die Weltpolitik eingebunden. Die Regelung der deutschen Frage wurde für viele Jahre eines der zentralen internationalen Probleme, vor allem in der Nachkriegspolitik der Siegermächte. Hinzu kam, daß die Sowjetunion, die USA, Großbritannien und Frankreich – als Besatzungsmächte unmittelbar präsent – oberste Regierungsgewalt in Deutschland ausübten. Die Politik der sich formierenden politischen Kräfte in Deutschland stand deshalb trotz der anfangs gegebenen außenpolitischen Isolierung in engem Zusammenhang mit der Weltpolitik, mit den internationalen Beziehungen und mit den Auseinandersetzungen zwischen Sozialismus und Imperialismus im Weltmaßstab.
Konturen der Deutschlandpolilik der Hauptmächte der Anti-Hitler-Koalition
Alle Mächte der Anti-Hitler-Koalition maßen in ihren Überlegungen zur künftigen Nachkriegsordnung dem deutschen Problem zentrale Bedeutung bei. Ihre Schlußfolgerungen hinsichtlich der Behandlung des besiegten und besetzten Deutschlands leiteten sie von ihrer grundsätzlichen Bewertung der im Ergebnis des zweiten Weltkrieges veränderten internationalen Lage und von ihren Vorstellungen über die künftige Entwicklung der internationalen Beziehungen her. Das deutsche Problem bestand für sie nicht nur darin, wie ein besiegter Aggressor behandelt werden sollte, sondern mit ihm war die Frage aufgeworfen, wie sich künftig die Verhältnisse im Zentrum Europas entwickeln werden.
Die Hauptmächte der Anti-Hitler-Koalition hielten Eingriffe in die gesellschaftliche Struktur für notwendig, damit Deutschland niemals mehr den Weltfrieden bedrohen könne. Entnazifizierung, Entmilitarisierung und Demokratisierung unter alliierter Kontrolle und bei zeitweiliger Besetzung durch alliierte Truppen sollten die Voraussetzungen hierfür schaffen. Es bestand Einvernehmen, den Deutschen bis an die Grenze ihrer Möglichkeiten gehende Wiedergutmachungsverpflichtungen in Form von Sachleistungen aufzuerlegen und die Nazi- und Kriegsverbrecher einer gerechten Bestrafung zuzuführen. Alle Großmächte anerkannten die Sicherheitsinteressen der Nachbarstaaten Deutschlands.
Einem künftigen starken, unabhängigen, demokratischen Polen wurde wesentlicher Gebietszuwachs im Westen und Norden und damit die Neuregelung der deutsch-polnischen Grenze zugesichert. Außer Zweifel stand die Rückgängigmachung des aus dem Münchner Abkommen von 1938 herrührenden, der Tschechoslowakei zugelügten Unrechts. Die Republik Österreich sollte nach übereinstimmenden Vorstellungen als selbständiger Staat wiedererstehen. Diese und weitere Vereinbarungen entsprachen sowohl dem Gesamtinteresse der Anti-Hitler-Koalition als auch den spezifischen Interessen der einzelnen Siegermächte, von denen jede ihre eigenen Vorstellungen über die künftigen internationalen Beziehungen besaß. Auch in ihrer Haltung zum deutschen Problem äußerten sich selbstverständlich die Bestrebungen der jeweils herrschenden Klassen. Die Partei- und Staatsführung der UdSSR stand vor der Aufgabe, die Ergebnisse des unter schweren Opfern errungenen Sieges im Großen Vaterländischen Krieg zu sichern und dem Sowjetland einen dauerhaften Frieden ftir die Fortführung des sozialistischen Aufbauwerkes zu gewährleisten, eine gerechte und stabile internationale Friedensordnung, basierend auf den Prinzipien der gegenseitigen Sicherheit und der Zusammenarbeit, zu schaffen. Mit diesem Ziel wie im Interesse ihrer eigenen Sicherheit erwies die UdSSR allen Völkern ihre Unterstützung, die den Weg der nationalen Unabhängigkeit und der revolutionären Erneuerung der politischen und sozialen Verhältnisse eingeschlagen hatten. Um die Gefahr neuerlicher Aggressionen zu bannen und den Frieden stabil und dau- erhaft zu machen, trat die sowjetische Partei- und Staatsführung beharrlich dafür ein, die in der Anti-Hitler-Koalition bewährte Zusammenarbeit von Staaten unterschiedlicher Gesellschaftsordnung weiterzuführen. Sie demonstrierte jedoch zugleich, daß sie sich keinem imperialistischen Druck beugen werde, daß sie als sozialistische Großmacht an der Seite der um Demokratie und Sozialismus, gegen Ausbeutung, Unterdrückung und koloniale Versklavung kämpfenden Völker stand.
Im Frühjahr 1945 wurden in allen durch die Rote Armee befreiten deutschen Gebieten die Worte J. W. Stalins vom 23. Februar 1942 – nun zur Losung verkürzt – plakatiert: Die Erfahrungen der Geschichte besagen, daß „die Hitler kommen und gehen, aber das deutsche Volk, der deutsche Staat bleibt“.6 Diese Worte brachten zum Ausdruck, daß die Sowjetunion keinen Rachefeldzug gegen das deutsche Volk zu führen gedachte. Ihr Kampf galt der Vernichtung des Faschismus und damit auch der Befreiung des deutschen Volkes von der faschistischen Diktatur. Die Garantie für eine friedliche Zukunft sah die UdSSR nicht in einer Zerstückelung Deutschlands, nicht in seiner Deindustrialisierung, sondern in der konsequenten Beseitigung der Wurzeln von Faschismus und Kriegspolitik, in der Brechung der Macht der kriegslüsternen Rüstungskonzerne und militaristischen Großgrundbesitzer. Dabei war sie sich bewußt, daß diese mit den Vereinbarungen der Anti-Hitler-Koalition in Einklang stehenden Ziele nur gemeinsam mit den demokratischen Kräften des deutschen Volkes, insonderheit der revolutionären deutschen Arbeiterbewegung, zu realisieren waren.
Die UdSSR trat für die konsequente Wahrnehmung aller Verpflichtungen ein, die sich aus der Besetzung Deutschlands ergaben. Sie forderte eine rasche und lückenlose Entmilitarisierung und Entnazifizierung und eine entschiedene Demokratisierung des politischen, wirtschaftlichen und geistig-kulturellen Lebens in Deutschland. Als das durch Hitlers Raubkrieg am meisten geschädigte Land bestand die Sowjetunion mit besonderem Nachdruck auf der Erkärung deutscher Wiedergutmachungsverpflichtungen, vor allem in Form von Demontagen und von Reparationslieferungen aus der laufenden Jahresproduktion. Sie erhob auch Gebietsansprüche, indem sie ftir sich einen Teil Ostpreußens forderte. Zudem war die sowjetische Deutschlandpolitik in starkem Maße von der polnischen Frage tangiert. Das Sicherheitsinteresse der UdSSR gebot eine Neugestaltung des Verhältnisses zwischen der Sowjetunion und Polen. Dabei bestand die UdSSR auf einer Grenzziehung, die annähernd der 1.919 von der Entente empfohlenen, nach dem damaligen britischen Außenminister benannten Curzon-Linie entsprach. In diesem Zusammenhang setzte sich die UdSSR, auch im Eigeninteresse, für einen beträchtlichen Gebietszuwachs Polens im Westen ein.
In den sowjetischen Vorstellungen von der künftigen europäischen Friedensordnung hatte eine entmilitarisierte, friedliebende, einheitliche deutsche Republik, die durch Erfüllung aller ihr von den Alliierten auferlegten Verpflichtungen das Vertrauen der Völker zurückgewonnen hat, ihren festen Platz. Dieses Konzept entsprach dem Staatsinteresse wie den internationalistischen Traditionen des ersten sozialistischen Staates der Geschichte und stimmte mit den völkerrechtlichen Abkommen der alliierten Mächte über Deutschland überein. Es billigte dem deutschen Volk zu, in Wahrnehmung seines Selbstbestimmungsrechtes über seine politische und soziale Ordnung selbst zu entscheiden, vorausgesetzt, alle Quellen der Expansion und Aggression, alle Wurzeln von Faschismus und Krieg wurden radikal beseitigt.
Die herschenden Kreise in den USA handelten nach dem imperialistischen Konzept einer ,,pax americana“, mit dem sie ein ,,amerikanisches Jahrhundert“ begründen wollten. Ungeachtet beträchtlicher Meinungsunterschiede zwischen verschiedenen Fraktionen der herrschenden Klasse über Teilziele und anzuwendende Strategien, strebte der USA-Imperialismus danach, aus dem Kriege als Weltmacht Nr. 1 hervorzugehen und eine Weltordnung aufzubauen, die von ihm dominiert wurde.
Die Anti-Hitler-Koalition unter Einschluß der Sowjetunion und die Ziele des antifaschistischen Befreiungskampfes der Völker verfehlten jedoch nicht ihre Wirkung auf die Kriegsziele und die Nachkriegspolitik der USA. Mit den Beschlüssen der Konferenz von Jalta hatten auch die USA einem gemeinsamen Nachkriegskonzept der Alliierten zugestimmt. Dieses sah ein Fortbestehen des Bündnisses der Hauptmächte der Anti-Hitler-Koalition sowie – nicht zuletzt – eine gemeinsame Besetzung und Verwaltung Deutschlands vor. Herrschende Kreise der USA verbanden dies allerdings mit Vorstellungen von einer geschwächt aus dem Krieg hervorgehenden und damit unter Druck zu setzenden Sowjetunion sowie mit Illusionen über eine zu erwartende Stärkung des imperialistischen Weltsystems unter Führung der USA. Dennoch war es von grundlegender Bedeutung, daß die Politik der Roosevelt-Administration auf eine langfristige Nachkriegskooperation mit der Sowjetunion ausgerichtet und die militant antisowjetischen Gruppen und Konzepte zurückgedrängt worden waren.
Der bis zu seinem Tode am 12. April 1945 amtierende Präsident Franklin D. Roosevelt hatte innerhalb der Schranken, die ihm seine Klassenzugehörigkeit setzte, in vielen Fragen der internationalen Politik staatsmännische Vernunft bewiesen. Entschlossen, die Ergebnisse des zweiten Weltkrieges zu nutzen, um die USA zur imperialen Führungsmacht auf Dauer zu erheben, verstand er doch, daß auch die UdSSR zu einer Größe der Weltpolitik emporgestiegen war, die respektiert sein wollte. Er sah in ihr einen Staat, der nicht erpreßbar war, über dessen legitime Sicherheitsinteressen man sich nicht einfach hinwegsetzen konnte. Roosevelt baute vor allem auf die ökonomische Überlegenheit des amerikanischen Monopolkapitalismus, für den nach seiner Meinung die Sowjetunion ein interessanter Handelspartner werden konnte. Der Kurs der Roosevelt-Administration bot die Chance, die Anti-Hitler-Koalition in eine die Nachkriegsordnung bestimmende Politik der friedlichen Koexistenz zwischen Staaten unterschiedlicher Gesellschaftsordnung hinüberzuleiten. „Auf keinen Fall darf es ein gegenseitiges Mißtrauen geben, und kleine Mißverständnisse“, so schrieb Roosevelt einen Tag vor seinem Tod an Stalin, „sollten in Zukunft nicht mehr auftreten.“7 Roosevelts Politik enthielt auch Ansatzpunkte Iür all jene, die auf eine gründliche Liquidierung des deutschen Faschismus mit seinen sozialökonomischen Wurzeln und seinen politisch-ideologischen Auswüchsen hinarbeiteten, doch lagen dem mit Roosevelts Namen verbundenen Konzept auch teilweise undifferenziert antideutsche Motive zugrunde, und manche Überlegungen waren einfach unrealistisch.
Die britische Politik war bestrebt, den Zerfall des Empire zu stoppen, Großbritannien den Status einer Weltmacht und vor allem seinen Einfluß in Kontinentaleuropa zu erhalten. Der Versuch, als wichtigster Verbündeter der USA zu agieren, Führungsmacht im Commonwealth zu bleiben und zugleich dominierende Macht in Westeuropa zu werden, überforderte jedoch die realen Möglichkeiten des britischen Imperialismus. Großbritannien war während des zweiten Weltkrieges schon viel zu sehr in Abhängigkeit von den USA geraten, als daß es in globalem Maßstab den Plänen des amerikanischen Konkurrenten hätte wirksam entgegentreten können. Das bedeutete allerdings nicht, daß der britische Imperialismus keiner eigenständigen Außenpolitik mehr ftihig war. Er übernahm seit Frühjahr 1945 eine Voreiterrolle beim Aushöhlen der Politik der Anti-Hitler-Koalition.
Die herrschenden Kreise Großbritanniens beobachteten mit größter Besorgnis, daß sich die internationale Autorität der Sowjetunion beträchtlich erhöht hatte und daß in vielen europäischen Ländern die Linkskräfte im Vormarsch waren. Schon im letzten Kriegsjahr waren von ihnen Pläne geschmiedet worden, die als Gegengewicht dazu einen westeuropäischen Militärpakt vorsahen. In diesen Plänen nahm – zumindest im Denken der reaktionärsten Kräfte – ein nach britischen Vorstellungen entnazifiziertes Deutschland bereits einen festen Platz ein. Symptome dieser Politik waren Bestrebungen, die Rolle der Roten Armee bei der Befreiung Deutschlands möglichst einzudämmen, die Aufrechterhaltung von Verbänden der deutschen Armee als geschlossene sogenannte Diensttruppen und Arbeitsbataillone sowie die Absicht, die zeitweilig von westalliierten Truppen besetzten Gebiete der sowjetischen Besatzungszone nicht zu räumen. Auf dieser Linie lagen auch Übedegungen, die Dönitz-Regierung am Leben zu erhalten, weil sie sich – wie Winston S. Churchill es formulierte – ,,als ein nützliches Werkzeug für uns erweisen“ könnte.8 Die bis zu den Wahlen vom Juli L945 in den Händen der Konservativen liegende britische Politik war weniger als die der Roosevelt-Administration darauf gerichtet, Faschismus und Militarismus in Deutschland auch mit ihren sozialökonomischen Wurzeln auszurotten. Politische Umgestaltungen nach den Demokratievorstellungen des britischen Establishments, eine geistige ,,Umerziehung“ des deutschen Volkes, vor allem aber die spätere Einbindung Deutschlands bzw. deutscher Nachfolgestaaten in einen von Großbritannien dominierten Westblock sollten den Briten Garantien gegen eine erneute deutsche Aggression geben und den deutschen Rivalen zügeln.
An diesem Kurs der britischen Außenpolitik änderte sich auch nach dem Übergang der Regierung in die Hände der Labourpolitiker nichts Grundsätzliches. Die Labour Party errang im Juli 1945 erstmals die absolute Mehrheit im Unterhaus, und Clement R. Attlee löste Winston S. Churchill als Premierminister ab. An diesen Erfolg der Labour Party knüpften die Sozialdemokraten des Kontinents die Hoffnung auf eine sozialistische Initiative Großbritanniens mit internationaler Ausstrahlung. Es entstand das politische Leitbild von einem Europa oder Westeuropa als ,,dritter Kraft“ im Zeichen eines ,,demokratischen Sozialismus“. Die britische Deutschlandpolitik erhielt unter der Labourregierung keine gravierende Neuorientierung. Vorstellungen von einer neugeordneten, vergesellschafteten Großindustrie bzw. einer „Sozialisierung” der Ruhrschwerindustrie blieben vage. Am stärksten war das auf seiten der imperialistischen Staaten vorhandene Bedürfnis nach Sicherheit gegenüber einer deutschen Aggression bei Frankreich ausgeprägt, das sich innerhalb von sieben Jahrzehnten bereits dreimal einer deutschen militärischen Invasion zu erwehren gehabt hatte. Das Bestreben, eine Wiederholung solcher Bedrohung auszuschließen, beherrschte sowohl das Denken des französischen Volkes als auch die Übedegungen der französischen Regierung unter Charles de Gaulle. Diese forderte solche Maßnahmen zur Schwächung Deutschlands, die zugleich einen Machtzuwachs für den französischen Imperialismus bedeuteten. Frankreich sollte aus seiner sekundären Rolle wieder herausfinden und wichtigste europäische Kontinentalmacht werden. Dazu bedurfte es aber nicht nur der Unterstützung von westalliierter Seite sondern auch der Ausgestaltung der französisch-sowjetischen Beziehungen. Da sich die französische Großbourgeoisie bewußt war, daß das Schicksal Frankreichs eng mit dem Schicksal Deutschlands verknüpft blieb, hielt sie ebensowenig von amerikanischen Plänen der Deindustrialisierung Deutschlands wie tonangebende Kreise des britischen Monopolkapitals. Die Rückverwandlung Deutschlands in einen Agrarstaat hätte auch die französische und die britische Wirtschaft in Mitleidenschaft gezogen. Überdies befürchtete man, daß eine anhaltende ökonomische Lähmung in Deutschland den Nährboden für die Hinwendung der Bevölkerung zu den Kommunisten abgeben würde. So stellte die französische Regierung die Schwächung der deutschen Zentralgewalt an die Spitze ihres Deutschlandkonzepts, „Kein zentralisiertes Reich mehr!”9 lautete die erste Forderung de Gaulles. An die Stelle des Reiches sollte ein loser Staatenbund treten, in dem die Länder ihr Eigenleben führten. Der französische Imperialismus erhob Ansprüche auf das Saargebiet und auf linksrheinische Gebiete. Er forderte am nachdrücklichsten eine internationale Kontrolle über das Ruhrgebiet. In Paris setzte man auf die verdeckte Annexion und förderte dementsprechend separatistische und autonomistische Bewegungen. Damit ließ sich nicht nur den Einsprüchen anderer Siegermächte begegnen, sondern auch eine spätere Aussöhnung zwischen dem französischen und dem deutschen Imperialismus anbahnen. Frankreich konnte jedoch nicht im entferntesten daraufrechnen, aufdie Behandlung Deutschlands einen solchen Einfluß auszuüben, wie es das nach dem ersten Weltkrieg bei der Vorbereitung des Versailler Vertrages getan hatte.

Die Deutschlandpolitik der Westmächte stand unter dem Druck der Erwartungen der Völker der Anti-Hitler-Koalition und der antifaschistisch-demokratischen Kräfte in ihren eigenen Ländern. Die Regierungen nahezu aller europäischen Staaten sahen sich mit Massenbewegungen konfrontiert; denn die Werktätigen, die die Hauptlast des Krieges getragen hatten, wollten keine Restauration der unsozialen und in vieler Hinsicht undemokratischen Vorkriegsverhältnisse. Das trug wesentlich dazu bei, daß die imperialistischen Mächte trotz aller Sonderinteressen zunächst am Konsens der Anti-Hitler-Koalition festhielten. Allerdings interpretierten sie diesen dahingehend, daß die vereinbarte Demokratisierung Deutschlands bzw. des deutschen Volkes allein nach ihren Vorstellungen zu erfolgen habe. Diese „Demokratisierung“ sollte den deutschen Rivalen schwächen und ihren Einfluß auf Deutschland nachhaltig sichern‘ Seinen krassesten Ausdruck hatte dieser Kurs in dem nach dem amerikanischen Finanzminister Henry L. Morgenthau benannten Morgenthau-Plan gefunden, der aber selbst in den USA für unrealistisch gehalten wurde und auf beträchtlichen Widerspruch stieß. Doch ftir alle Gruppierungen der herrschenden Kreise der Westalliierten schien das künftige Deutschland nur als Bestandteil der kapitalistischen Weltwirtschaft denkbar; eine Linksentwicklung sollte mit allen Mitteln verhindert werden. So wirkten neben den die Zusammenarbeit mit der Sowjetunion erfordernden auch entgegengesetzte Tendenzen in der amerikanischen, britischen und französischen Deutschlandpolitik.
Darüber hinaus gab es einflußreiche Kräfte – besonders im Big Business der USA, aber auch Großbri tanniens -, die ihre traditionellen Geschäftsverbindungen mit dem deutschen Monopolkapital unter nun für das amerikanische und das britische Kapital günstigeren Bedingungen erneuem wollten. Sie betonten die Rolle der deutschen Wirtschaft Iür den Wiederaufbau und das Florieren der kapitalistischen Weltwirt -. schaft und betrachteten Deutschland als Feld ihrer Kapitalexpansion. Deshalb plädierten sie ftir eine „milde Behandlung” des Besiegten, warnten sie vor allzu weitgehenden ,,Eingriffen“ im Zuge der Entnazifizierung, Bestrafung oder gar Enteignung großkapitalistischer Nazi- und Kriegsverbrecher. Oft verbanden sich diese Ambitionen mit den Vorstößen aggressiv-antisowjetischer Gruppierungen, die einen Interessenausgleich mit der UdSSR prinzipiell ablehnten und auf die Wiedererrichtung eines antisowjetischen und antikommunistischen Bollwerks auf deutschem Boden hinarbeiteten.

Hatten Kriegsvedauf und Kriegsausgang diese gefährliche politische Strömung zunächst in Schranken gehalten, so trat sie nach dem Tode Präsident Roosevelts offener hervor. Der bis Juli 1945 amtierende britische Premier Winston S. Churchill machte sich zum Wortführer derartiger Bestrebungen, und auch der neue amerikanische Präsident Harry S. Truman begann jenen Kreisen zu folgen, die gegenüber der Sowjetunion einen „harten Kurs” verlangten. Dies belastete die Zusammenarbeit aller Hauptmächte der Antihitterkoalition, verdüsterte die Aussichten dieses Bündnisses und beeinträchtigte auch das gemeinsame Vorgehen in der deutschen Frage.
All das bedeutete jedoch zunächst noch keinen generellen Kurswechsel. Am Beginn der Nachkriegsentwicklung dominierten der erklärte Wille zur Zusammenarbeit zwischen den Hauptmächten der Anti-Hitler-Koalition und deren vielgestaltige Praxis, auch bei der Organisierung der Viermächteverwaltung Deutschlands.
Materielle und geistige Ausgangsbedingungen für den demokratischen Neuaufbau
Die Faschisten hatten dem deutschen Volk ein schlimmes Erbe hinterlassen. Die Deutschen durchlebten die schwerste Katastrophe ihrer Geschichte seit dem Dreißigiährigen Krieg. Was dem zeitgenössischen Beobachter als erstes ins Auge fiel, das waren die ausgebrannten oder zerschossenen Wohnhäuser, Kulturstätten, Industrieanlagen und Verkehrseinrichtungen. Diese materiellen Schäden, hervorgerufen durch Luftangriffe, durch direkte Kampfhandlungen und durch die sogenannte Taktik der verbrannten Erde betrugen etwa 195 Milliarden Mark. Das entsprach dem Dreifachen des deutschen Nationaleinkommens im Jahre 1936. Diese Schäden zu beheben und zugleich den berechtigten Wiedergutmachungsansprüchen der überfallenen Völker Rechnung zu tragen war nur in jahrelangen Anstrengungen möglich.
Die der faschistischen Kriegspolitik geschuldeten Verluste verteilten sich indes territorial sehr unterschiedlich, betrafen Produktionskapazitäten, Verkehrsverbindungen und Wohnraum mit sehr differenzierten Wirkungen und Nachwirkungen. Neben arg zerstörten Städten und verwüsteten Dörfern gab es auch viele Orte, die äußerlich den Eindruck erweckten, als sei an ihnen der Krieg vorbeigegangen. Der von den USA und Großbritannien geführte Luftkrieg hatte vor allem im letzten Kriegsjahr zur Zerstörung von Industrieanlagen und zur völligen Vernichtung von Stadtkernen geführt. In den Großstädten betrug die Zerstörung im Durchschnitt 50 Prozent. Berlin, Dessau, Dresden, Düsseldorf, Halberstadt, Hamburg, Köln, Magdeburg, Nordhausen, Rostock und andere Städte glichen Trümmerwüsten.

Von den Zerstörungen durch Bodenkämpfe war neben Berlin die Mark Brandenburg am härtesten betroffen. Während sich die faschistische Wehrmacht den vorrückenden amerikanischen und britischen Truppen kaum noch mit größeren militärischen Operationen entgegenstellte, hatte sie mit allen verfügbaren Kräften versucht, das zur Behauptung Bedins geschaffene tiefgestaffelte Verteidigungssystem zu halten. So waren Berlin und seine Umgebung zum Schauplatz einer der größten Schlachten des zweiten Weltkrieges mit verheerenden Zerstörungen geworden.
Auch die faschistische Taktik der verbrannten Erde hatte ihre schlimmsten Auswirkungen in den ostdeutschen Gebieten gezeitigt. Ein großer Teil des rollenden Materials war nach Westen verbracht worden. Hunderte gesprengter oder durch Kampfhandlungen zerstörter Brücken blockierten die Eisenbahnverbindungen, das Straßennetz und die Wasserwege. Auch die ohnehin arg vernachlässigte Landwirtschaft war schwer in Mitleidenschaft gezogen worden. Es gab Dörfer, in denen man vergebens nach einem Schwein, einem Rind oder gar einem Pferd suchte. Es fehlte an Pflanzgut, Traktoren und Treibstoff. Viele Felder waren von Bomben- und Granattrichtern durchfurcht, von Schützengräben durchzogen, mit Munition und Blindgängern übersät oder vermint.
Aber selbst in Gebieten, die von direkten Kriegsschäden verschont geblieben waren, gab es oft keine Voraussetzungen Iür die Fortlührung oder Wiederaufnahme der Produktion. Die auf den totalen Krieg ausgerichtete, in ihren Produktionsprofilen völlig deformierte Wirtschaft mußte erst auf Friedensproduktion umgestellt werden. Nicht selten fehlte es an Rohstoffen, meist an Zulieferungen, vor allem aber an Brennstoffen und Elektroenergie. Selbst die Wasserversorgung war vielerorts nicht gewährleistet.
Auch viele Stätten wissenschaftlicher Lehre und Forschung, Theater und Museen, Schlösser und Kirchen lagen in Schutt und Asche. So manches Meisterwerk der bildenden Kunst, das zum Kulturbesitz des deutschen Volkes und der ganzen Menschheit gehörte, war unwiederbringlich in den Flammen des Krieges verlorengegangen. Selbst die elementaren Voraussetzungen für die Wiederaufnahme des Schulbetriebes mußten neu geschaffen werden.
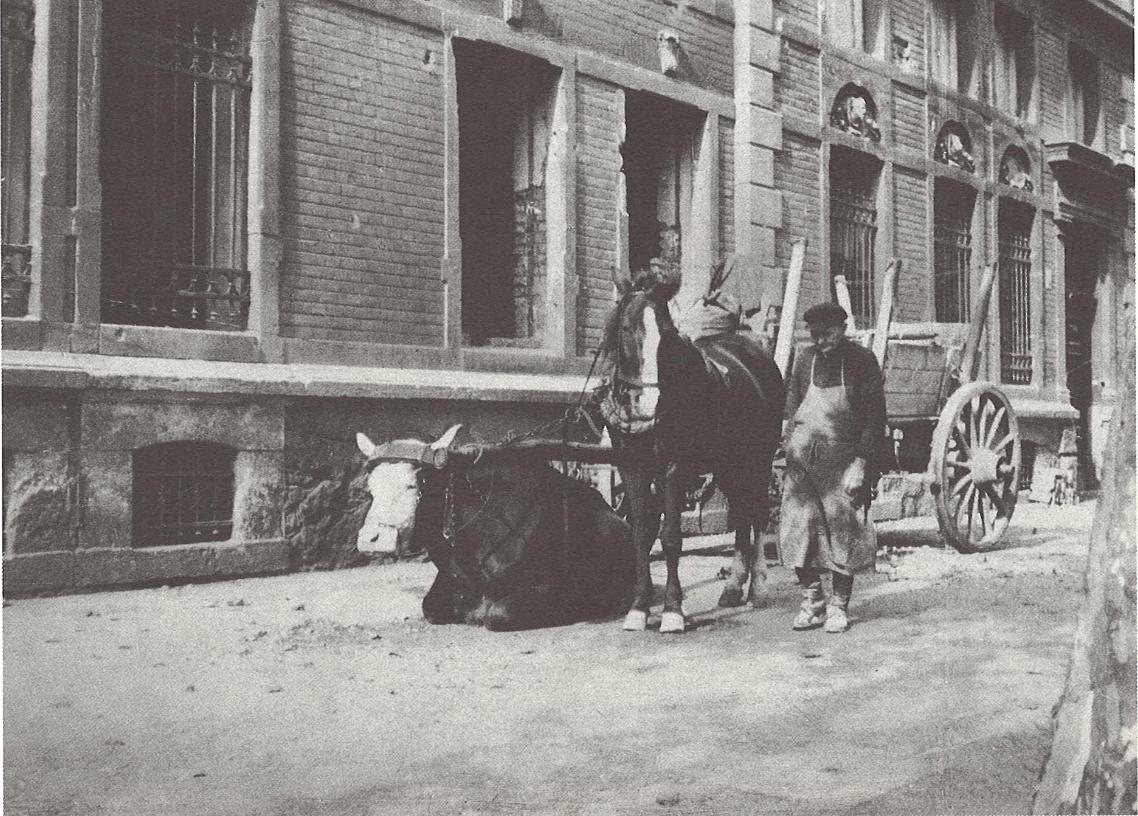
Viele Deutsche – noch vor wenigen Jahren berauscht von den faschistischen Siegesmeldungen und nun mit den bitteren Folgen der Aggressionspolitik und der Barbarei des Faschismus konfrontiert – standen diesem Ausmaß an Zerstörungen, an Not und Elend, dem Verlust naher Angehöriger, dem Leben unter Besatzungsbedingungen wie gelähmt gegenüber. Es war eingetreten, was eintreten mußte, als man die Faschisten gewähren ließ – das, wovor deutsche Kommunisten und andere Antifaschisten von Anfang an gewarnt hatten und was zumindest im letzten Kriegsjahr jeder Denkende hatte voraussehen können.
Der offenkundige Bankrott der Politik Hitlers und seiner Kumpanei hatte den Faschismus in den Augen vieler Deutscher diskreditiert. Ihnen wurde qualvoll bewußt, daß das deutsche Volk in seiner Mehrheit einen Irrweg beschritten hatte. Die meisten haßten den Krieg, den sie schließlich in all seinen Schrecknissen selbst durchlebt hatten. Doch noch war es eine Minderheit, die aus all dem richtige Schlußfolgerungen zog und sich der Aufgabe zuwandte, ohne Zögern mit dem Aufbau eines neuen Lebens zu beginnen. Denn nicht nur die Schwernisse ihrer materiellen Lage lasteten auf der Bevölkerung, mehr noch hinderten sie nach wie vor Trugbilder der faschistischen Propaganda und ein über Jahrzehnte durch die imperialistische Ideologie verfestigtes falsches Weltbild daran, das Richtige und Notwendige zu tun. Die Pseudotheorien von der Überlegenheit der „germanischen“, „nordischen” oder „arischen Rasse“ wurzelten tief. Antisowjetismus, Antikommunismus und -Antisemitismus hatten daran angeknüpft, und nationalistische Überheblichkeit war bis zur Perversion getrieben worden, bis zur Rechtfertigung des Völkermords. Der Propaganda vom mangelnden Lebensraum, vom ,,Kampf ums Dasein“ als Triebkraft nationaler Geschichte waren viele edegen. Sie hatten den Phrasen von der „Volksgemeinschaft“, der Parole „Ein Volk – ein Reich – ein Führer“ Glauben geschenkt – zumindest solange Hitler und seinen Hintermännern alles zu gelingen schien. Nun griff bei den meisten das Gefühl um sich, betrogen worden zu sein. Doch damit waren die vielen Lehren und Vorurteile, die sie über Jahre hinweg in sich aufgenommen hatten, nicht einfach ausgeräumt, war die Unkenntnis der wirklichen Zusammenhänge nicht beseitigt.

Fronttruppen kamen und gingen, niemand und nichts schien zur Ruhe zu kommen. Einheiten der Besatzungstruppen rückten ein. Sie forderten Quartiere; es wurde requiriert. Die aus menschenunwürdigen Verhältnissen befreiten ehemaligen Kriegsgefangenen und Zwangsarbeiter waren nicht bereit, weiter dahin- zuvegetieren. So mancher hielt sich schadlos, ohne nach Eigentümern und Besitzern zu fragen. Auch Besatzungssoldaten gingen auf Beute in Feindesland aus. Frauen wurden vergewaltigt. Die deutsche Bevölkerung, die im Moment des Zusammenbruchs der örtlichen Gewalten des Naziregimes und angesichts der fliehenden demoralisierten deutschen Truppen selbst Versorgungslager, Warenhäuser und Läden geplündert hatte, empfand jeden Griff nach ihrem Eigentum als schreiendes Unrecht, und nur die wenigsten wußten die TVirrnisse der Zeit in den Zusammenhang von Ursache und Wirkung einzuordnen. Abgeschnitten von zuverlässigen Informationen, nahmen die meisten die unsinnigsten Gerüchte auf und trugen sie weiter.
Bei allen Unterschieden in ihrem Vorgehen waren die Besatzungsorgane der alliierten Mächte bestrebt, das Land zu befrieden. Sie trafen Vorkehrungen, um eine elementare Ordnung zu gewährleisten, und ergriffen Maßnahmen gegen Seuchen, Verwahrlosung und allgemeinen Verfall, die für ein Übedeben der deutschen Bevölkerung unedäßlich waren und auch im Interesse der Besatzungsarmeen lagen. Im Zentrum ihrer Aktivitäten stand zunächst die Durchftihrung der Bestimmungen der Kapitulationsurkunde. Sie entwaffneten die Verbände der Wehrmacht und der Waffen-SS und nahmen Soldaten und Offiziere gefangen. Sie übertrugen Militärbehörden und Kommandanturen die militärischen wie die zivilen Angelegenheiten. Diese ordneten Ausgangssperren an. Aktive Nazis und ehemalige Offiziere hatten sich registrieren zu lassen. Faschistischer Verbrechen verdächtige oder die Waffenruhe gefährdende Personen wurden in Internierungslager gebracht.

Bald überwanden viele Deutsche den durch die militärische Zerschlagung des Deutschen Reiches ausgelösten Schock und begannen, sich auf die neue Situation einzustellen. Doch blieben sie zunächst noch ohne feste geistige Orientierung, ohne Vorstellung von der Zukunft. Gleichwohl war auch diese verunsicherte Mehrheit des deutschen Volkes von einer tiefen Sehnsucht nach Frieden erfüllt. In ihr glimmte die Hoffnung, sich aus dem beispiellosen Tiefstand wieder emporzuarbeiten, wenn auch die Gedanken vieler zunächst um das bloße Überleben kreisten, um das Stück Brot zum Sattwerden, um ein Dach über dem Kopf. Die Erschütterung über das Erlebte und die Betroffenheit über das, was nach und nach über das ganze Ausmaß der faschistischen Verbrechen bekannt wurde, war bei vielen Deutschen echt und tief. Aus dieser Betroffenheit erwuchs die Bereitschaft zum Umdenken, die Bereitschaft, neue Ideen in sich aufzunehmen.
Das war der Punkt, an dem die deutschen Antifaschisten ansetzen konnten. Vor allem aber war es die Kraft ihres Beispiels, die viele mitriß. Wo sie sich frei entfalten durften und die Unterstützung der Besatzungsorgane genossen, gelang es ihnen sehr bald, die Lethargie zu besiegen, aufgeschlossene Werktätige um sich zu scharen und zu aktivieren.
Klassensituation und Bündnismöglichkeiten
War durch die Schuld des faschistischen deutschen Imperialismus das Nationalvermögen empfindlich geschmälert worden, so beklagten viele Deutsche auch große Verluste an persönlichem Eigentum. Von 100 Personen hatten 40 ihr ganzes Hab und Gut verloren, 25 einen Teil davon eingebüßt. Doch waren damit keineswegs alle zu einer „Gemeinschaft von Besitzlosen“ zusammengeschmolzen – wie es manche Zeitgenossen empfanden und einige bürgerliche Historiker bis heute behaupten. Wenn viele in Not und Elend lebten, wenn Bombardierungen und Umsiedlungen nicht nur Arme, sondern auch Begüterte getroffen hatten, so waren doch damit die sozialen Unterschiede und Gegensätze der Gesellschaft nicht aufgehoben.
Weder der Krieg noch die alliierten Vereinbarungen über Deutschland hatten die grundlegenden Eigentumsverhältnisse geändert. Deshalb bestanden auch die alten Klassenverhältnisse fort, unabhängig davon, daß manche Leute ihren Besitzstand und ihren sozialen Boden verloren hatten. Mit Aufrüstung und Krieg war der Prozeß der sozialen Polarisierung in der Gesellschaft sogar weiter vorangeschritten. Konnte das deutsche Großkapital nach seiner Kriegsniederlage auch nicht wie bisher schalten und walten, vor allem sich nicht der politischen Macht wie gewohnt bedienen, so hielt es doch nach wie vor viele Fäden der Wirtschaft in der Hand. Es verfügte über große potentielle Möglichkeiten, seine Besitzverhältnisse erneut zu ordnen und die alten Machtverhältnisse zu restaurieren, falls ihm die Kommandohöhen in Wirtschaft und Gesellschaft nicht entrissen wurden. Der Kapitalismus war keineswegs tot – wie manche nichtmarxistische Politiker damals meinten -; das Kapital befand sich lediglich in einer Krise, die es mit Unterstützung der imperialistischen Besatzungsmächte so rasch wie möglich zu überwinden hoffte.
Dies zu erkennen erforderte jedoch einen durch die marxistische Gesellschaftslehre geschärften Blick. Denn die in den Eigentumsverhältnissen begründeten Klassenstrukturen waren übedagert von den sozialen Wirkungen der Zeitumstände, die sich in verschiedenen Klassen und Schichten zeigten. War das Volk in Klassen gespalten, so traten doch zunächst unübersehbar auch andere Differenzierungen hervor. Ein wesentlicher Gradmesser war die Stellung zum und im nazistischen System. Daran gemessen, standen sich aktive Nazis, Mitläufer, Indifferente und Antifaschisten gegenüber. Unterschiedlich war die Bevölkerung von Bombardierungen, Kriegshandlungen, Besatzungsfolgen und Umsiedlungen betroffen. Vor allem Umgesiedelte und Ausgebombte bildeten große Bevölkerungsgruppen, die sich aus nahezu allen sozialen Schichten rekrutierten. Durch ein gemeinsames Schicksal verbunden, bewiesen sie oft Gruppensolidarität. Auch die Kriegsgefangenen, vor allem jene, die mehrere Jahre fern der Heimat in Gefangenschaft zu verbringen hatten, bildeten eine besondere Gruppe, die sich auch noch nach Entlassung und Heimkehr von ihrem sozialen Umfeld abhob.
Hinter diesen die Klassen überlagernden vordergründigen Gliederungen der Gesellschaft wirkte aber die historisch gewachsene, ökonomisch determinierte Klassenteilung, die unterschiedliche, ja gegensätzliche soziale und politische Interessen hervorbrachte. Diese vor allem mußte eine erfolgversprechende Politik des antifaschistisch-demokratischen Neuaufbaus in Rechnung stellen und ins Bewußtsein der öffentlichkeit rücken, wenngleich tradiertes reaktionäres und konservatives Gedankengut und die Stimmungen einer verunsicherten Bevölkerungsmehrheit dies zu einer überaus schwierigen Aufgabe machten. Nur so ließ sich die Frage beantworten, wem die Rolle des Hegemons im Ringen um antifaschistische Demokratie zukam, wer als Verbündeter im revolutionären Umwälzungsprozeß zu gewinnen war und gegen wen sich der Hauptstoß in der Auseinandersetzung zwischen Fortschritt und Reaktion zu richten hatte.
Stärkste und führende Kraft einer breiten antifaschistischen Front zur Erringung wahrhaft demokratischer und sozial fortschrittlicher Verhältnisse konnte nur die Arbeiterklasse sein, deren Kern die Industriearbeiterschaft stellte. Die Arbeiterklasse verkörperte schon rein zahlenmäßig den bedeutendsten Teil der Gesellschaft. Rund 56 Prozent der berufstätigen Bevölkerung waren Arbeiter. Rechnet man den größten Teil der Angestellten zur Arbeiterklasse, so umfaßte diese über zwei Drittel der Bevölkerung. Ihr Wachstum hatte sich auch in der Zeit des Faschismus fortgesetzt, obwohl Millionen Werktätige in das Aggressionsheer gepreßt worden waren. Während des Krieges waren zahlreiche zu einer Tätigkeit in der materiellen Produktion dienstverpflichtete Angehörige des Kleinbürgertums in die Arbeiterklasse eingeströmt.
Auch in den ersten Nachkriegsjahren hielten Umschichtungsprozesse an, die das Profil und die Zusammensetzung der Arbeiterklasse nachhaltig beeinflußten. Die nur allmählich und ungleichmäßig vor sich gehende Wiederbelebung der Wirtschaft, die Umstellung der Industrie auf Friedensproduktion, die ErIüllung der Wiedergutmachungsverpflichtungen, die sich aus der Zoneneinteilung ergebende Unterbrechung wirtschaftlicher Verbindungen wirkten auf die Klasse ein, änderten deren berufliche Zusammensetzung, Qualifikationsstruktur und territoriale Streuung. Da sich zunächst ein beträchtlicher Teil der jüngeren männlichen Arbeiterbevölkerung in Kriegsgefangenschaft befand, fehlten viele Facharbeiter. Erneut setzte ein großer Schub der industriellen Frauenarbeit ein. Für viele Frauen, die alleiniger Ernährer ihrer Familie geworden waren, wurde die Berufsarbeit aus einer zeitweisen zu einer dauernden Erwerbstätigkeit. Lehrer, Beamte und Angestellte, die wegen ihrer nazistischen Vergangenheit aus ihren Positionen entfernt werden mußten, nahmen – wenn auch oft nur vorübergehend – eine Tätigkeit in der materiellen Produktion auf. Flüchtlinge und Umsiedler, die früher häufig in der Landwirtschaft gearbeitet hatten, suchten in der Industrie und in der Bauwirtschaft eine neue Beschäftigung. Mehr noch aber gelangten umgesiedelte Industriearbeiter aufs Land, wo sich bessere Möglichkeiten der Unterbringung und Versorgung boten. Hunger und Mangel an allem Lebensnotwendigen, die Stillegung von Betrieben oder Betriebsabteilungen ließen auch alteingesessene Arbeiter und Angestellte in die Landwirtschaft und ins Handwerk abwandern. Deshalb war das rasche Ankurbeln der Produktion auch eine wichtige Voraussetzung, um einer Deklassierung der Arbeiter entgegenzuwirken und die politische Potenz der Werktätigen der Großbetriebe zu nutzen.
In der wechselvollen jüngeren deutschen Geschichte hatte sich die Arbeiterklasse als entschiedenster Verfechter des politischen und sozialen Fortschritts erwiesen. Zu det 1945 lebenden Generationen von Arbeitern und Angestellten gehörten jene Antimilitaristen, die sich schon vor dem ersten Weltkrieg den imperialistischen Kriegsvorbereitungen entgegengestemmt hatten, die Kriegsgegner des ersten Weltkrieges, die Kämpfer der Novembenevolution, die Verteidiger der Republik gegen die Kapp-Putschisten, die Streiter gegen die drohende faschistische Gefahr. Die Mehrzahl der antifaschistischen Widerstandskämpfer entstammte der Arbeiterklasse. Aus ihren Reihen kamen die meisten Aktivisten der ersten Stunde.
Mit ihren bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts zurückreichenden Emanzipationsbestrebungen hatte die Arbeiterklasse ihre eigene politische, gewerkschaftliche und kulturelle Bewegung hervorgebracht und dieser feste organisatorische Formen gegeben. Ihr solidarisches Handeln, ihre sozialistischen ldeale, ihre politischen Aktivitäten, ihre proletarischen Lebensformen, ihre eigene Geselligkeit und ihre künstlerischen Äußerungen verkörperten die zweite Kultur in der bürgerlichen Gesellschaft. All dies hatten die faschi-tischen Machthaber zwar verboten und verfolgt, nicht aber historisch rückgäirgie und gänzlich zunichte machen können. Mit der Mobilisierung dieser Potenzen der fortgeschrittensten Klasse, mit dem Rückgriff auf ihre reichen Traditionen und Erfahrungen erschlossen sich große Möglichkeiten, das gesamte deutsche Volk auf einen neuen Weg zu führen.
Die Arbeiterklasse war ihrer objektiven, von Karl Marx und Friedrich Engels mit wissenschaftlicher Beweiskraft aufgedeckten Rolle nach berufen, Vorkämpfer einer neuen Gesellschaftsordnung zu sein. Die organisierte Arbeiterbewegung hatte den eigentlichen Gegenpol zum Faschismus in Deutschland selbst gebildet und war somit auch führende und treibende Kraft einer antifaschistisch-demokratischen Erneuerung. Die besten Vertreter der Arbeiterklasse hatten das Banner dieses Kampfes längst erhoben und es auch in schwierigsten Situationen unter Einsatz ihres Lebens hochgehalten. Nur die Arbeiterklasse verfligte über eine mit der wissenschaftlichen Theorie ausgerüstete Vorhut, über eine marxistisch-leninistische Partei. Die Erfahrungen, die die Arbeiter als Klasse gewonnen hatten, bildeten die Grundlage der politischen Strategie dieser Partei.
Doch waren auch die Verluste, die der antifaschistische Kampf gefordert hatte, unter den klassenbewußten, politisch organisierten Arbeitern am höchsten. Viele der erfahrensten Funktionäre der Arbeiterbewegung hatten die Ideale des Sozialismus, der Demokratie, des Friedens und der nationalen Befreiung unter Aufopferung ihres Lebens verteidigt. Zwölf Jahre lang hatte es keine legalen Möglichkeiten gegeben, die Klasse aufzuklären und zum Kampf zu formieren. Statt dessen waren die Werktätigen nicht nur dem Terror, sondern auch der politischen Propaganda und der sozialen Demagogie der Nazis ausgesetzt gewesen. Vor allem die junge Arbeitergeneration war in den faschistischen Zwangsorganisationen gedrillt und mit chauvinistischen, antisowjetischen, antikommunistischen und antisemitischen Parolen geistig verseucht worden. Ehe sie noch das Arbeiterleben wirklich kennengelernt hatte, wurde sie in die Uniform gesteckt, um für die Eroberungsziele des deutschen Monopolkapitals fremde Länder zu überfallen und zu unterjochen. Von der tiefen Depression, die 1945 die meisten Deutschen ergriffen hatte, waren auch viele Arbeiter und Angestellte erfaßt.
Nächst der Arbeiterklasse war die werktätige Bauernschaft die wichtigste produzierende Klasse. Sie stellte die stärkste soziale Kraft auf dem Lande dar. Von vier Bauern bewirtschafteten drei weniger als 10 Hektar. Vor allem diese bäuedichen Betriebe hatten unter der faschistischen Agrarpolitik und den Kriegseinwirkungen sehr gelitten. Auf ihnen lastete der Druck der Großgrundbesitzer und der Banken, bei denen sie größtenteils verschuldet waren. Standen die werktätigen Bauern als hart arbeitende Landwirte der Arbeiterklasse nahe, so waren sie andererseits Eigentümer von Produktionsmitteln, und als Produzenten von Lebensmitteln erschlossen sich ihnen in den Jahren des Hungers viele Gelegenheiten zur Spekulation und verlockende Quellen der Bereicherung.
Ihre Gegenwarts- und Zukunftsinteressen geboten den werktätigen Bauern, sich an die Seite der Arbeiterklasse zu stellen. Nur die Arbeiterklasse konnte die Bauern aus dem Griff der Monopole und des Großgrundbesitzes befreien. Nur im Bündnis mit der Arbeiterklasse konnten sich die Hoffnungen werktätiger Bauern auf eine demokratische Reform der Agrarverhältnisse erfüllen, konnten sie das von den Junkern in Jahrhunderten geraubte Bauernland zurückgewinnen. Doch waren von den werktätigen Bauern viele den faschistischen Parolen gefolgt, hatten viele den gegen die revolutionäre Arbeiterbewegung erhobenen Verleumdungen Glauben geschenkt. So standen die meisten Mittelbauern und auch nicht wenige Kleinbauern den Zielen der Arbeiterbewegung ablehnend oder doch abwartend gegenüber.

Eine ähnliche Stellung wie die werktätigen Bauern nahmen auch die kleinbürgerlichen Schichten ein, die vor allem in den Städten angesiedelten Handwerker, Gewerbetreibenden und Kleinhändler. Auch sie führten als selbständig Tätige einen ständigen Kampf um die Erhaltung ihrer sozialen Existenz, aber so mancher träumte davon, in die Kapitalistenklasse aufzusteigen. Die Militarisierung der Wirtschaft, die rigorosen Maßnahmen der totalen Kriegführung hatten viele Handwerker, Gewerbetreibende und Kleinhändler an den Rand der Ruins geführt. Hinwieder bot sich jetzt flir diese Schicht die Möglichkeit, aus ihrer Stellung in der Warenzirkulation, ihrer Rolle bei der Versorgung der Bevölkerung mit Reparatur- und Dienstleistungen auf spekulative Weise Nutzen zu ziehen. Da die Geldentwertung naturalwirtschaftliche Beziehungen wiederaufleben ließ, befanden sich die kleinbürgelichen Schichten meist in einer günstigeren Situation als die Betriebsarbeiter und die Angestellten.
Eine Minderheit des Kleinbürgertums hatte sich bereits mit den Arbeitern solidarisiert; schon seit dem Entstehen der Arbeiterbewegung waren Vertreter dieser Schicht in Arbeiterorganisationen tätig. In seiner Masse aber war das Kleinbürgertum den herschenden reaktionären Gewalten gefolgt. Viele dieser Schicht entstammende Männer, Frauen und Jugendliche hatten Funktionen in der faschistischen Bewegung übernommen. Besonders in Krisenzeiten in ihrer materiellen Existenz gefährdet, waren sie sehr anfüllig für die Propaganda nationalistischer Demagogen. Nun aber lagen die schlimmen Folgen der Hitlerherrschaft offen zutage. Die Unvereinbarkeit der imperialistischen Politik mit den eigenen Lebensinteressen hatten Handwerker, Gewerbetreibende und Kleinhändler unmittelbar zu spüren bekommen. Damit waren reale Ansatzpunkte gegeben, um die Mehrheit des Kleinbürgertums in das Ringen um antifaschistisch-demokratische Verhältnisse einzubeziehen.
Eine sozial sehr uneinheitliche Schicht war die Intelligenz. In verschiedenartigen wissenschaftlichen, technischen, medizinischen, pädagogischen und künstlerischen Berufen tätig, teils freischaffend, teils in den Konzemen angestellt, teils im Beamtenstand, unterschieden sich ihre Vertreter nach Einkommen und sozialem Ansehen erheblich. Die Intelligenz rekrutierte sich aus verschiedenen Schichten der Gesellschaft. Hatten einige wenige Anschluß an die Bourgeoisie gefunden, so waren doch die Mehrzahl der Intellektuellen auf eine Erwerbstätigkeit angewiesen. Auch in ihrer politischen Haltung war die Intelligenz in sich sehr differenziert. Es gab hervorragende Intellektuelle, die in den Reihen der Arbeiterbewegung oder an deren Seite kämpften. Gerade von den angesehensten Schriftstellern und Künstlern hatten sich die meisten den Nazis widersetzt, hatten deren Verlockungen widerstanden und waren lieber außer Landes gegangen, als sich vor den Karren des faschistischen Propagandaapparates spannen zu lassen. Intellektuelle, die sich von den Faschisten nicht mißbrauchen lassen wollten, aber in Deutschland geblieben waren, hatten Standhaftigkeit bewiesen, und so mancher beteiligte sich aktiv am antifaschistischen Widerstand. Nicht wenige suchten sich persönlich von den Nazis fernzuhalten und die Position von unpolitischen Fachleuten oder Künstlern zu beziehen, doch war ihnen das nur selten gelungen.
Die Intelligenz, die in der Vergangenheit viel dazu beigetragen hatte, dem deutschen Namen internationales Ansehen zu verschaffen, hatte sich gleichwohl in ihrer Mehrheit für die faschistische Kriegs- und Eroberungspolitik mißbrauchen lassen. Viele Wissenschaftler hatten die Argumente ftir die nazistischen Pseudotheorien geliefert und sie mitunter wider besseres Wissen verbreitet. Erfinder, Ingenieure und Techniker hatten Adolf Hitler zu seiner schlagkräftigen Militärmaschinerie verholfen. Nicht wenige Künstler, Schriftsteller und Journalisten hatten sich durchaus bereitwillig als Propagandisten des Antikommunismus, Antisowjetismus und Antisemitismus betätigt. Sie hatten den Führerkult und die schwülstige „Blut-und-Boden“-Mythologie in die Massen getragen, den Krieg verherrlicht oder mit trivialen Werken von den Verbrechen der Nazis und den Gefahren für das Volk abgelenkt.
Um so mehr stieg die Verantwortung jener Vertreter deutscher Kultur und Wissenschaft, die auch in der Zeit der braunen Tyrannei ihren humanistischen Idealen treu geblieben waren, die das Ethos der Wissenschaft gewahrt hatten. Sie waren berufen, das große kulturelle und wissenschaftliche Erbe des deutschen Volkes in die neue Zeit zu tragen, auf dem Boden der Kultudeistungen des fortschrittlichen und antifaschistischen Deutschlands eine geistige Neugeburt des deutschen Volkes einzuleiten. Dies war ein Ziel, für das sich auch jene Intellektuellen gewinnen ließen, die nach der Zerschlagung des Faschismus ernüchtert einen neuen lffeg suchten.
Zunächst befand sich jedoch die Mehrheit der Intelligenz in einer geistigen Krise, weil sie das Geschehene weder wissenschaftlich noch emotional zu begreifen und damit – was die Schriftsteller und Künstler anbelangt – auch nicht ästhetisch zu verarbeiten vermochten. Nicht wenige Wissenschaftler, Journalisten, Pädagogen und Künstler hatten aus den verschiedensten Gründen ihre berufliche Existenz verloren oder sahen diese bedroht, was sie noch mehr verunsicherte. Aus dieser mißlichen Lage konnten die nichtfaschistischen Intellektuellen am ehesten herausfinden, wenn sie sich in die von den Arbeiterparteien und Gewerkschaften ausgehende Bewegung zur kulturellen Erneuerung im Geiste antifaschistischer Demokratie einreihten.
Näherten sich die Angestellten mit niederem Einkommen in ihrer objektiven Lage und teilweise auch in ihrem Selbstverständnis zunehmend der Arbeiterklasse an, so hoben sich von ihnen immer klarer das Management, die höhere Beamtenschaft und in Parallele hierzu das höhere Offizierskorps und die nazistischen Bonzen ab. Das wirtschaftliche Management hatte die Rüstung und die Ausplünderung fremder Länder und Völker wie die Ausbeutung des eigenen Volkes auf Hochtouren gebracht. Ohne die Ergebenheit der Beamten hätte das nazistische Regime niemals bis fünf nach zwölf funktionieren können. Fast alle Staatsanwälte und die meisten Richter hatten sich mitschuldig gemacht an der Verfolgung von Antifaschisten und Juden, an der Willkür einer zum Werkzeug der Nazis herabgewürdigten Justiz. Ohne den militaristischen Geist, ohne den sinnentfremdeten Ehrbegriff und die Landsknechtsmentalität der Mehrheit des deutschen Offizierskorps wäre der faschistische Raub- und Ausrottungskrieg nicht führbar gewesen. Und all diese schlimmen Zige der wichtigsten Diener des Hitleregimes traten potenziert in der Nazibürokratie und im Führerkorps der NSDAP und ihrer Gliederungen hervor.
Es waren Ausnahmeerscheinungen, wenn in diesen Schichten Widerstand gegen Hitler geleistet wurde, und höchst selten hatten Vertreter der Beamtenschaft, Wirtschaftsführer oder höhere Offiziere den Nazis die Gefolgschaft verweigert. Diese Schichten und „Herrschaftseliten” durften als soziale Gruppen so nicht fortexistieren, sollte ein wahrhaft demokratisches Deutschland erstehen.
Selbst an der Kapitalistenklasse waren Faschismus und Krieg nicht spurlos vorübergegangen. Monopolkapital und Großagrarier auf der einen, nichtmonopolistische Unternehmer und kapitalistisch wirtschaftende Bauern auf der anderen Seite hoben sich nun noch deutlicher voneinander ab. Eigentlich profitiert an der nazistischen Herrschaft hatten die großen Industrie- und Bankkonzerne, die gemeinsam mit dem militaristischen Großgrundbesitz den faschistischen Diktator eben zu diesem Zweck in den Sattel gehoben hatten. Wenn auch mancher mittlere und kleinere Kapitalist am Rüstungsgeschäft, an der Ausplünderung anderer Länder und der Ausbeutung von Kriegsgefangenen und Zwangsarbeitern partizipiert hatte, so existierte doch keine Gleichheit zwischen den Interessen des Monopolkapitals und denen der kleineren bzw. mittleren Unternehmer oder der kapitalistisch wirtschaftenden Großbauern. Diese hatten vielmehr größtenteils die Vernachlässigung der Konsumgüterproduktion und der Landwirtschaft, den Abzug von Arbeitskräften, den Entzug von Material, Rohstoffen und Energie zu spüren bekommen.
Aus all dem ergab sich die Möglichkeit, die nicht-monopolistische Bourgeoisie in Stadt und Land politisch von den monopolistischen Kräften zu trennen, sie für die Unterstützung demokratischer Reformen zu gewinnen oder sie zumindest zu neutralisieren. Auch manche Vertreter der Kapitalistenklasse und des Adels hatten sich in elitärem Selbstverständnis von den Nazis ferngehalten. Vaterlandsgefühl, preußisch-konservative oder liberale Gesinnung wie auch christlicher Glaube gaben den besten Männern und Frauen dieser Schichten die Kraft zum aktiven Widerstand gegen Hitler.
Die neue Klassenkampfsituation erinnerte in manchem an jenen Gesellschaftszustand, den W. I. Lenin als revolutionäre Situation oder revolutionäre Krise bezeichnet hatte, in dem „die unteren Schichten nicht wie früher leben wollen …, die oberen Schichten nicht rvie früher wirtschaften und regieren können“.10 Die Staatsordnung war in ihren Grundfesten erschüttert, und die Not der Massen hatte sich in höchstem Grade verschärft. Allerdings war aus all dem noch nicht jene „außergewöhnliche Aktivität“11 der Massen erwachsen, in der sich nach Lenin das volle Ausreifen des subjektiven Faktors einer revolutionären Situation ausdrückt. Zudem wurde das politische Kräftemessen in Deutschland durch das Besatzungsregime und das Fehlen der nationalen Souveränität modifiziert. Für politisches Handeln der Deutschen hatten die Alliierten unumstößliche Bedingungen gesetzt. Somit waren die Voraussetzungen für eine Entfaltung der revolutionären Situation keineswegs in allen Teilen Deutschlands gleichermaßen gegeben.
Am günstigsten gestalteten sie sich dort, wo die Sowjetunion Besatzungsfunktionen ausübte. Denn in ihrem Besatzungsbereich wurde die Verwirklichung der alliierten Vereinbarungen zur Entfaschisierung, Entmilitarisierung und Demokratisierung energisch in Angriff genommen. Hier entstand ein politisches Klima, in dem sich die Kräfte für antifaschistisch-demokratische Umgestaltungen rasch und erfolgreich formieren konnten. Hier fand der anfangs bestehende Widerspruch zwischen den insgesamt günstigen objektiven Bedingungen für eine revolutionäre Umwälzung und der zunächst unentwickelten politischen Bewußtheit und Organisiertheit der Werktätigen bald seine Lösung. Er löste sich vor allem in der Praxis dank des Vorhandenseins einer marxistisch-leninistischen Vorhut und indem Kommunisten, Sozialdemokraten und andere Antifaschisten die neuen, demokratischen Verwaltungen in ihre Hand nahmen, mit der Verwirklichung konsequent antifaschistisch-demokratischer Maßnahmen begannen und dabei immer mehr Werktätige aktivierten und in den Arbeiterparteien, in Gewerkschaften, in Jugend- und Frauenausschüssen organisierten.
Die Krise der imperialistischen deutschen Bourgeosie
Die militärische Zerschlagung des Faschismus und der Untergang des Deutschen Reiches hatten die imperialistische deutsche Bourgeoisie in eine existentielle Krise gestürzt. Weit mehr als 1918 wurde sie diesmal in den Strudel der Kriegsniederlage hineingerissen. Die Forderung nach Bestrafung der Schuldigen für die Leiden der Völker zielte nicht zuletzt gegen das deutsche Monopolkapital und den Großgrundbesitz. In diesen reaktionären Schichten sahen nicht nur die Arbeiterorganisationen, sondern die breite Weltöffentlichkeit die Hauptverantwortlichen für den zweiten Weltkrieg und die Verbrechen der Hitlerclique.
Weiterblickende Vertreter der herrschenden Klasse in Deutschland hatten durchaus begriffen, daß das Fiasko des Naziregimes auch den eigenen Untergang bedeuten konnte. Deshalb waren sie – als die militärische Niederlage unausweichlich bevorstand – daran interessiert, sich Hitlers zu entledigen, Iürchteten aber zugleich eine von den Massen getragene antifaschistische Erhebung. Sie hatten darauf hingearbeitet, die Anti-Hitler-Koalition aufzuspalten, um sich mit den Westmächten gegen die Sowjetunion zu arrangieren und der bedingungslosen Kapitulation zu entgehen. Diese Karten hatten aber nicht gestochen. Den Versuchen, im letzten Moment politischen Ballast abzuwerfen, war kein Erfolg beschieden gewesen. Als nicht ganz aussichtslos hatten sich hingegen Bemühungen erwiesen, Verbindungen zu ausländischen Monopolgruppen mit Blick auf die Nachkriegszeit wieder zu aktivieren. Dennoch stand die imperialistische deutsche Bourgeoisie zunächst international isoliert da. Auch in den Augen vieler deutscher Werktätiger hatte sie sich diskreditiert.
So herrschte bei der Gesamtheit der Kapitaleigentümer und beim deutschen Finanzkapital im besonderen 1945 ziemliche Unsicherheit. Besitz und Eigentumstitel galten beim Einmarsch der alliierten Armeen wenig. Die generelle Verfligungsgewalt lag auch für die Wirtschaft bei den Besatzungsmächten. Die alliierten Nachkriegsplanungen – soweit sie bekannt geworden waren – hatten erkennen lassen, daß die Siegermächte auch das deutsche Rüstungskapital für die faschistischen Verbrechen haftbar machen wollten und an eine Agrarreform dachten. Von deutscher Seite hatten nicht allein die KPD, sondern auch sozialdemokratische und andere antifaschistische Gruppierungen wiederholt die Entmachtung von Monopolkapital und Großgrundbesitz gefordert. Die Aktionen vieler antifaschistischer Ausschüsse und Komitees bestätigten dies. In Fabriken und Werken, Schächten und Gruben hatten häufig Betriebsräte und Arbeiterkomitees das Sagen.
Vor allem aber drückte sich die Schwäche der imperialistischen deutschen Bourgeoisie darin aus, daß ihr alle staatlichen Machtmittel aus der Hand geschlagen waren. Sie konnte sich keiner Exekutive bzw. keiner Repressivorgane bedienen. Sie verfügte nicht mehr über die Massen beeinflussende Organisationen und Propagandainstrumente. Am ehesten durfte sie hoffen, daß die Kirchen als Bewahrer der gegebenen Wirtschafts- und Sozialordnung in Erscheinung treten würden.
Mithin mußte die imperialistische Bourgeoisie auf Zeitgewinn hinarbeiten und darauf vertrauen, daß sie von den Kapitalgewaltigen in den westlichen Siegerstaaten nicht im Stich gelassen wurde. Politische Exponenten des Monopolkapitals waren von vornherein bereit, auf nationale Souveränitätsrechte zu verzichten und den nationalen deutschen Einheitsstaat preiszugeben, wenn die Behauptung eigener Klassenprivilegien nur auf diese Weise zu ereichen sein sollte. Das deutsche Monopolkapital konzentrierte sich zunächst vor allem darauf, seine Machtgrundlagen in den Besatzungszonen der Westmächte zu erhalten Das schloß ein, diese gegen das Übergreifen erwarteter revolutionärer Umwälzungen in der sowjetischen Besatzungszone abzuschotten. Man setzte auf die Schirmherrschaft westlicher Besatzungsgewalt und spekulierte auf einen antisowjetischen Kurswechsel der Westmächte, den-man zu befijrdern suchte. In diesem Sinne überreichte der Kaliindustrielle Arnold Rechberg der amerikanischen Militäregierung eine Reihe von Denkschriften.12
Schon in der Endphase des Krieges hatte das deutsche Monopolkapital Anlagen und Vermögenswerte nach Westdeutschland vedagert und den Hauptsitz von Konzernen und Banken dahin verlegt. Von seiten der Konzernleitungen wurde vor allem in Niederlassungen in der sowjetischen Besatzungszone nichts unternommen, um ein rasches Ingangsetzen der Produktion zu ermöglichen. Im übrigen veiließ man sich auf die Kraft des Faktischen; denn jeder Wiederaufbau mußte, insofern nicht gravierende Eingriffe in die gegebenen Gesellschaftsstrukturen erfolgten, zur Restauration der alten Macht- und Besitzverhältnisse führen.
Im Interesse der imperialistischen deutschen Bourgeoisie lag somit eine möglichst lange Lähmung des politischen, ja auch des wirtschaftlichen Lebens. Für sie galt es erst einmal auszuloten, wie sich das eigene Klassenanliegen nach Beseitigung der offenen terroristischen Diktatur politisch am besten artikulieren und an die neuen Bedingungen anpassen ließ. Es war zu prüfen, auf welche der sich formierenden parteipolitischen Gruppierungen man setzen konnte, welche Gesellschaftstheorien und Weltanschauungen anstelle der nazistischen Ideologie nun zur Steuerung der Massen zu favorisieren waren. Vor allem lagen Angebote der neoliberalistischen Schule der Nationalökonomie vor, die ein den Praktiken in den USA angenähertes, mit sozialen Zugeständnissen an die Werktätigen untersetztes Wirtschaftsmodell propagierte. Es empfahl sich auch die christliche Soziallehre, besonders in ihrer jesuitischen Variante, die geeignet schien, den starken antimonopolistischen Druck der Nachkriegszeit elastisch abzufangen.
Sich ihres Dilemmas bewußt, verstanden die klügsten Köpfe der imperialistischen deutschen Bourgeoisie recht gut, daß Zurückhaltung und Anpassung an die imperialistischen Besatzungsmächte geboten waren, daß zunächst nur aus der Defensive heraus gehandelt werden konnte. Die angeschlagene deutsche Monopolbourgeoisie verfügte dennoch über viele Möglichkeiten, die Grundlage ihrer Macht zu bewahren, diese den neuen Bedingungen anzupassen und wieder zu festigen. Sie konnte sich auf ihren Besitzstand, auf das Fortwirken reaktionärer Traditionen, auf internationale Kontakte, auf ihre Herrschaftsroutine, auf ein erfahrenes Management, auf eine erprobte Bürokratie und andere ihr Gefolgschaft leistende Schichten und Gruppen stützen. Sie war der Hauptgegner der historischen Wende. Eine Politik antifaschistisch-demokratischer Friedenssicherung auf deutschem Boden und die Erichtung einer einheitlichen, demokratischen, sozial gerechten Republik konnten nur gegen den Widerstand der imperialistischen Bourgeoisie durchgesetzt werden.
Die parteipolitischen Lager
Obwohl mit der Wiederzulassung deutscher Parteien im allgemeinen so bald nicht gerechnet wurde, stellte sich die Frage, welche Rolle angesichts des Untergangs des Deutschen Reiches den politischen Parteien überhaupt zukam. Denn die Ohnmacht der Demokratie von Weimar mit ihren ungezügelten Parteigründungen einerseits und das Parteimonopol der NSDAP als Verkörperung der Diktatur andererseits hatten bei vielen Deutschen so etwas wie einen Antiparteieneffekt ausgelöst. Es war nicht von vornherein klar, inwieweit die traditionellen parteipolitischen Lager überhaupt noch existierten, und es ergab sich die Frage, welche der früheren Parteien überhaupt Anspruch erheben durften, an der notwendigen neuen politischen Willensbildung mitzuwirken.
Das Naziregime hatte die Parteien der Arbeiterklasse mit dem erklärten Ziel verfolgt, sie auszulöschen. Andere Parteien waren durch die faschistische Gesetzgebung zur Selbstauflösung gezwungen bzw. gleichgeschaltet und damit faktisch beseitigt worden, soweit sie nicht selbst willlfährig Anschluß an die Nazibewegung gesucht hatten. Doch war damit das deutsche Parteiensystem, dessen Grundstrukturen bis in die Mitte des 19.Jahrhunderts zurückreichten, als Produkt einer geschichtlich gewordenen politischen Kultur nicht gänzlich aus der Welt geschafft. Das vermochte auch kein noch so restriktives Vorgehen der faschistischen Diktatur, denn die großen parteipoliti schen Strömungen wurzelten in den Klassenverhältnissen. In ihnen spiegelten sich die sozialen Zustände und die politischen Interessen unterschiedlicher Schichten im kapitalistischen Deutschland. Solange die kapitalistischen Verhältnisse fortbestanden, war auch der objektive Boden für bestimmte parteipolitische Richtungen gegeben.
Auch nach der Zerschlagung der faschistischen Zwangsherrschaft wirkte dieser Mechanismus, doch traten wesentliche neue Momente hinzu. Einiges deutete darauf hin, daß es einen frühere parteipolitische Konstellationen hinter sich lassenden Neuansatz geben könnte. Manche antifaschistischen Ausschüsse erinnerten mehr an rätedemokratische als an parteipolitische Formen. Vor allem aber zeigte sich eine stärkere Konzentration in den Hauptgruppierungen. Splitterparteien des linken Spektrums vermochten nicht wieder Fuß zu fassen. Manche lokalen Zusammenschlüsse von Sozialdemokraten und Kommunisten zeugten vom Streben nach sofortiger Konstituierung einer Einheitspartei der Arbeiterklasse.
Rechtskonservative oder gar rechtsextreme Parteien widersprachen den alliierten Vereinbarungen über Deutschland. Das förderte die Sammlung verschiedener Fraktionen des bürgerlichen Lagers um zwei Grundströmungen: die christlich-demokratische und die liberal-demokratische. Diese Trends und die durch die Besatzungspolitik gesetzten generellen Bedingungen ließen – trotz regionaler Verschiedenheit – ein in den Grundlinien in allen Zonen übereinstimmendes Parteiensystem entstehen. Die Führung der KPD hatte realistisch in Rechnung gestellt, daß es nach der Zerschlagung des Faschismus zur Wieder- oder Neubelebung von Parteien bzw. Parteirichtungen der Weimarer Republik kommen werde, daß nicht eine diffuse antifaschistische Bewegung, sondern politische Parteien Träger der politischen Willensbildung sein werden. Dafür sprachen die Erfahrungen der befreiten europäischen Länder ebenso, wie es die Ergebnisse der deutschen Geschichte bestätigten. Wilhelm Pieck war bereits im Dezember 1944 davon ausgegangen, daß „die alten grofien Parteien wieder aufleben werden”13, daß neben den Arbeiterparteien KPD und SPD eine an die Politik der frtiheren Zentrumspartei angelehnte, christlich orientierte und eine liberale, demokratische Partei entstehen werden. Ahnlich wurde die Situation auch im bürgeilichen Lager beurteilt. So erwartete zum Beispiel Theodor Heuss, daß die „Gesinnung des Antinazismus” ihre „bindende Kraft” vedieren und sich „wieder soziale und politische Ideologien“ als parteibildende Faktoren melden werden.14
Eine Organisation, die zwölf Jahre faschistische Diktatur trotz schwerer Veduste politisch und moralisch ungebrochen durchstanden hatte und zum Zeitpunkt der Befreiung sofort aktionsfähig war, besaß nur die KPD. Die Traditionen früherer bürgerlicher Parteien verkörperten sich fast ausschließlich im Festhalten einzelner Persönlichkeiten an ihren politischen Überzeugungen, in Freundeskreisen, bestenfalls in Gruppen von Hitlergegnern. Selbst die Sozialdemokratie, deren Mitglieder sich gegenüber dem Faschismus weitgehend als resistent erwiesen hatten, vermochte keine einheitliche Führung über zwölf Jahre Nazidiktatur hinweg und auch nicht die Verbindung zwischen den Sozialdemokraten im Lande und denen im Exil zu bewahren.
Auf den Entstehungsprozeß des neuen Parteienspektrums wirkte nicht nur das Besatzungsregime ein, sondern es ergaben sich schon bald innere Entscheidungen, die das künftige politische Kräfteverhältnis nachhaltig beeinflussen mußten. Für die Arbeiterbewegung stellte sich das Problem, ob Kommunisten und Sozialdemokraten zu gemeinsamem Handeln fähig sein werden und so der Arbeiterklasse die Hegemonie beim Neuaufbau zu sichern vermögen. Für die anderen Parteien ergab sich die Frage, welche Kräfte sich durchsetzen werden: konservative bzw. klerikale oder linksorientierte christlich-soziale Politiker; Verfechter eines nationalliberalen Bürgerblocks oder bürgeliche Demokraten, die die geschichtsgestaltende Rolle der Arbeiterbewegung akzeptierten. Viel hing davon ab, ob sich die bürgerlichen Politiker als Partner der Arbeiterparteien beim demokratischen Neuaufbau verstanden oder ob sie antisozialistische Gegenkraft zur Arbeiterbewegung sein wollten. Augenfällig war, daß bürgeliche Politiker auf den Trend einer Linkswende in Europa und auf den Einheitsdrang in der deutschen Arbeiterbewegung mit dem Versuch der Sammlung über konfessionelle und frühere parteipolitische Grenzen hinweg antworteten.
Gemessen an den geschichtlichen Erfahrungen und gemäß den völkenechtlich verbindlichen Vereinbarungen der Anti-Hitler-Koalition waren nur Parteien legitimiert, die sich die restlose Überwindung des Faschismus und die Ausrottung aller Wurzeln deutscher Kriegspolitik zum Ziele setzten. Auf diesem Boden war auch eine konstruktive Zusammenarbeit aller demokratischen Parteien beim Neuaufbau der Heimat möglich.
Religiosität und Kirchen
Die einzigen großen Institutionen, die mit ihren Strukturen, mit ihrer Hierarchie, mit ihrem Personal und ihren Einflußmöglichkeiten weitgehend intakt aus der Zeit des Faschismus in die Periode des Neubeginns eintraten, waren die Kirchen. Erneut bestätigte sich, daß religiöse Überzeugungen in beträchtlichen Teilen der Bevölkerung tief verwurzelt waren und sich die Kirchen in hohem Maße an wechselnde politische und soziale Bedingungen anzupassen vermochten.

Von den Kirchen erhofften sich die besitzenden Oberschichten, daß diese ihren Einfluß geltend machen, um bestehende Verhältnisse zu bewahren, daß sie einen Ruhepol in Zeiten des Umbruchs darstellen. In ihnen sahen die westalliierten Besatzungsbehörden Institutionen, mit denen eine Zusammenarbeit in besonderem Maße geboten schien, denn nach Ausschaltung des nazistischen Machtapparates verkörperten sie ein Element der Kontinuität, gefeit vor revolutionären Versuchungen und vor einer Orientierung auf die Sowjetunion. Mit ihrem Wissen über das soziale und politische Milieu und ihrer Personenkenntnis waren kirchliche Würdenträger für viele Besatzungsoffiziere gefragte Ratgeber. Besonders die in amerikanisch, britisch oder französisch besetzten Gebieten dominierende römisch-katholische Kirche verstand sich als eine die Politik mitgestaltende Kraft. Sie stand der neuen Situation nicht unvorbereitet gegenüber, und vor allem in den west- und südwestdeutschen Kernlanden des Katholizismus bedienten sich Gründerkreise bürgerlicher Parteien der weltanschaulichen Angebote und der strategischen Übedegungen von katholischen Würdenträgern und Ordensgemeinschaften.
Die Nöte des Krieges und der Nachkriegszeit, die große Teile der Bevölkerung aus gewohnten Lebensbahnen geworfen hatten, ließen viele Deutsche Halt in der Religion suchen. Ausgebombte, Flüchtlinge und alleinstehende Frauen sahen sich häufig aufkaritative Hilfe von Glaubensgemeinschaften angewiesen und besuchten auch deren Gottesdienste. Der Gang zur Kirche war für sie ein Schritt aus der Vereinzelung heraus, eine Suche nach Gemeinschaft, nach Zusammenhalt in schwerer Zeit. Als für viele der Glaube an den Führer dahin war, wandten sich die einen der rationalistischen Weltsicht der Arbeiterbewegung oder bürgedich-aufklärerischer Fortschrittskräfte zu, die anderen brauchten einen neuen Glauben und nahmen das Angebot der Kirchen bereitwillig an.
So führten die Zeitumstände zu einer religiösen Besinnung von Frauen, Männern und Jugendlichen, die bisher nur in loser Verbindung zu den Glaubensgemeinschaften gestanden hatten. Nicht nur die römisch-katholische und die evangelisch-lutherische Kirche erfuhren diese erneute Hinwendung zur Christenheit, auch Religionsgemeinschaften wie die Gemeinde der Mennoniten, der Bund Evangelisch-Freikirchlicher Gemeinden (Baptisten), die Evangelisch-Methodistische Kirche, die Neuapostolische Gemeinde und andere erhielten Zuspruch. Mancherorts blühte das Sektenwesen.
Dem stand jedoch gegenüber, daß noch mehr die Zahl deret wuchs, die das furchtbare Geschehen der jüngsten Vergangenheit ernüchtert hatte, die sich fragten, wo Gott gewesen sein mag, als Faschismus und Krieg Millionen Menschen hinwegrafften, und die nicht bereit waren, in all dem Grauen das Walten eines Gottes zu sehen. So mancher gläubige Katholik oder Protestant geriet in Gewissenskonflikte, denn in den Verkündungen seiner Kirche und im tagtäglichen Handeln vieler Geistlicher hatte sich Christentum meist nicht als engagierte Verteidigung von Humanismus und Frieden gegen faschistische Barbarei bestätigt. Doch gab es die Beispiele von Bekennermut und tapferem antifaschistischen Aufbegehren aus christlicher Verantwortung. Dafür stehen die Namen des evangelischen Theologen Dietrich Bonhoeffer, des Predigers der Bekennenden Kirche Pfarrer Paul Schneider oder des katholischen Kaplans und Jugendfunktionärs Joseph Rossaint.
Die Kirchenführungen hatten sich des einen oder anderen Eingriffs der Nazis in ihr religiöses Leben und in die Glaubenslehre zu erwehren versucht, ansonsten aber die Autorität des Staates nicht nur respektiert, sondern darüber hinaus aufgerufen zu Pflichterfüllung und Opferbereitschaft im Kriege, zu Fürbitte für Führer, Reich und Wehrmacht, ja selbst zum heiligen Kreuzzug für Heimat und Volk, Glauben und Kirche, vor allem wenn der Feind Sowjetunion hieß. Das Gebot der Nächstenliebe erwies sich nur selten in tätiger Solidarität mit den jüdischen Mitbürgern und anderen Opfern des Faschismus als Maxime eigenen Handelns. Wie jedermann in Deutschland so mußten sich auch die Kirchen nach ihrer Mitverantwortung für das Geschehene fragen lassen. Mehr als zunehmende Religiosität hatten die rassistische Politik des faschistischen Staates und die durch Evakuierungen und Umsiedlungen verursachte Bevölkerungsbewegung Veränderungen in die Konfessionen gebracht. Einströmende Flüchtlinge und Umsiedler ließen die Zahl der praktizierenden Christen in vielen Städten und Dörfern ansteigen und stärkten in manchen protestantisch dominierten Gebieten die katholischen Minderheiten.
Nahezu gänzlich verschwunden waren die Millionen Juden, von denen 1945 in Deutschland nur noch etwa 10 000 lebten. Ihre Synagogen waren in Flammen aufgegangen, ihre Angehörigen in Vernichtungslagern zu Tode geschunden oder fabrikmäßig umgebracht worden. 123 000 Juden deutscher Staatsangehörigkeit waren dieser barbarischen Rassenpolitik der Hitlerclique zum Opfer gefallen. Juden, die sich hatten in Sicherheit bringen können, waren selten bereit, nach Deutschland zurückzukehren.
Was den christlichen Kirchen, vor allem der römisch-katholischen Kirche, erhöhten Einfluß vedieh, war nicht so sehr die Hinwendung der Bevölkerung zu ‚Glauben und Gottesdienst, sondern die in vieler Hinsicht privilegierte Stellung der Kirchen. Die Möglichkeiten ihres Wirkens waren durch keine Besatzungsmacht eingeschränkt worden. Ihr Vermögen, soweit nicht durch den Krieg vernichtet, blieb unangetastet. Ihre Organisationen mußten nicht neu aufgebaut werden. Sie untedagen am wenigsten den mit der Bildung von Besatzungszonen entstandenen Beschränkungen, und viele ihrer internationalen Verbindungen bestanden fort. Katholische Würdenträger wie die Kardinäle Michael Faulhaber oder Josef Frings gehörten zu den über den politischen Umbruch hinweg fortbestehenden „Führungseliten”. Evangelische Bischöfe wie Otto Dibelius oder Theophil Wurm übten ungebrochen beträchtlichen Einfluß aus.
Die Anfänge eines neuen politischen und kulturellen Lebens
Inhaltsverzeichnis
- 1 Die Anfänge eines neuen politischen und kulturellen Lebens
- 1.1 Der Aufbau der SMAD und ihr Befehl Nr. 2
- 1.2 Der Aufruf des Zentralkomitees der KPD vom 11. Juni 1945
- 1.3 Die Formierung der legalen KPD und deren Entwicklung zur Massenpartei
- 1.4 Neubeginn der Sozialdemokratie
- 1.5 Herausbildung des Freien Deutschen Gewerkschaftsbundes
- 1.6 Das Aktionsabkommen KPD/SPD und die Entfaltung der Aktionseinheit
- 1.7 Das Entstehen bürgerlich-demokratischer Parteien
- 1.8 Der Block der antifaschistisch-demokratischen Parteien
- 1.9 Die Vorbereitung antifaschistisch-demokratischer Massenorganisationen
- 1.10 Die Sorben und die Erneuerung der Domowina
- 1.11 Die Bildung der Landes- und Provinzialverwaltungen und von deutschen Zentralverwaltungen
- 1.12 Erste Schritte zur Ingangsetzung von Industrie und Verkehrswesen
- 1.13 Gewerkschaften und Betriebsräte im Ringen um die Arbeiterkontrolle
- 1.14 Neuordnung des Finanzwesens
- 1.15 Die erste Friedensernte und die neue Agrarpolitik
- 1.16 Die Anfänge des kulturellen Lebens
Wie in Berlin, so war überall im sowjetisch besetzten Gebiet der Aufbau demokratischer Verwaltungen der erste Schritt zur Normalisierung des Lebens der Bevölkerung. Besonders rasch ging die Bildung dieser Verwaltungsorgane in jenen Städten und Orten vonstatten, in denen es aktive kommunistische Parteiorganisationen und organisierte Gruppen von Antifaschisten gab. Diese erhielten von den sowjetischen Kommandanten in der Regel den Auftrag, personelle Vorschläge für die Besetzung der Funktion des Bürgermeisters und der leitenden Mitarbeiter der Stadt- und Gemeindeverwaltungen zu unterbreiten. Es gab aber auch Orte – vor allem auf dem flachen Lande -, in denen es schwierig war, geeignete antifaschistische Kräfte zu finden. Hier übernahmen nicht selten zunächst die Frontbeauftragen des Nationalkomitees „Freies Deutschland“ die Funktion des Bürgermeisters.
Beispielgebend für Aufbau und Arbeitsweise der neuen Verwaltungen wirkten die Initiativgruppen der KPD, die sich wie in Berlin, so auch in den größten Städten der Mark Brandenburg, Mecklenburgs und Sachsens vorrangig der Schaffung neuer Verwaltungen widmeten und dabei besonderen Wert auf die Einbeziehung aller antifaschistisch-demokratischen Kräfte legten. Wie Anton Ackermann rückblickend schrieb, hatten die Beauftragten des ZK der KPD „als erste Maßnahme die Bildung deutscher Selbstverwaltungsorgane auf unterster örtlicher Ebene, d.h. in den Städten und Gemeinden, vorzunehmen. Aus den besten und bewährtesten Menschen in diesen Organen waren dann, als der zweite Schritt, die Kreisverwaltungen, schließlich die Landesverwaltungen und die zentralen deutschen Verwaltungen zu bilden …. Die territoriale Einteilung stand fest. Die Städte und Gemeinden und ebenso die Kreise blieben, wie sie waren … Auch die Struktur – der innere Aufbau – der neuen Verwaltungsorgane war vorher geklärt. Überall hatten die gleichen Grundsätze zu gelten, die nach Größe der Städte bzw. Gemeinden abzuwandeln war.“15
In Brandenburg an der Havel, wo ein Beispiel auch für andere mittlere Städte gegeben wurde, bestätigte der sowjetische Kommandant am 23. Mai 1945 den vom Aktionsausschuß von KPD und SPD eingebrachten Vorschlag für die neue Stadtverwaltung. Diese setzte sich wie folgt zusammen: Oberbürgermeister (KPD), Stadträte für Personalfragen, Arbeits- und Sozialfürsorge, Polizei, städtische Betriebe, Wohnungswesen, Volksbildung (alle KPD); Stellvertretender Bürgermeister, Stadträte für Handel und Versorgung, Finanzen, Verkehr, Leiter des Arbeitsamtes (alle SPD), Dezernate für Wirtschaft, Industrie, Gesundheitswesen (bürgerliche Antifaschisten), Dezernat für Kirchenfragen (ein Pfarrer). Als Vorläufer einer gewählten Stadtverordnetenversammlung wurde im Sommer 1945 in Brandenburg ein Stadtbeirat gebildet, der sich in verschiedene Ausschüsse gliederte. Ihm gehörten 15 Kommunisten und Sozialdemokraten und 15 Vertreter bürgerlich-demokratischer Parteien an. Er tagte Öffentlich, und der Stadtrat war ihm gegenüber rechenschaftspflichtig.
Mit diesen demokratischen Verwaltungen gewannen die deutschen Antifaschisten Positionen, mit denen sie viel nachhaltiger und unmittelbarer als über die antifaschistischen Ausschüsse auf den demokratischen Neuaufbau einwirken konnten, denn hier handelte es sich um die Keimzellen einer neuen Staatsmacht. Hier den Hebel anzusetzen bedeutete, mit der Schaffung einer neuen Staatsorganisation von unten her die Überreste der imperialistischen Staatsmaschinerie zu zerschlagen. Dabei war die vordringlichste Aufgabe die der Säuberung des Verwaltungsapparates von faschistischen und anderen reaktionären Beamten und Angestellten.
Noch bevor antifaschistisch-demokratische Parteien zugelassen waren, bewährte sich in den demokratischen Verwaltungen die Zusammenarbeit von Kommunisten, Sozialdemokraten, bürgerlichen Politikern und keiner Partei zugehörigen Fachleuten. Sie erbrachte den Beweis für die Notwendigkeit und Möglichkeit einer antifaschistischen Einheitsfront. Das ging nicht überall reibungslos vonstatten. Bei Kommunisten traten „linke Überspitzungen“ auf. Diese äußerten sich in vereinzelten Versuchen, Rätedemokratie zu praktizieren, in mangelnder Bereitschaft, mit bürgerlichen Kräften zusammenzuarbeiten, und in Vorbehalten, Sozialdemokraten in die Verantwortung einzubeziehen. Doch ebenso zeigten sich gegenteilige Tendenzen. So gab es Orte, wo anfangs Kommunisten und Sozialdemokraten, ja überhaupt jegliche Arbeitervertreter in den Verwaltungen fehlten. Es bedurfte jedoch nur weniger Wochen, bis derartige Erscheinungen korrigiert waren. Bald hatten nahezu überall die demokratischen Verwaltungen den Charakter antifaschistisch-demokratischer Koalitionen angenommen. Darauf wirkten in der Regel auch die sowjetischen Besatzungsorgane nachdrücklich hin.
Vor den neuen, demokratischen Verwaltungen türmten sich sofort riesige Aufgaben. Dringlichstes Anliegen war, die Bevölkerung vor dem Hungertod zu retten, eine zumindest minimale Belieferung mit Lebensmitteln zu gewährleisten. Mit der Aufrechterhaltung der Wasserversorgung, der Stadthygiene und des medizinischen Dienstes war dem Ausbruch von Seuchen vorzubeugen. Als dann dennoch Ruhr, Typhus und Fleckfieber wie auch Geschlechtskrankheiten um sich griffen, waren elementare Voraussetzungen geschaffen, um diese Seuchen einzudämmen. Evakuierten Personen und Flüchtlingen galt es wenigstens eine Notunterkunft zu vermitteln. In den zerstörten Städten und Gemeinden mußte mit den Aufräumungsarbeiten begonnen werden, Arbeitseinsätze waren zu Organisieren, die Tätigkeit kommunaler Betriebe zu sichern. Auf dem Lande durften die Bestellung der Felder und die Versorgung des Viehs nicht zum Erliegen kommen und wollte die Ernte vorbereitet sein. Überall zeigten sich noch die Spuren der faschistischen Diktatur, die unverzüglich auszulöschen waren so durch die Entfernung nazistischer Symbole, die Umbenennung von Straßen und Plätzen, Schulen und Firmen und die Säuberung von Buchhandlungen, Bibliotheken und Museen von Zeugnissen faschistischer Ideologie. Es kam darauf an, Ordnung und Sicherheit herzustellen, den Plünderungen ein Ende zu setzen, faschistische Verbrecher und Marodeure dingfest zu machen. Dazu war es notwendig, eine antifaschistische Polizei zu schaffen, die sich vor allem aus klassenbewußten, politisch organisierten Arbeitern zusammensetzte.
All diese Aufgaben mußten Werktätige bewältigen, die meist keine Erfahrungen in der Verwaltungsarbeit besaßen, dafür aber politischen Verstand und praktischen Sinn. Wo Verwaltungsfachleute oft hilflos die Arme hoben, packten sie zu, versicherten sie sich des Beistandes ihrer Kollegen und gingen den mitunter unlösbar scheinenden Problemen zu Leibe. Dabei fanden sie immer die Unterstützung der sowjetischen Kommandanturen, die in den ersten Monaten noch viele zivile Angelegenheiten selbst leiteten. Während konservative Politiker, vor allem in den von westalliierten Truppen besetzten Gebieten, immer wieder behaupteten, ohne die alten nazistischen Beamten sei kein geordneter Neuaufbau möglich, erbrachten die Funktionäre der antifaschistisch-demokratischen Verwaltungen den Gegenbeweis. Wenig später würdigte der erste Präsident der Landesverwaltung Sachsen, der Sozialdemokrat Rudolf Friedrichs, diese Leistungen mit den sicher etwas euphorischen, dennoch aber bezeichnenden Worten: „Nun aber ergab sich das Wunder. Überall regten sich die antifaschistischen und aufbauwilligen Kräfte, die bisher unter dem nationalsozialistischen Terror wie erstickt gelegen hatten, und begannen aufzuräumen und Neues aufzubauen. Ganz von unten her, in jeder kleinen Gemeinde regte sich dieser Wille, und nach kurzer Zeit hatten sich die
Der Sitz der SMAD in Berlin-Karlshorst, 1945
Gemeinden nach ihrer Größe und ihren Kräften eine neue Ordnung geschaffen.“16
Der Aufbau der SMAD und ihr Befehl Nr. 2
Am 6.Juni 1945 war eine Anordnung des Rates der Volkskommissare der UdSSR ergangen, in der die Bildung der Sowjetischen Militäradministration in Deutschland angewiesen wurde. Der SMAD, die ihren Sitz in Berlin-Karlshorst hatte, oblag die Aufgabe, die bedingungslose Kapitulation Deutschlands zu kontrollieren, die sowjetische Besatzungszone zu verwalten und hier die Beschlüsse des Alliierten Kontrollrates zu den wichtigsten militärischen, politischen und Öökonomischen Fragen Gesamtdeutschlands durchzuführen.
Mit ihrem Befehl Nr. 1 vom 9. Juni 1945 teilte die SMAD mit, daß sie sich konstituiert habe. Als ihr Oberster Chef wirkte in der Anfangsperiode Marschall der Sowjetunion G. K. Shukow, der hervorragendste Heerführer des zweiten Weltkrieges, als sein erster Stellvertreter Armeegeneral W. D. Sokolowski. Zum Stellvertreter in Sachen der Zivilverwaltung wurde Generaloberst I. A. Serow, zum Stabschef Generaloberst W. W. Kurasow ernannt. Den Leitern der SMAD brachten auch Vertreter der Streitkräfte der Westmächte großen Respekt entgegen. So schrieb der amerikanische General Walter B. Smith: „Wir hatten hauptsächlich Verbindung mit Marshall Shukow und General Sokolowski, zwei Männern, die wir bewunderten und die meinem Gefühl nach in jedem Land als hervorragend gelten würden. Beide, wie auch ihre nächsten Mitarbeiter, beeindruckten uns nicht allein durch ihre Tüchtigkeit, sondern auch durch ihre offene, aufrechte Haltung.“
Die SMAD arbeitete unter direkter Anleitung des Zentralkomitees der KPdSU (B), des Rates der Volkskommissare der UdSSR und der Politischen Hauptverwaltung der Sowjetarmee. Auf die Bildung der SMAD folgte die Einrichtung sowjetischer Militäradministrationen (SMA) in den Ländern und Provinzen und analoger Dienststellen in Kreisen und Städten. So entstand eine den territorialen Strukturen angepaßte sowjetische Administration, in der es für alle wichtigen Bereiche wie Industrie, Landwirtschaft, Handel und Versorgung, Transport, Brennstoffe, Finanzen, Reparationen und Lieferungen, Arbeitskräfte, Volksbildung, Gesundheitswesen, Rechtsfragen entsprechende Abteilungen bzw. verantwortliche Mitarbeiter gab. Eine besonders enge Zusammenarbeit mit den Vertretern antifaschistisch-demokratischer Parteien und Organisationen entwickelte in der Folgezeit die von Oberst S. 1, Tjulpanow geleitete Informationsverwaltung. Die Organe der SMAD übernahmen alle bis dahin von den Befehlshabern und Militärkommandanturen des Feldheeres ausgeübten Funktionen. Bereits einen Tag nach ihrer Konstituierung erließ die SMAD ihren Befehl Nr.2. Darin wurde festgestellt, daß im „Gebiet der Sowjetischen Besatzungszone in Deutschland eine feste Ordnung“ bestand, „die städtischen Organe der Selbstverwaltung organisiert und notwendige Bedingungen für die freie gesellschaftliche und politische Tätigkeit der deutschen Bevölkerung geschaffen“ worden waren. Davon ausgehend, gestattete die SMAD „die Bildung und Tätigkeit aller antifaschistischen Parteien …, die sich die endgültige Ausrottung der Überreste des Faschismus und die Festigung der Grundlage der Demokratie und der bürgerlichen Freiheiten in Deutschland und die Entwicklung der Initiative und Selbstbetätigung der breiten Massen der Bevölkerung in dieser Richtung zum Ziele setzen“. Zugleich räumte sie Arbeitern und Angestellten das Recht ein, sich „in freien Gewerkschaften und Organisationen zum Zweck der Wahrung der Interessen und Rechte der Werktätigen“ zu vereinigen.“
Die Sowjetunion war mit Abstand die erste Besatzungsmacht, die antifaschistisch-demokratische Parteien und freie Gewerkschaften zuließ und deren Wirken auf Zonenebene ermöglichte. Parteien und Gewerkschaften durften lizenzierte Presseerzeugnisse herausgeben und ihr Verlagswesen aufbauen. Sie erhielten Unterstützung bei der Einrichtung von Parteigebäuden und -büros und bekamen Fahrzeuge, Treibstoff und Papier zur Verfügung gestellt.
Mit dem Befehl Nr. 2, den die westlichen Alliierten verblüfft zur Kenntnis nahmen und der sie unter Zugzwang setzte, dokumentierte die Sowjetunion, daß sie die Liquidierung der Überreste des Faschismus und den Aufbau einer antifaschistischen Demokratie gemeinsam mit den in Parteien und Gewerkschaften organisierten deutschen Werktätigen verwirklichen wollte.
Die Befehle der SMAD bildeten die Hauptform der rechtsetzenden Tätigkeit der sowjetischen Besatzungsmacht und waren zugleich Anweisungen zur Durchführung. Bei ihrer Einflußnahme auf die politische, ökonomische und kulturelle Entwicklung bediente sich die SMAD deutscher Zentralverwaltungen, die für wichtige Bereiche ins Leben gerufen wurden. Zu bestimmten Anlässen fanden Beratungen mit verantwortlichen Repräsentanten der Länder und Provinzen statt, die aber nicht als besonderes Gremium institutionalisiert wurden. Zudem unterhielten die Abteilungen der SMAD, die SMA der Länder und Provinzen sowie die sowjetischen Kommandanturen vielfältige Kontakte zu den deutschen Parteien, gesellschaftlichen Organisationen und zu Vertretern des Öffentlichen Lebens.
In einer Zeit, in der es keine souveräne deutsche Staatsgewalt gab, legten die Befehle der SMAD für die gesamte Besatzungszone verbindliche Maßnahmen fest. So wurden die alliierten Vereinbarungen über die Entmilitarisierung und Entnazifizierung, über die Verfolgung und Bestrafung von Naziund Kriegsverbrechern, über die Säuberung und Neuordnung des Öffentlichen Lebens in die Praxis umgesetzt und auch die Befriedigung der sowjetischen Reparationsansprüche, die Versorgung der sowjetischen Besatzungstruppen und die Deckung von Besatzungskosten gewährleistet.
Beratung mit deutschen Antifaschisten in einer sowjetischen Kommandantur, Mai/Juni 1945
Zugleich ergingen Befehle, die dem Ingangbringen des wirtschaftlichen und kulturellen Lebens und der Ausgestaltung des Verwaltungsaufbaus dienten, wie Befehl Nr. 9 der SMAD zur Wiederingangbringung der Industrieproduktion, Befehl Nr. 17 über die Bildung von deutschen Zentralverwaltungen in der sowjetischen Besatzungszone, Befehl Nr. 40 über die Vorbereitung der Schulen auf den Schulbetrieb oder die Befehle über die Vorbereitung der Hochschulen auf Wiederaufnahme der Lehre, über die Reorganisierung der deutschen Gerichte, über die Wiedererrichtung und die Tätigkeit der Kunstinstitutionen.
Bereits für diese sämtlich im Sommer 1945 erlassenen Befehle war charakteristisch, daß sie in der Regel im Kontakt mit deutschen Antifaschisten erarbeitet wurden und den neuen, demokratischen Verwaltungen Spielraum für Eigeninitiative ließen, ja diese geradezu herausforderten.
Maßnahmen zur Entmilitarisierung und Entnazifizierung Deutschlands behielt die SMAD in Übereinstimmung mit den alliierten Vereinbarungen und den Beschlüssen des Alliierten Kontrollrats in ihrer unteilbaren Kompetenz. Nachdem die UdSSR entsprechend den alliierten Abmachungen über die Verfolgung und Bestrafung von Kriegsund Naziverbrechen bereits 1943 nach der Befreiung der Städte Krasnodar und Charkow die ersten Prozesse angestrengt hatte, behielt sie auch nach der Besetzung Deutschlands die Verfolgung und Bestrafung der nach alliierten Rechtsgrundsätzen schuldigen Personen in ihren Händen. Zugleich unterstützte die SMAD den Aufbau demokratischer deutscher Justizorgane, denen ebenfalls wichtige Aufgaben bei der strafrechtlichen Verfolgung der in der Zeit des Faschismus begangenen Verbrechen zufielen.
Bei den auf Wiederaufbau und Demokratisierung gerichteten Maßnahmen arbeiteten die Organe der SMAD eng mit den antifaschistisch-demokratischen deutschen Verwaltungen zusammen. Dabei nahmen sie in ihren Befehlen, Erlassen und Weisungen im allgemeinen keine Präjudizierung der sozialökonomischen Verhältnisse vor, sondern legten derartige Entscheidungen in deutsche Hände. Die Befehle der SMAD und die Vielzahl der darüber hinaus erteilten schriftlichen und mündlichen Weisungen stellten in ihrer Gesamtheit eine Anleitung zum Handeln dar, die sehr dazu beitrug, daß die in der Leitung von Verwaltung, Wirtschaft und Kultur noch wenig erfahrenen deutschen Antifaschisten ihrer Eigenverantwortung gerecht werden konnten.
Der Aufruf des Zentralkomitees der KPD vom 11. Juni 1945
Schon vor Erlaß des Befehls Nr.2 der SMAD hatte der noch in Moskau weilende Vorsitzende des ZK der KPD, Wilhelm Pieck, die Leiter der drei Initiativgruppen zu sich gerufen. Gemeinsam mit Anton Ackermann, Gustav Sobottka und Walter Ulbricht beriet er in den Tagen vom 4. bis 10.Juni 1945 über die nächsten Schritte der KPD und über deren erste programmatische Erklärung. Den führenden Funktionären der KPD bot sich die Gelegenheit, ihre Vorstellungen auch mit Josef Wissarionowitsch Stalin und anderen Mitgliedern des Politbüros der KPdSU (B) und mit Georgi Dimitroff, der nach Auflösung der Kommunistischen Internationale die Abteilung Internationale Information beim ZK der KPdSU (B) leitete, zu beraten.
Die KPD wollte eine Plattform für das Zusammenwirken aller antifaschistisch-demokratischen Kräfte unterbreiten und wählte hierfür die Form eines Aufrufs an das schaffende deutsche Volk. Er sollte die Ursachen der verhängnisvollen Situation, in der sich das deutsche Volk befand, aufdecken und die dafür Schuldigen benennen. Den Zielen und Aufgaben, die die KPD den Werktätigen unterbreiten wollte, lag das von ‘den Kommunisten seit einem Jahrzehnt entwickelte Konzept der Friedenssicherung und des Ringens um eine neue, antifaschistisch-demokratische Republik zugrunde. Diese vor allem in den Dokumenten der Brüsseler Parteikonferenz 1935 und der Berner Parteikonferenz 1939 gegebene Orientierung behielt ihre Gültigkeit als nächstes Etappenziel. Die KPD konnte sich auf die Erfahrungen des Nationalkomitees „Freies Deutschland“ und auf die seit Ende 1944 im Auftrage der Parteiführung der KPD von Kommissionen kollektiv erarbeiteten Vorschläge für die antifaschistisch-demokratische Umgestaltung der verschiedenen gesellschaftlichen Bereiche stützen. All diese Überlegungen galt es nun mit der in Deutschland eingetretenen realen Situation in Einklang zu bringen. Es kam darauf an, die von der Parteiführung in Moskau gewonnenen Erkenntnisse mit den Vorstellungen der aus der Illegalität hervorgetretenen und aus Zuchthäusern und Konzentrationslagern befreiten Genossen und den Erfahrungen der Aktivisten der ersten Stunde zu verbinden.
Der Aufruf der KPD an das schaffende Volk in Stadt und Land, an Männer und Frauen, an die deutsche Jugend, der das Datum 11. Juni 1945 trägt, war die erste programmatische Erklärung einer deutschen Partei nach der Zerschlagung des Faschismus. Er war „im Auftrage des Zentralkomitees“ von Wilhelm Pieck, Walter Ulbricht, Franz Dahlem, Anton Ackermann, Gustav Sobottka, Ottomar Geschke, Johannes R. Becher, Edwin Hoernle, Hans Jendretzky, Michael Niederkirchner, Hermann Matern, Irene Gärtner (Elli Schmidt), Bernard Koenen, Martha Arendsee, Otto Winzer und Hans Mahle unterzeichnet worden. Wilhelm Pieck erläuterte dieses wegweisende Dokument in einem Leitartikel der ersten Nummer des Zentralorgans der KPD „Deutsche Volkszeitung“.
Der Aufruf begann mit dem eindringlichen Verweis auf die Hinterlassenschaften der Nazidiktatur: „Wohin wir blicken, Ruinen, Schutt und Asche. Unsere Städte sind zerstört, weite ehemals fruchtbare Gebiete verwüstet und verlassen. Die Wirtschaft ist desorganisiert und völlig gelähmt. Millionen und aber Millionen Menschenopfer hat der Krieg verschlungen, den das Hitlerregime verschuldete, Millionen wurden in tiefste Not und größtes Elend gestoßen.“19
Die KPD beantwortete die Frage, wer für all das die Verantwortung trug. Sie deckte auf, daß nicht allein die faschistischen Machthaber, sondern auch deren Hintermänner in der Rüstungsindustrie, profitlüsterne Monopolkapitalisten und militaristische Großgrundbesitzer die Schuld traf. Weil sie 1918 nicht entmachtet worden waren, weil ihnen die Weimarer Republik freies Spiel gewährt hatte, weil Antisowjetismus und Uneinigkeit der antifaschistischen Kräfte Hitler den Weg ebneten, wurde das deutsche Volk in eine neue, noch verheerendere Katastrophe gestoßen. Deshalb forderte die KPD mit allem Nachdruck: „Keine Wiederholung der Fehler von 1918! Schluß mit der Spaltung des schaffenden Volkes! Keinerlei Nachsicht gegenüber dem Nazismus und der Reaktion! Nie wieder Hetze und Feindschaft gegenüber der Sowjetunion; denn wo diese Hetze auftaucht, da erhebt die imperialistische Reaktion ihr Haupt!“
Die KPD konnte nicht unausgesprochen lassen, daß sich auch jene mitschuldig gemacht hatten, die willenlos und widerstandslos zusahen, „wie Hitler die Macht an sich riß, wie er alle demokratischen Organisationen, vor allem die Arbeiterorganisationen, zerschlug und die besten Deutschen einsperren, martern und köpfen ließ“.21 Über diese Mitschuld und Mitverantwortung mußte gesprochen werden, denn anders vermochte die deutsche Bevölkerung die notwendigen Lehren aus der Geschichte nicht zu ziehen, vermochte sich kein wahrhaft antifaschistisches, demokratisches Bewußtsein zu entwickeln.
Die KPD konnte sich darauf berufen, daß sie die Partei des entschiedenen Kampfes gegen Militarismus, Imperialismus und imperialistische Kriege war und ist. Rechtzeitig hatte sie vor dem Faschismus gewarnt, hatte sie vorausgesagt, daß Hitier das deutsche Volk in den Krieg stürzen wird, wenn es ihm nicht in den Arm fällt. Obwohl die KPD den Faschismus mit allem Einsatz und unter größten Opfern bekämpft hatte, sprach sie in ihrem Aufruf auch offen über eigene Versäumnisse und Fehler, die die Schaffung der antifaschistischen Einheitsfront behindert hatten.
Die leidenschaftliche Anklage gegen den Krieg und seine Verursacher gipfelte in der Forderung, den Neuaufbau Deutschlands so zu vollziehen, daß „eine dritte Wiederholung der imperialistischen Katastrophenpolitik unmöglich wird“. Aus ihrem Friedensbekenntnis zog die KPD den Schluß, nun unbedingt die Einheit des schaffenden Volkes zu verwirklichen. Sie schlug vor, gemeinsam für die „Aufrichtung eines antifaschistischen, demokratischen Regimes, einer parlamentarisch-demokratischen Republik mit allen demokratischen Rechten und Freiheiten für das Volk“ zu kämpfen.??
In zehn Punkten umriß die KPD die dringendsten, unmittelbaren Aufgaben und charakterisierte damit zugleich die Grundlagen und Wesenszüge der zu schaffenden neuen Republik. Sie forderte: vollständige Liquidierung der Überreste des Hitlerregimes, restlose Säuberung aller öffentlichen Ämter von aktiven Nazis, strenge Bestrafung der Kriegsund Naziverbrecher; Kampf gegen Hunger, Arbeitslosigkeit und Obdachlosigkeit, allseitige Unterstützung der Verwaltungsorgane bei der Normalisierung des Lebens, ungehinderte Entfaltung des freien Handels und der privaten Unternehmerinitiative; Wiederaufbau der zerstörten Schulen, Wohnund Arbeitsstätten; restlose Einbringung der Ernte und gerechte Verteilung der Lebensmittel und Verbrauchsgegenstände, energischer Kampf gegen Spekulation; Herstellung demokratischer Rechte und Freiheiten für das Volk, Legalität der Gewerkschaften und der antifaschistisch-demokratischen Parteien, demokratische Erneuerung der Justiz, des Erziehungsund Bildungswesens, Freiheit der wissenschaftlichen Forschung und künstlerischen Gestaltung; Aufbau demokratischer Verwaltungsorgane und der Landtage; Schutz der Werktätigen gegen Unternehmerwillkür und tarifliche Regelung der Lohnund Arbeitsbedingungen; Enteignung des gesamten Vermögens der Nazibonzen und Kriegsverbrecher und dessen Übergabe in die Hände des Volkes; Liquidierung des Großgrundbesitzes und Übergabe von Boden und Inventar an werktätige Bauern; Übergabe lebenswichtigen Bedürfnissen dienender und verlassener Betriebe an die demokratischen Verwaltungen; friedliches und gutnachbarliches Zusammenleben mit anderen Völkern, entschiedener Bruch mit der Politik der Aggression und der Gewalt gegenüber anderen Völkern; Anerkennung der Pflicht zur Wiedergutmachung und gerechte Verteilung der sich daraus ergebenden Lasten auf die verschiedenen Schichten der Bevölkerung.
Mit diesen Forderungen richtete die KPD den Hauptstoß gegen Faschismus und Militarismus sowie gegen Monopolkapital und Großgrundbesitz als deren Verursacher und stellte sie friedenssichernde Maßnahmen in den Vordergrund. Der Aufruf beinhaltete kein Programm der sozialistischen Umgestaltung, sondern das einer antifaschistisch-demokratischen, antiimperialistischen Umwälzung. Ausgehend von der Leninschen Revolutionstheorie konzentrierte die Partei ihre Aufmerksamkeit vor allem auf die nächstliegenden Schritte. Wenn es gelang, im Ringen um die Liquidierung aller Überreste des Faschismus die Hegemonie der Arbeiterklasse zu verwirklichen und die sozialen Wurzeln imperialistischer Machtund Eroberungspolitik zu beseitigen, war auch ein günstiger Boden für das Hinüberleiten der demokratischen in die sozialistische Umwälzung gewonnen. Dafür sprachen die Lehren der Novemberrevolution und die Erfahrungen dreier russischer Revolutionen. In dieser Richtung entwickelten sich die volksdemokratischen Revolutionen in Ostund Südosteuropa.
Eine solche Orientierung bot auch die beste Gewähr, um die sich aus der Klassensituation und der konkreten Lage einzelner Klassen und Schichten in Nachkriegsdeutschland ergebenden Bündnismöglichkeiten für das Ringen der Arbeiterklasse um Frieden, Demokratie und Sozialismus voll auszuschöpfen. Die KPD hatte sowohl die gemeinsamen Anliegen aller antifaschistisch-demokratischen Kräfte formuliert als auch Forderungen einzelner Klassen und Schichten aufgegriffen, Erwartungen der Arbeiterklasse, kleinbürgerlicher Schichten, der Bauernschaft und kleiner und mittlerer Unternehmer.
Das mit dem Aufruf vom 11.Juni 1945 unterbreitete Aktionsprogramm betrachtete die KPD als Vorschlag für das gemeinsame Handeln aller Antifaschisten. Sie empfahl es als Diskussionsplattform für die Schaffung eines Blocks aller antifaschistisch-demokratischen Parteien.
Obwohl sich die KPD der unterschiedlichen Gegebenheiten, die Kommunisten und andere Antifaschisten in den einzelnen Besatzungszonen vorfanden, bewußt war, verfolgte sie das Ziel, Imperialismus und Militarismus in ganz Deutschland zu überwinden. Sie strebte unter allen Besatzungsbedingungen die Aktionseinheit der Arbeiterklasse und das Bündnis aller Antifaschisten und Demokraten an. Mit ihren antifaschistisch-demokratischen Forderungen befand sie sich in Übereinstimmung mit den von den alliierten Mächten, insbesondere in der Deklaration der Krimkonferenz, niedergelegten Grundsätzen der konsequenten Beseitigung des deutschen Faschismus und Militarismus. Nur die Entfaltung einer breiten antifaschisten Bewegung, die sich mit den erklärten Zielen der Anti-Hitler-Koalition in Einklang befand, eröffnete die Möglichkeit, den der nationalen Einheit drohenden Gefahren entgegenzuwirken und Deutschland als einheitlichen, friedliebenden, demokratischen Staat neu entstehen zu lassen.
Die Formierung der legalen KPD und deren Entwicklung zur Massenpartei
Parallel zum Aufruf vom 11. Juni 1945 hatte die KPD auch einen Beschluß über die ersten organisationspolitischen Aufgaben erarbeitet. Er legte fest: „1. Organisierung und Durchführung einer breiten Kampagne a) für die Popularisierung des Aufrufs der KPD; b) für den Aufbau der Partei in den Bezirken; c) für die Schaffung des Blockes der antifaschistischen Parteien; d) für die Schaffung freier Gewerkschaften. 2. Herausgabe des Zentralorgans und der Bezirkszeitungen der KPD. 3. Organisierung der Arbeit der Parteiführung auf allen Arbeitsgebieten. 4. Vorbereitung der Parteikonferenz für die Wahl des ZK.“23
Die Verbreitung des Aufrufs vom 11. Juni 1945 wurde für die nun wieder legale KPD zur ersten groBen Bewährungsprobe. Bereits in den ersten Tagen nach seinem Erscheinen fanden in Berlin, in der Mark Brandenburg, in Mecklenburg und in Sachsen zahlreiche Versammlungen statt, in denen kommunistische Funktionäre die Ziele und Vorschläge der KPD erläuterten. Am 12. Juni 1945 begründete Walter Ulbricht im Berliner Stadthaus vor Vertretern der KPD, der SPD und früherer bürgerlicher Parteien den Aufruf. Das von der KPD vorgeschlagene Aktionsprogramm, so erklärte er, „könnte der Einigung aller antifaschistischen Parteien zu einem Block des gemeinsamen Kampfes zur Vernichtung des Nazismus und zum Aufbau eines demokratischen Deutschlands dienen“.
Wie die ersten Parteiversammlungen der KPD belegen, fand die politische Linie des Aufrufs in der Regel die volle Zustimmung der Teilnehmer. Doch nicht alle besaßen Kenntnis der seit 1933 von der Partei vorgenommenen Weiterentwicklung der Strategie und Taktik. In den letzten Kriegsjahren hatten viele Parteimitglieder ihre Kontakte verloren und waren unzureichend informiert. Manche lebten auch noch in den durch die Klassenkämpfe der Weimarer Republik geprägten Vorstellungen. Das führte zu Fragen und Diskussionen, die das strategische Ziel der Partei betrafen, das Verhältnis des Kampfes um Demokratie zum Ringen um den Sozialismus, die Stellung zu den Sozialdemokraten und zu den bürgerlich-demokratischen Parteien. Charakteristisch war, daß derartige Probleme geklärt wurden und daß sich alle Mitglieder der KPD auf dem Boden der vom Zentralkomitee verkündeten politischen Linie zusammenfanden und sofort mit der praktischen Arbeit begannen.
Vorrangig galt es, den Wortlaut des Aufrufs den Werktätigen nahezubringen. Dazu trugen Sendungen des Rundfunks bei. Viele erreichte der Aufruf über die in der sowjetischen Besatzungszone nun wieder erscheinende kommunistische Tagespresse und die von sowjetischen Organen für die deutsche Bevölkerung herausgegebenen Zeitungen. Er wurde als Plakat angeschlagen und als Flugblatt verbreitet. Eine Reihe Parteileitungen organisierten den Nachdruck, um der großen Nachfrage gerecht zu werden.
So fand das Aktionsprogramm der KPD auch seinen Weg in die westlichen Besatzungszonen. Auch hier sammelten sich die Kommunisten und handelten sie gemäß den Orientierungen ihres Zentralkomitees. Die noch in Moskau weilenden Kommunisten wurden durch Wilhelm Pieck mit dem Aufruf vertraut gemacht, und bald hatte dieser auch die Parteiorganisationen der KPD in Exilländern des Westens erreicht. Selbst in Kriegsgefangenenlager gelangte er. Es bedeutete eine große Unterstützung für die deutschen Kommunisten, daß sowjetische Presseorgane die Politik der KPD international und unter den Soldaten und Offizieren ihrer Besatzungstruppen bekanntmachten.
Mit der Verbreitung des Aufrufs vom 11. Juni 1945 war die Konstituierung der legalen Parteiorganisationen der KPD eng verbunden. Im Juni und Juli 1945 wählten oder beriefen zahlreiche Betriebs-, Stadtteil-, Orts-, Kreisund Bezirksorganisationen der KPD ihre neuen Leitungen. Die ersten neuen Mitglieder wurden aufgenommen, zunächst vorwiegend Werktätige, die früher kommunistischen Massenorganisationen angehört hatten, Jugendliche aus kommunistischen Elternhäusern, Werktätige, die an der Seite der Kommunisten gegen den Faschismus gekämpft hatten. Tausende Sozialdemokraten, die sich enttäuscht vom Kurs ihrer Führung von der SPD abgewandt hatten, suchten in der KPD eine neue politische Heimat und sahen in ihr die Basis für die Schaffung einer einheitlichen Arbeiterpartei. Auch Werktätige, die kommunistischen Splittergruppen gefolgt waren, fanden vielfach zur KPD zurück.
Schon bald setzte ein großer Zustrom neuer Kräfte zur KPD ein. Das waren Männer, Frauen und Jugendliche, die sich von dem aktiven Handeln, von der optimistischen Haltung und den einleuchtenden Zielen der Kommunisten angezogen fühlten. Die KPD war darauf vorbereitet, diese Werktätigen in ihre Reihen aufzunehmen. Sie erwartete von ihnen nur, daß sie nicht faschistisch belastet waren, daß sie die im Aufruf vom 11. Juni niedergelegte politische Linie anerkannten, an der Verwirklichung der Parteibeschlüsse aktiv mitwirkten und ihrer Beitragspflicht nachkamen.
Natürlich erwuchs den Parteileitungen eine hohe Verantwortung, daß sich nicht faschistische oder andere unsaubere Elemente in die KPD einschlichen. Ein reges innerparteiliches Leben und eine intensive Schulungstätigkeit halfen den in großer Zahl zur KPD kommenden Werktätigen, den Anforderungen an einen Kommunisten gerecht zu werden.
Im August 1945 hatte die KPD in der sowjetischen Besatzungszone jene Mitgliederzahl annähernd wiedererreicht, die die früheren Bezirksparteiorganisationen dieses Territoriums 1932/33 aufgewiesen hatten: rund 100000. Bis Oktober verdoppelte sie hier ihren Mitgliederstand. Die KPD entwickelte sich zu einer mitgliederstarken, in allen Schichten des werktätigen Volkes verankerten kommunistischen Massenpartei.
Am 1.Juli 1945 kehrte Wilhelm Pieck nach zwölf Jahren Exil in die Heimat zurück. Er übernahm die Leitung des Sekretariats des Zentralkomitees, dem außer ihm Anton Ackermann, Franz Dahlem und Walter Ulbricht angehörten. Zu den engsten Mitarbeitern dieses vorbildlich arbeitenden kollektiven Führungsorgans gehörten in der Anfangsperiode Gustav Gundelach als Mitarbeiter für die Anleitung der Parteiorganisationen in den westlichen Besatzungszonen, Richard Gyptner als Sekretär des Sekretariats, Sepp Hahn als Geschäftsführer, Erich Honecker als Jugendsekretär, Alfred Oelßner als Hauptkassierer, Fred Oelßner als Leiter der Abteilung Agitation und Propaganda, Elli Schmidt als Frauensekretärin. Etwas später kam Bruno Leuschner als Leiter der Wirtschaftsabteilung hinzu.
Zügig, doch durch den Mangel an erfahrenen Kadern beeinträchtigt, erfolgte der Aufbau des Apparates des Zentralkomitees und der Bezirksund Kreisleitungen. Ab Juli erschienen die ersten Bezirkszeitungen der KPD. Am 30. Juli 1945 nahm der Verlag Neuer Weg, der Parteiverlag der KPD, seine Tätigkeit auf. Ab Juli wurde auch begonnen, regelmäßige Schulungen durchzuführen, für die das Zentralkomitee Vortragsdispositionen herausgab.
Die KPD schuf sich mit all dem die Voraussetzungen, um gut organisiert und mit einem klaren Aktionsprogramm ausgerüstet die Initiative beim demokratischen Neuaufbau zu übernehmen.
Neubeginn der Sozialdemokratie
Im Juni 1945 waren in zahlreichen Städten der sowjetischen Besatzungszone Vorbereitungen zum Aufbau sozialdemokratischer Parteiorganisationen im Gange. Die Mehrzahl der Sozialdemokraten waren willens, ihren Beitrag zum demokratischen Neuaufbau zu leisten, bei dem sich die Möglichkeit bot, traditionelle politische und soziale Ziele der Arbeiterbewegung zu verwirklichen. Als der Aufruf des Zentralkomitees der KPD vom 11.Juni 1945 bekannt wurde, billigten viele Sozialdemokraten dieses Aktionsprogramm, zu dem sie sich keine sozialdemokratische Alternative vorstellen konnten. Häufig hielten sich gerade die als erste aktiv werdenden Sozialdemokraten an ihre besser informierten und klarer sehenden kommunistischen Klassengenossen. Mitunter zeigten sie wenig Neigung, eigene Parteiorganisationen aufzubauen. Nicht selten waren es Kommunisten, die den Anstoß gaben, daß die organisatorischen Vorbereitungen zur Konstituierung sozialdemokratischer Parteiorganisationen intensiviert wurden.
Die meisten Sozialdemokraten erwarteten, daß in der ehemaligen Reichshauptstadt Berlin, dem Sitz ihres früheren Parteivorstandes, das Signal für den Wiederaufbau ihrer Partei gegeben werde. Bei Erlaß des Befehls Nr. 2 der SMAD befand sich die Herausbildung eines neuen sozialdemokratischen Führungszentrums gerade in ihrer abschließenden Phase. Seit Mai 1945 hatten in Berlin zunächst getrennt voneinander und dann im gegenseitigen Kontakt Gruppen sozialdemokratischer Funktionäre Vorbereitungen auf die Wiederzulasssung der SPD getroffen. Am 11. Juni 1945 konstituierte sich der Zentralausschuß der SPD. Für ihn war charakteristisch, daß er sich vornehmlich aus Funktionären der zweiten Reihe zusammensetzte, während Parteiführer, die vor 1933 die sozialdemokratische Politik bestimmt hatten, ihm nicht angehörten.
Die Neuorientierung der Sozialdemokratie, die von der neuen Führung angestrebt wurde, fand ihren Ausdruck im Aufruf des Zentralausschusses vom 15. Juni 1945. Dieses Dokument widerspiegelte einen Prozeß des Umdenkens, der wesentlich von dem klassenkämpferischen, sich marxistischem Gedankengut zuwendenden Flügel der SPD beeinflußt war. Unterzeichnet hatten den Aufruf Max Fechner, Erich W. Gniffke, Otto Grotewohl, Gustav Dahrendorf, Karl Germer jun., Bernhard Göring, Hermann Harnisch, Helmut Lehmann, Karl Litke, Otto Meier, Fritz Neubecker, Josef Orlopp, Hermann Schlimme und Richard Weimann. Das waren wie die spätere Entwicklung erweisen sollte in ihrer Mehrheit die Einheit der Arbeiterklasse und eine revolutionäre Politik bejahende Arbeiterfunktionäre.
Unter der Überschrift „Vom Chaos zur Ordnung“ legte der Zentralausschuß der SPD in dem Aufruf seine Vorstellungen von der antifaschistisch-demokratischen Umgestaltung Deutschlands dar. Auch er appellierte an das deutsche Volk, nicht zu verzweifeln, sondern Lehren zu ziehen und „durch unermüdliche Arbeit und eisernen Willen die Achtung aller friedlichen, freiheitliebenden Völker zu erwerben“.25 Er forderte die „völlige Beseitigung aller Reste der faschistischen Gewaltherrschaft“ und die Errichtung „einer neuen, antifaschistisch-demokratischen Republik“26 In neun Punkten faßte der Zentralausschuß in Anlehnung an das Zehnpunkteprogramm im Aufruf der KPD die dringlichsten Aufgaben zusammen. Dieser Katalog von Forderungen reichte von der Wiederingangsetzung der Wirtschaft und der Wiederherstellung der Rechte der Bürger über die sozialen Belange der Werktätigen bis zur Verstaatlichung der Banken, Versicherungsunternehmen, Bodenschätze, Bergwerke und der Energiewirtschaft. Mit Sicht auf das Scheitern der Weimarer Republik erklärte der Zentralausschuß: „In einer antifaschistisch-demokratischen Republik können demokratische Freiheiten nur denen gewährt werden, die sie vorbehaltlos anerkennen. Demokratische Freiheiten sind aber denen zu versagen, die sie nur nutzen wollen, um die Demokratie zu schmähen und zu zerschlagen.“ 27
Diese ihrem Charakter nach antiimperialistisch-demokratischen Forderungen waren mit der in sich widersprüchlichen Losung verbunden: „Demokratie in Staat und Gemeinde, Sozialismus in Wirtschaft und Gesellschaft“?28. Die Trennung von Politik und Ökonomie, die in dieser Formulierung zum Ausdruck kam, zeigte, daß im Zentralausschuß fehlerhafte theoretische Ansichten noch nicht überwunden waren und daß es noch an einem dialektischen Verständnis für den Zusammenhang zwischen dem Kampf um Demokratie und dem um Sozialismus, für das Hinüberwachsen der demokratischen in die sozialistische Revolution fehlte.
Ausdrücklich begrüßte der Zentralausschuß der SPD den Aufruf der KPD vom 11. Juni 1945, wobei er dessen Orientierung auf eine parlamentarisch-demokratische Republik mit allen Rechten und Freiheiten für das werktätige Volk hervorhob. In dieser Übereinstimmung sah der Zentralausschuß auch die Grundlage für die Überwindung der Spaltung der Arbeiterbewegung. Er erklärte: „Wir wollen vor allem den Kampf um die Neugestaltung auf dem Boden der organisatorischen Einheit der deutschen Arbeiterklasse führen! Wir sehen darin eine moralische Wiedergutmachung politischer Fehler der Vergangenheit, um der jungen Generation eine einheitliche politische Kampforganisation in die Hand zu geben.“29 Doch blieb ungenannt, wo diese Fehler in der eigenen Politik zu suchen waren und mit welchem Erbe opportunistischer Politik der SPD unbedingt gebrochen werden mußte.
Als der Aufruf des Zentralausschusses erschien, waren über die außenpolitische Orientierung der SPD noch Diskussionen im Gange. Deren Ergebnisse fanden ihren Niederschlag in einer am 20. August 1945 verabschiedeten, nicht für die Veröffentlichung bestimmten Stellungnahme. In ihr hieß es: „Die deutsche Arbeiterklasse muß in weltpolitischen Machtfragen die Partei desjenigen ergreifen, dem der Friede Zweck und nicht Mittel der Politik ist. Das ist trotz ihrer Unterschrift unter Friedensdokumente bei einer kapitalistisch-imperialistischen Weltmacht nicht der Fall. Sie ergreift die Partei derjenigen Weltmacht, deren Struktur den Faschismus als kriegerische Organisationsform einer Nation ausschließt. Bei einer Wahl zwischen der Sowjet-Union und den USA ist das die Sowjet-Union.“30
So verdeutlichten die ersten Äußerungen des Zentralausschusses, daß diese neue Führung der SPD be‚deutsame Schlußfolgerungen für den weiteren Weg der Sozialdemokratie gezogen hatte. Dennoch war die innere Differenziertheit der SPD nicht zu übersehen. Anders als die KPD war sie nicht mit einem über Jahre hinweg erarbeiteten und ständig präzisierten programmatischen Konzept, einer allseits anerkannten Führung und einem festen Kern von Parteiorganisationen aus der Illegalität hervorgetreten. Die organisatorische Zersplitterung und ideologische Zerrissenheit der SPD hatten in den letzten Jahren der faschistischen Diktatur ein solches Ausmaß erreicht, daß die Sozialdemokratie jener Zeit zwar als politische Strömung, nicht aber als kämpfende politische Partei im eigentlichen Sinne des Wortes bezeichnet werden konnte. Doch waren die sozialdemokratischen Traditionen und das Gefühl der Zusammengehörigkeit hinreichend stark, um bei Wiedererlangung politischer Bewegungsfreiheit kurzfristig einen Neuaufbau der Partei zu ermöglichen. Angesichts der Tatsache, daß die SPD, hineingestellt in die einsetzende antifaschistisch-demokratische Umwälzung, wie alle politischen Kräfte nahezu täglich schwerwiegende Entscheidungen zu treffen hatte, waren das Hervortreten der revolutionär-proletarischen Klassenlinie einerseits und das der opportunistisch-bürgerlichen andererseits in ihrer Theorie und Praxis unausbleiblich. Die Mehrheit der Mitglieder, die es gewohnt waren, den Weisungen des Parteivorstandes zu folgen, sahen sich unterschiedlichen Standpunkten und Aktivitäten ihrer Führer gegenübergestellt.
Das Neue bestand in einer Verschiebung des Kräfteverhältnisses innerhalb der SPD. Klassenkämpferisch-proletarisch denkende und handeinde Sozialdemokraten traten stark hervor und dominierten im Zentralausschuß wie in den regionalen und lokalen Parteiorganisationen. In ihrer Politik lebten die Einsichten fort, die 1934 im „Prager Manifest“ formuliert worden waren, in dem sich die SPD eindeutig für eine revolutionäre Entscheidung der Machtfrage zugunsten der Arbeiterklasse und für eine geeinte revolutionäre Kampfpartei ausgesprochen hatte. Viele Sozialdemokraten waren zu der Schlußfolgerung gelangt, daß es kein Zurück zur Weimarer Demokratie geben dürfte, deren Schoß der Faschismus entsprungen war. Unter der von ihnen geforderten neuen, demokratischen Republik verstanden sie einen Staat, in dem die Arbeiterklasse bestimmenden Einfluß ausübt. Sie verlangten eine Rückbesinnung auf die marxistischen Traditionen der deutschen Sozialdemokratie und auf deren streitbaren Charakter. Aufrichtig erstrebten sie ein neues Verhältnis zu den Kommunisten und zur Sowjetunion. Mit diesen Erkenntnissen waren sie den Ansichten der KPD, die ebenfalls einen Lernprozeß durchlaufen hatte, nahegekommen, so daß eine enge Aktionsgemeinschaft beider Arbeiterparteien möglich wurde.
Auch viele Sozialdemokraten, die traditionelle : Ziele und Wege des Reformismus bejahten, setzten sich als Antifaschisten für die konsequente Überwindung aller Überreste des Nazismus und für die Interessen der Werktätigen ein. Damit konnten auch einer früheren reformistischen Praxis entnommene sozialdemokratische Losungen wie Sozialisierung der Industrie, Wirtschaftsplanung, Siedlungsmaßnahmen auf Großgrundbesitzerland oder Demokratisierung des Bildungswesens einen neuen Inhalt gewinnen. Doch hatte reformistisches Denken bei vielen Sozialdemokraten auch zu Vorstellungen geführt, mit denen tiefgreifende Veränderungen der politischen, ökonomischen und kulturellen Verhältnisse nicht zu erreichen waren. Mit einem Demokratieverständnis, das sich ausschließlich in den Bahnen des bürgerlichen Parlamentarismus bewegte, ließ sich die für revolutionäre Umgestaltungen notwendige Hegemonie der Arbeiterklasse nicht erringen.
Wieder aktiv wurden auch Führer der SPD, die auf eine Integration der Arbeiterbewegung in die bürgerliche Gesellschaft hinarbeiteten. Für sie hatte der Hauptfehler sozialdemokratischer Politik darin bestanden, daß sich die SPD nicht noch enger mit dem Staat der Weimarer Republik verbunden hatte, dessen monopolkapitalistische Grundlage und dessen von der Reaktion gesteuerten Machtmechanismus sie übersahen oder falsch einschätzten. Sie wollten nunmehr einen sozialdemokratischen Führungsanspruch durchsetzen, indem sie die SPD als eine den bürgerlich-parlamentarischen Staat bejahende Partei profilierten. Wenn auch sie vom Sozialismus sprachen, blieb stets die wichtigste Voraussetzung des Sozialismus die politische Macht der Arbeiterklasse ausgeklammert. Statt sich auf den Marxismus zu besinnen, dachten sie an eine weitgehende weltanschauliche Öffnung der Sozialdemokratie. Eine Einheit der Arbeiterbewegung konnten sie sich nur als Aufgehen der Kommunisten in einer sozialdemokratischen Partei vorstellen. Eine Reihe dieser Funktionäre standen in Kontakt zu linksbürgerlichen Kräften und zu Vertretern der christlichen Arbeiterbewegung, wobei Fusionen im Gespräch waren, mit denen ein antikommunistischer Block der Mitte geschaffen werden sollte.
Diese gegensätzlichen Ansätze sozialdemokratischer Politik existierten jedoch nicht in scharfer Abgrenzung voneinander, und die Masse der sozialdemokratischen Mitglieder war weder der einen noch der anderen Richtung eindeutig zuzurechnen. Sie war für eine progressive Politik im Interesse der Werktätigen, war bereit, mit den Kommunisten zusammenzuarbeiten, bejahte die Einheit der Arbeiterklasse, ohne sich der damit verbundenen prinzipiellen theoretischen wie praktischen Probleme bereits bewußt zu sein. Sie erwartete eine klare Orientierung von ihrer Führung, doch lernte sie vor allem aus den eigenen praktischen Erfahrungen.
Im ganzen machte der Neuaufbau der SPD, nachdem ein anfängliches Zögern überwunden war, rasche Fortschritte. Der Zentralausschuß übernahm zunächst auch die Leitung der Berliner Parteiorganisation. Ende Juli 1945 wurde ein gesonderter Bezirksvorstand für Berlin gebildet. Entsprechend dem im Juni 1945 beschlossenen Organisationsstatut der SPD konstituierten sich Bezirksverbände. In ihrer Struktur knüpfte die SPD vorerst an die territoriale Einteilung der Parteiorganisation zur Zeit der Weimarer Republik an, ab September 1945 paßte sie sich der administrativen Gliederung der sowjetischen Besatzungszone an: Grundorganisationen waren die Ortsvereine, die durch den Bezirksvorstand in Unterbezirke zusammengefaßt werden konnten.
Der Aufbau der sozialdemokratischen Landesund Bezirksorganisationen erfolgte in den Monaten Juli und August relativ unabhängig von der zentralen Führung in Berlin und fand im September und Oktober 1945 mit der Durchführung von Landesbzw. Bezirksparteitagen seinen vorläufigen Abschluß.
In den Ortsvereinen sammelten sich zum größten Teil Werktätige, die der SPD bereits vor 1933 angehört und sich über die faschistische Diktatur hinweg ihre politische Überzeugung bewahrt hatten. Bis September wuchs die Mitgliederzahl in der sowjetischen Besatzungszone auf etwa 250000 an. Hingegen blieb der Zustrom neuer Mitglieder, vor allem aus den Reihen der Jugend, gering. Daraus resultierte eine Überalterung der Partei. Zu den Sozialdemokraten der Westzonen vermochte der Zentralausschuß nur vereinzelt Kontakte zu knüpfen, obwohl es auch dort nicht wenige Parteiorganisationen für selbstverständlich hielten, daß die Initiative zum Wiederaufbau der SPD von Berlin ausging. Nachdem seit 7. Juli 1945 „Das Volk“ als Tageszeitung der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands erschien, begann im September und Oktober 1945 auch die Herausgabe von mehrmals wöchentlich erscheinenden Parteizeitungen für die Länder und Provinzen der sowjetischen Besatzungszone. Der sozialdemokratische Parteiverlag „Das Volk“ nahm Anfang Juli 1945 seine Arbeit auf.
So hatte die SPD die von der SMAD gebotene Möglichkeit politischer Betätigung erfolgreich genutzt. An der Seite der KPD setzte sie sich aktiv für antifaschistisch-demokratische Umgestaltungen ein.
Unter den Mitgliedern des Zentralausschusses profilierte sich Otto Grotewohl zur führenden Persönlichkeit. Der gelernte Buchdrucker hatte sich schon in früher Jugend in der Arbeiterbewegung organisiert und in den Kämpfen der Novemberrevolution und zur Abwehr des Kapp-Putsches seine ersten revolutionären Erfahrungen gesammelt. Nach vorübergehender Mitgliedschaft in der USPD war er zur SPD zurückgekehrt. Während seiner Tätigkeit als Parteifunktionär, als Minister des Freistaates Braunschweig und als Reichstagsabgeordneter war ihm bewußt geworden, wie eng die Schranken sozialdemokratischer Reformpolitik unter den Bedingungen des bürgerlichen Parlamentarismus gezogen waren. Obwohl ihn die Faschisten wiederholt maßregelten und vorübergehend verhafteten, hatte er seine antifaschistische Tätigkeit fortgesetzt. Nun stellte er seine große politische Begabung in den Dienst der neuerstandenen SPD, setzte er sich mit seiner ganzen Person für die Einheit der Arbeiterbewegung und für die antifaschistisch-demokratische Erneuerung des Landes ein.
Herausbildung des Freien Deutschen Gewerkschaftsbundes
Ende Mai 1945 bildete sich in Berlin auf Initiative der KPD ein Gremium zur Vorbereitung eines einheitlichen Gewerkschaftsbundes. Zu dieser Zeit hatten auch in anderen Zentren der Arbeiterbewegung Kommunisten und Sozialdemokraten mit der Organisierung einer neuen Gewerkschaftsbewegung begonnen. Bei aller lokalen Vielfalt gingen sie überall davon aus, daß die Spaltung der Gewerkschaftsbewegung überwunden und ein einheitlicher Gewerkschaftsbund geschaffen werden mußte. Vorherrschend war die Auffassung, daß die Gewerkschaften an der Seite der Arbeiterparteien einen gewichtigen Beitrag zur Errichtung einer antifaschistischen Demokratie zu leisten hatten.
Im Vorbereitenden Gewerkschaftsausschuß für Groß-Berlin berieten Vertreter der bedeutendsten früheren Gewerkschaftsrichtungen des Allgemeinen Deutschen Gewerkschaftsbundes, der Revolutionären Gewerkschaftsopposition, der Christlichen Gewerkschaften und der Hirsch-Dunckerschen Gewerkvereine über einen Gründungsaufruf, für den die Kommunisten einen Entwurf unterbreitet hatten. Sie diskutierten vor allem über den Charakter, den die neuen Gewerkschaften haben sollten. Die Vertreter der KPD waren bemüht, alle davon zu überzeugen, daß die Gewerkschaften sich nicht damit begnügen durften, soziale Belange der Werktätigen zu vertreten, bloßer Tarifpartner zu sein. Sie sollten darüber hinaus als Klassenorganisation der Werktätigen Mitverantwortung für die gesamte antifaschistisch-demokratische Umgestaltung übernehmen. Zu Auseinandersetzungen kam es um die Einschätzung des 1. Mai 1933 und damit um die Bewertung der Rolle jener rechten Gewerkschaftsführer, die damals zur Beteiligung an den nazistischen Maifeiern aufgerufen hatten. Man einigte sich schließlich, den 1. Mai 1933 als den „schwärzesten Tag in der Geschichte der Arbeiterbewegung“31 zu charakterisieren.
Mitte Juni lag ein von allen Seiten akzeptierter Gründungsaufruf vor. Ihn unterzeichneten als Vertreter des früheren Allgemeinen Deutschen Gewerkschaftsbundes Otto Brass, Bernhard Göring und Hermann Schlimme, als Vertreter der ehemaligen Revolutionären Gewerkschaftsopposition Roman Chwalek, Hans Jendretzky und Paul Walter, von seiten der früheren Christlichen Gewerkschaften Jakob Kaiser und von seiten der ehemaligen HirschDunckerschen Gewerkvereine Ernst Lemmer.
Der Aufruf verwies auf die verheerenden Folgen der faschistischen Tyrannei und enthielt die Feststellung, daß Spaltung und Unentschlossenheit die demokratischen Kräfte gehindert hatten, den Faschisten den Weg zu verlegen. Er würdigte die Befreiertat der Roten Armee. Die hohe Verantwortung der neuen Gewerkschaften wurde mit den Worten umrissen: „Die neuen freien Gewerkschaften sollen unter Zusammenfassung aller früheren Richtungen in ihrer Arbeit eine Kampfeinheit zur völligen Vernichtung des Faschismus und zur Schaffung eines neuen, demokratischen Rechts der Arbeiter und Angestellten werden … Sie sollen mithelfen, ein demokratisches Deutschland, das in Frieden und Freundschaft mit den anderen Völkern leben will, zu schaffen.“ ?
In vier Punkten orientierte der Aufruf auf die dringlichsten Aufgaben der freien Gewerkschaften: Kampf gegen die faschistische Ideologie und Säuberung der Verwaltungen und Betriebe von aktiven Nazis; Einsatz aller Arbeitskräfte für den Wiederaufbau und rasches Ingangsetzen aller Versorgungsbetriebe, der Energiewirtschaft und des Verkehrs; demokratische Mitbestimmung der Werktätigen, Wiederaufbau der Sozialversicherung und Gewährleistung des Arbeitsschutzes; Erziehung der Arbeiterschaft im Geiste des Antifaschismus, zum Verständnis ihrer sozialen Lage, zur Verbundenheit mit den Arbeitern anderer Länder und zur Völkerfreundschaft.
Der Aufruf, der das Datum 15. Juni 1945 trug, wurde am 17. Juni im Berliner Neuen Stadthaus auf einer Konferenz mit fast 600 Teilnehmern bekanntgegeben. Er erlangte programmatische Bedeutung weit über die Berliner Gewerkschaftsorganisationen hinaus und wurde zur Geburtsurkunde des Freien Deutschen Gewerkschaftsbundes (FDBG). Er leitete eine neue Stufe gewerkschaftlichen Kampfes ein. Die Gewerkschaften wurden zu einer tragenden Kraft bei der Neugestaltung des gesellschaftlichen Lebens. Die Überwindung ihrer Aufsplitterung in verschiedene Richtungen war eine der grundlegenden Voraussetzungen für die Hegemonie der Arbeiterklasse in der antifaschistisch-demokratischen Umwälzung. Der organisatorische Aufbau der neuen Gewerkschaftsbewegung erfolgte nach dem Prinzip „Ein Betrieb eine Gewerkschaft“. Das verhalf den Gewerkschaften zu maßgeblichem Einfluß in den Produktionsstätten und in den verschiedensten Institutionen. Innerhalb weniger Wochen entstanden vielerorts Gewerkschaftsorganisationen. Zugleich wurde mit dem Aufbau der Industriegewerkschaften begonnen.
Die raschen Fortschritte bei der Herausbildung des Freien Deutschen Gewerkschaftsbundes zeugten davon, daß der Faschismus die Traditionen gewerkschaftlichen Kampfes nicht auszulöschen vermocht hatte. Es waren vor allem die älteren Facharbeiter, die nun ihre Erfahrungen gewerkschaftlichen Kampfes in die sich neu formierende Bewegung einbrachten. Wenngleich in zwölf Jahren faschistischer Diktatur bei nicht wenigen Werktätigen das Klassenbewußtsein verschüttet worden war, erwies sich doch jetzt, nachdem sie ihre Bewegungsfreiheit wiedergewonnen hatte, die Fähigkeit der Arbeiterklasse, ihre Interessenvertretungen sofort aufzubauen. Die Erfolge der Gewerkschaftsbewegung waren wesentlich dem gemeinsamen Vorgehen von Kommunisten und Sozialdemokraten zu danken. Sie bewiesen die Möglichkeit gemeinsamen Handelns von KPD und SPD. Die konstruktive Zusammenarbeit in den Gewerkschaften wirkte ihrerseits auf die Aktionseinheit beider Parteien zurück.
Das Aktionsabkommen KPD/SPD und die Entfaltung der Aktionseinheit
Nachdem KPD und SPD ihre Tätigkeit als legale Arbeiterparteien aufgenommen und in Aufrufen ihre Standpunkte und Forderungen dargelegt hatten, waren: die Voraussetzungen gegeben, um durch ein Abkommen der Parteiführungen die Zusammenarbeit auf eine feste Grundlage zu stellen. So erging am 13. Juni 1945 eine Einladung des Zentralkomitees der KPD an den Zentralausschuß der SPD, in dem eine gemeinsame Beratung vorgeschlagen wurde. Diese fand bereits am folgenden Tag statt und führte zur Bildung eines zentralen Gemeinsamen Arbeitsausschusses.
In dem am 19. Juni 1945 unterzeichneten Aktionsabkommen vereinbarten KPD und SPD folgende gemeinsame Aufgaben: Zusammenarbeit bei der Liquidierung aller Überreste des Faschismus, beim Wiederaufbau des Landes und bei der Errichtung einer antifaschistischen, demokratisch-parlamentarischen Republik, bei der Bildung eines Blocks aller antifaschistisch-demokratischen Parteien, bei der Vertretung der Interessen der Werktätigen. Vorgesehen wurden gemeinsame Veranstaltungen und die gemeinsame Beratung ideologischer Fragen. Beide Parteien drückten ihren festen Willen aus, „alles zu tun, um auf dem Wege guter Zusammenarbeit in allen Fragen des antifaschistischen Kampfes und des Wiederaufbaues die Voraussetzungen für die politische Einheit des werktätigen Volkes zu schaffen“.”” Das Abkommen trug die Unterschriften von Walter Ulbricht, Anton Ackermann, Ottomar Geschke, Hans Jendretzky und Otto Winzer für die KPD; Erich W. Gniffke, Otto Grotewohl, Gustav Dahrendorf, Helmut Lehmann und Otto Meier für die SPD.
Mit dieser Aktionsvereinbarung war zugleich eine Antwort auf die Frage gegeben, auf welchem Wege die Bildung der Einheitspartei der Arbeiterklasse erfolgen könne. Von sozialdemokratischer Seite war ein sofortiger Zusammenschluß erwogen worden. Die KPD hatte hingegen darauf verwiesen, daß für die Vereinigung eine Annäherung durch gemeinsame Aktionen und durch Klärung politischer, ideologischer und organisatorischer Probleme der Arbeiterbewegung unerläßlich sei. Wie das Aktionsabkommen vom 19. Juni 1945 ausweist, fand dieses Herangehen an die Einheitsfrage die Zustimmung beider Partner.
Es war das erste Mal in der deutschen Geschichte, daß sich die Führungen von KPD und SPD auf ein so weitreichendes, verbindliches Abkommen geeinigt hatten, das der Durchsetzung einer gemeinsamen Politik diente und die Überwindung der Spaltung der Arbeiterbewegung ansteuerte. In ihm wurde den regionalen und lokalen Parteiorganisationen empfohlen, in gleicher Weise zusammenzuarbeiten. Bereits im Juni und Juli 1945 entstanden Aktionsgemeinschaften beider Parteien in allen Berliner Stadtbezirken, in Chemnitz, Cottbus, Dresden, Gera, Leipzig, Neubrandenburg, Rostock und anderen Städten.
Die erste Vereinbarung auf Landesebene schlossen die Leitungen von KPD und SPD in Sachsen am 3. Juli 1945. Diesem Beispiel folgten in den Sommermonaten auch die Parteiorganisationen der anderen Länder und Provinzen der sowjetischen Besatzungszone. Auch in zahlreichen Orten der westlichen Besatzungszonen trafen Kommunisten und Sozialdemokraten Vereinbarungen, die mitunter die im Abkommen zwischen dem Zentralkomitee der KPD und dem Zentralausschuß der SPD formulierten AufgabenstelJungen übernahmen.
In Berlin nahm der zentrale Gemeinsame Arbeitsausschuß von KPD und SPD unverzüglich seine Tätigkeit auf. Wilhelm Pieck wandte sich nach seiner Rückkehr aus dem Exil sofort intensiv der Zusammenarbeit beider Arbeiterparteien zu. Der Arbeitsausschuß von KPD und SPD befaßte sich mit der Vorbereitung des Blocks der antifaschistisch-demokratischen Parteien, mit den bevorstehenden Erntearbeiten und mit derneuen Agrarpolitik. Entnazifizierung, Erneuerung der Justiz und Gewerkschaftspolitik waren weitere Beratungsgegenstände, bei denen übereinstimmende Standpunkte erreicht wurden.
Das Entstehen bürgerlich-demokratischer Parteien
Die frühe Zulassung antifaschistisch-demokratischer Parteien in der sowjetischen Besatzungszone hatte die politischen Gruppierungen außerhalb der Arbeiterbewegung mehr oder weniger überrascht. Als der Befehl Nr. 2 der SMAD erging, gab es keine ausgereiften Überlegungen für Programmatik und Profil parteipolitischer Vertretungen des Bürgertums. und des Kleinbürgertums, die den spezifischen Bedingungen der unmittelbaren Nachkriegszeit Rechnung trugen.
Anders als für die Arbeiterparteien erwuchs für die nun entstehenden Gründerkreise bürgerlich-demokratischer Parteien die Notwendigkeit, konzeptionell wie organisatorisch einen generellen Neuansatz zu finden, denn sie konnten für sich keine ungebrochene Kontinuität zu Parteien der Weimarer Republik reklamieren. Gleichwohl knüpften sie an parteipolitische Strömungen der Weimarer Zeit an und nutzten sie die Namen führender Repräsentanten der ersten deutschen Republik. Einen zentralen Orientierungspunkt für Politiker des Bürgertums und kleinbürgerlicher Kreise bildete die Weimarer Verfassung, in der bürgerliches Demokratieverständnis staatsrechtlichen Ausdruck gefunden hatte, deren reaktionär-autokratische Tendenzen jedoch kaum gesehen wurden. Dabei war man entschlossen, sich nicht nur vom Faschismus, sondern auch von Militarismus, Chauvinismus und reaktionärem Preußentum klar abzugrenzen. Die Neugestaltung des gesellschaftlichen Lebens nach christlich-demokratischen oder liberal-demokratischen Grundsätzen sollte eine Wiederholung der Katastrophenpolitik der Vergangenheit ausschließen. Zurückgegriffen wurde auch auf Überlegungen der Verschwörer des 20. Juli 1944, mit denen manche nun wieder aktiv werdende bürgerliche Politiker in Verbindung gestanden hatten. Es gab Bestrebungen, einen Brükkenschlag zwischen Sozialdemokratie und christlicher Demokratie zu bewerkstelligen, wie auch Absichten, die liberal-demokratische und die christlich-demokratische Strömung in einer Partei zu vereinen. Doch scheiterten solche, meist antikommunistisch motivierten Projekte schon bei den ersten Versuchen ihrer Verwirklichung.
Seit Mitte Juni 1945 liefen in Berlin Vorbereitungen zur Gründung einer Partei auf christlich-demokratischer Grundlage und zur Schaffung einer Partei der liberal-demokratischen Richtung. Schon in dieser Gründerphase bestanden Kontakte zu den Arbeiter
parteien. Das im Aufruf vom 11. Juni 1945 von der KPD dargelegte reife Konzept einer antifaschistischdemokratischen Umgestaltung und die Zusammenarbeit von Anhängern verschiedener politischer und weltanschaulicher Überzeugungen im Berliner Magistrat und in anderen neuen Verwaltungen beeinflußten den Entstehungsprozeß bürgerlich-demokratischer Parteien in der sowjetischen Besatzungszone in progressivem Sinne.
Am 26.Juni 1945 erschien der Gründungsaufruf der Christlich-Demokratischen Union Deutschlands (CDU), hinter dem Vertreter der Zentrumspartei, der Deutschen Demokratischen Partei und anderer Parteien und Organisationen der Weimarer Republik standen. Sozial gesehen entstammten sie fast alle dem Bürgertum und der Intelligenz. Erster Vorsitzender der neuen Partei wurde Andreas Hermes, zweiter Vorsitzender Walther Schreiber. Beide hatten Ministerposten in der Weimarer Republik innegehabt. Hermes, der maßgeblichen Anteil am Gründungsaufruf hatte, war ein dem Goerdeler-Kreis nahestehender bürgerlicher Hitlergegner. Mit Jakob Kaiser und Ernst Lemmer waren auch Gewerkschaftspolitiker in der Führung der CDU vertreten.
Im Gründungsaufruf verurteilte die CDU die Politik des Krieges und die Nazityrannei. Er enthielt das Gelöbnis, „alles bis zum letzten auszutilgen, was dieses ungeheure Blutopfer und dieses namenlose Elend verschuldet hat, und nichts zu unterlassen, was die Menschheit künftig vor einer solchen Katastrophe bewahrt“.’* Dazu hielt die CDU auch strukturelle Veränderungen im politischen und ökonomischen Leben der Gesellschaft für unerläßlich. Sie forderte, „für alle Zeiten die Staatsgewalt vor illegitimen Einflüssen wirtschaftlicher Machtzusammenballungen“?” zu sichern, Bodenschätze in Gemeinbesitz zu überführen, den Bergbau und andere monopolartige Schlüsselunternehmen der Staatsgewalt zu unterwerfen und den Aufbau der Wirtschaft in straffer Planung durchzuführen. Die CDU bekannte sich zur vertrauensvollen „Zusammenarbeit aller die Demokratie bejahenden Parteien und aller aufbauwilligen Kräfte“ und erklärte: „Wir erkennen die Kraft an, die von der Arbeiterschaft in das Volksganze einströmt.“? Hier fand zugleich die Absicht der Parteigründer Ausdruck, die CDU zu einer Volkspartei zu machen.
Dies war eine politische Plattform, auf der die Sammlung christlich und demokratisch gesinnter Männer und Frauen aus dem Bürgertum und dem Kleinbürgertum erfolgen konnte. Der Aufruf bot die Chance, den Trennungsstrich zwischen Christentum und allen reaktionären Traditionen, Interessen und Gewalten zu vollziehen und den Widerstand von Christen gegen Faschismus und Militarismus zur eigentlichen Traditionslinie christlich-demokratischer Politik zu erheben. Kam in ihm das progressive Wollen christlich orientierter Politiker zum Ausdruck, so waren doch viele seiner Aussagen so unscharf, daß eine Ausdeutung und vor allem die Ausgestaltung der praktischen Politik der CDU in gegensätzlicher Richtung möglich waren. Ihr Weg konnte zu antifaschistischer Demokratie, aber auch zum bürgerlichen Parlamentarismus führen, zu einer neuen sozialökonomischen Struktur der Gesellschaft, aber auch zu einer restaurativen Neuordnung, mit der die staatsmonopolistischen Verhältnisse lediglich von Zügen des Faschismus befreit und mit einigen Sozialmaßnahmen aufgewertet wurden. Die Partei konnte sich als Bündnispartner, aber auch als Gegenkraft der sozialistischen Arbeiterbewegung verstehen. All diese Entscheidungen standen der im Juni 1945 gegründeten CDU noch bevor.
Im Sommer 1945 konsolidierte sich die CDU in der sowjetischen Besatzungszone und faßte sie organisatorisch in zahlreichen Städten und Gemeinden Fuß. Sie vermochte neben Vertretern des Bürgertums und der Intelligenz auch religiös gesinnte Arbeiter und Angestellte für sich zu werben. Am 22. Juli 1945 erschien die erste Nummer der Parteizeitung „Neue Zeit“, deren Chefredakteur Otto Nuschke, eine der markantesten Persönlichkeiten der fortschrittlichen bürgerlichen Intelligenz, wurde. Ende August wurde in Berlin die „Reichsgeschäftsstelle“* der CDU errichtet, deren Referate und ehrenamtliche Ausschüsse nun die Arbeit aufnahmen. Dieser Apparat eröffnete auch Konzernvertretern, Großgrundbesitzern und Beamten der alten Staatsbürokratie Betätigungsund Einflußmöglichkeiten. So waren im ideellen wie im personellen Bereich Konflikte unvermeidlich, die aufbrechen mußten, sobald die CDU in Entscheidungssituationen des sozialen und nationalen Kampfes geriet.
Auch für die Gründerkreise einer liberalen, demokratischen Partei wurden die von Berlin ausgehenden Initiativen richtungweisend. Hier war zum erstenmal am 16. Juni 1945 eine Gruppe von liberal orientierten Politikern zusammengetreten, die größtenteils aus der früheren Deutschen Demokratischen Partei kamen. Sie repräsentierten ein breites politisches Spektrum, das von progressiven Vertretern des Bürgertums und der Intelligenz bis hin zu Verfechtern konservativer Prinzipien reichte. Zu den Gründern der Liberal-Demokratischen Partei Deutschlands (LDPD) gehörten unter anderem der frühere Reichsminister Wilhelm Külz, ein Mann aus dem Bürgertum von lauterer, demokratischer Gesinnung; der ehemalige Vizekanzler des Deutschen Reiches Eugen Schiffer, ein Verfolgter des Naziregimes, aber auch Waldemar Koch, dessen politische Haltung durch seine engen Beziehungen zu den Elektrokonzernen geprägt war und der die neue Partei monopolkapitalistischen Interessen dienstbar machen wollte.
Wie alle Parteien der sowjetischen Besatzungszone, so betonte auch die LDPD ihren antifaschistischen Charakter. Sie verlangte die „äußere und innere Befreiung des deutschen Volkes von den letzten Spuren der Schmach und Schande des Nationalsozialismus“ und die „Förderung aller Bestrebungen, den Krieg mit seinem Elend und Jammer aus dem Gemeinschaftsleben der Völker zu verbannen“.’ Ihr Aufruf benannte Aufgaben der Demokratisierung des öffentlichen Lebens, der Justiz und der Volksbildung, erklärte sich für die Trennung von Staat und Kirche, verteidigte aber zugleich das Berufsbeamtentum, die Unabhängigkeit der Richter und damit die bürgerliche Gewaltenteilung. So sollte ein „demokratischer Rechtsstaat“ geschaffen werden, der sich nicht grundsätzlich von der Weimarer Republik unterschied.
Während einige lokale Gründerkreise der LDPD die Überführung von Großbetrieben der Industrie, der Landwirtschaft und des Bankwesens sowie von Bodenschätzen in gesellschaftliches Eigentum gefordert hatten, betonte der Berliner Aufruf die Erhaltung des „Privateigentums und der freien Wirtschaft“. Nur in Ausnahmefällen sollten Unternehmen einer Öffentlichen Kontrolle unterstellt werden, nur allgemein und unverbindlich war im Aufruf von der „Schaffung wahrer sozialer Gesinnung“, von wirtschaftlicher und sozialer Gerechtigkeit die Rede.’® Die LDPD wollte gemäß ihrer Programmatik keine Eingriffe in die kapitalistischen Eigentumsverhältnisse, höchstens einen Ausgleich zwischen Kapital und Arbeit. Das schloß jedoch nicht aus, daß die Partei antimonopolistische Maßnahmen, die auch bei Handwerkern und Gewerbetreibenden, ja selbst bei kleineren und mittleren Unternehmern Anklang fanden, unterstützte. Auch die LDPD bezeichnete die Zusammenarbeit mit anderen antifaschistischen Parteien als selbstverständlich.
Der weitere Weg der LDPD hing wesentlich davon ab, ob sich die Partei vornehmlich an ihren Forderungen nach Friedenssicherung, nach Abrechnung mit dem Faschismus und an ihrer Bereitschaft zu antifaschistischer Zusammenarbeit, auch mit der Arbeiterbewegung, orientierte oder ob sie die Verteidigung privatkapitalistischer Interessen und der Prinzipien formaler bürgerlicher Demokratie zu ihrem wesentlichen politischen Auftrag erhob.
Die LDPD sah sich als Partei des ganzen Volkes; es gelang ihr jedoch nur vereinzelt, Arbeiter für sich zu gewinnen. In ihren Reihen dominierten die städtischen Mittelschichten und die Intelligenz; auch Großund Mittelbauern schlossen sich ihr an. Bis zum Herbst 1945 hatte sich auch die LDPD einen Stamm an Mitgliedern gesichert und ihre Organisation aufgebaut. Erster Vorsitzender der Partei wurde Waldemar Koch, über den der konservative Flügel der Partei beträchtlichen Einfluß gewann. Vor allem in dem beim Parteivorstand gebildeten Industrieund Bankenausschuß sammelten sich Vertreter großer Konzerne. Am 3. August 1945 erschien die erste Nummer der Tageszeitung „Der Morgen“. Ihr Herausgeber war Wilhelm Külz, unter dessen Einfluß auch progressive Mitglieder und Funktionäre der LDPD in diesem Blatt zu Wort kamen.
So waren mit der Bildung von vier antifaschistischdemokratischen Parteien in der sowjetischen Besatzungszone die Voraussetzungen für ein reges politisches Leben gegeben, zu einer Zeit, in der die demokratischen Kräfte in den Westzonen noch um Legalisierung ihrer Organisationen rangen.
Der Block der antifaschistisch-demokratischen Parteien
Anfang Juli 1945 nahmen die beiden Arbeiterparteien direkte Verhandlungen mit führenden Persönlichkeiten der im Entstehen begriffenen bürgerlich-demokratischen Parteien auf. Sie erreichten in einer Reihe von Städten Vereinbarungen über die Zusammenarbeit aller Parteien. So wurde zum Beispiel am 10. Juli in Schwerin beschlossen, einen Block der antifaschistisch-demokratischen Parteien für Mecklenburg-Vorpommern zu bilden.
Am 14. Juli fanden im Neuen Stadthaus in Berlin die seit dem 9. Juli geführten Verhandlungen über die Bildung einer Einheitsfront der antifaschistisch-demokratischen Parteien ihren Abschluß. Gegen den Begriff „Block“ gab es anfangs Einwände aus den Reihen der CDU, so daß sich diese Bezeichnung erst 1947 durchsetzte. Das Kommunique der Beratungen unterzeichneten Wilhelm Pieck, Walter Ulbricht, Franz Dahlem, Anton Ackermann und Otto Winzer für das Zentralkomitee der KPD; Erich W.Gniffke, Otto Grotewohl, Gustav Dahrendorf, Helmut Lehmann und Otto Meier für den Zentralausschuß der SPD; Andreas Hermes, Jakob Kaiser, Theodor Steltzer, Walther Schreiber und Ernst Lemmer für den Vorstand der CDU; Waldemar Koch, Wilhelm Külz, Eugen Schiffer und Arthur Lieutenant für den Vorstand der LDPD.
Alle Parteien erklärten ihre Bereitschaft zu aufrichtiger Zusammenarbeit für die Errichtung einer antifaschistischen Demokratie bei Wahrung und Respektierung ihrer Selbständigkeit. Sie einigten sich auf die Bildung eines gemeinsamen Ausschusses, in den jede Partei fünf Vertreter entsenden und der zweimal monatlich tagen sollte. Die Vorbereitung seiner Tagungen und die Organisierung der gegenseitigen Kontakte oblag einem Verbindungsbüro. Den Parteiorganisationen in den Ländern und Provinzen, Kreisen und Orten wurde empfohlen, sich in gleicher Weise zu gemeinsamer Aufbauarbeit zusammenzufinden.
Die Aufgaben des gemeinsamen Ausschusses wurden in fünf Punkten umrissen: „l. Zusammenarbeit im Kampf zur Säuberung Deutschlands von den Überresten des Hitlerismus und für den Aufbau des Landes auf antifaschistisch-demokratischer Grundlage. Kampf gegen das Gift der Naziideologie wie gegen alle imperialistisch-militaristischen Gedankengänge. 2. Gemeinsame Anstrengungen zu möglichst raschem Wiederaufbau der Wirtschaft, um Arbeit, Brot, Kleidung und Wohnung für die Bevölkerung zu schaffen. 3. Herstellung voller Rechtssicherheit auf der Grundlage eines demokratischen Rechtsstaates. 4. Sicherung der Freiheit des Geistes und des Gewissens sowie der Achtung vor jeder religiösen Überzeugung und sittlichen Weltanschauung. 5. Wiedergewinnung des Vertrauens und Herbeiführung eines auf gegenseitiger Achtung beruhenden Verhältnisses zu allen Völkern. Unterbindung jeder Völkerverhetzung. Ehrliche Bereitschaft zur Durchführung der Maßnahmen der Besatzungsbehörden und Anerkennung unserer Pflicht zur Wiedergutmachung.“39
Den Modus der Zusammenarbeit regelte die am 27. Juli 1945 verabschiedete „Geschäftsordnung des Gemeinsamen Ausschusses der Einheitsfront der antifaschistisch-demokratischen Parteien“. Sie enthielt die wichtige Festlegung: „Die Beschlußfassung erfolgt auf dem Wege der Vereinbarung, somit nicht durch Abstimmung. Die so erfolgten Vereinbarungen sind bindend für alle Parteien.“40 Auf diese Weise wurde verhindert, daß eine Partei überstimmt bzw. zur Anerkennung von Beschlüssen gezwungen werden konnte, die nicht ihre Billigung fanden.
In Inhalt und in Form war damit die künftige Zusammenarbeit geregelt und ein Rahmen geschaffen, in dem auch Konflikte zwischen den Parteien, wie sie im Umwälzungsprozeß unvermeidlich waren, bewältigt werden konnten. Es entsprach der gesellschaftlichen Stellung der Arbeiterklasse, wenn in der Blockpolitik die Initiative bei den in Aktionseinheit handeinden Arbeiterparteien lag. Mit der Blockpolitik trat etwas Neues ins politische Leben. Sie war keine Fortsetzung der Koalitionspolitik, zu der sich SPD und bürgerliche Parteien während der Weimarer Republik wiederholt zusammengefunden hatten. Im Block waren alle Parteien vertreten. Ihm lag die Idee der Volksfront zugrunde. Die Blockpolitik knüpfte an das von der KPD entwickelte Konzept eines „Blocks der kämpferischen Demokratie“ an und entwickelte die mit dem Nationalkomitee „Freies Deutschland“ gewonnenen Erfahrungen weiter. Sie zielte auf eine umfassende Einbeziehung der Bevölkerung in die antifaschistisch-demokratische Umwälzung und war politischer Ausdruck des Bündnisses der Arbeiterklasse mit den Bauern, Handwerkern und Gewerbetreibenden, den Intellektuellen wie auch mit kleinen und mittleren Unternehmern. Indem sich die Einheitsfront der antifaschistisch-demokratischen Parteien grundsätzlich auf der Linie der alliierten Vereinbarungen über Deutschland bewegte, manifestierte sie zugleich ihre Bereitschaft, an der Gestaltung einer europäischen Friedensordnung mitzuarbeiten. Sie wies einen Weg, auf dem sich mit Blick auf einen künftigen Friedensvertrag so etwas wie ein politischer Gesamtwille des deutschen Volkes herausbilden konnte.
Wie sich jede der in Berlin gegründeten Parteien als Ausgangspunkt und Kristallisationskern der parteipolitischen Entwicklung in allen Besatzungszonen verstand, so wollte auch ihr gemeinsamer Ausschuß ein Zeichen für die überall gebotene Zusammenarbeit der Antifaschisten und Demokraten setzen. In diesem Sinne verpflichteten sich die Blockparteien, „mit vereinter Kraft die großen Aufgaben zu lösen. Damit ist ein neues Blatt in der Geschichte Deutschlands aufgeschlagen“41, erklärten sie mit historischer Weitsicht.
Die Vorbereitung antifaschistisch-demokratischer Massenorganisationen
Während sich viele Werktätige den Gewerkschaften anschlossen, strebten Jugendliche, Frauen und Intellektuelle danach, sich auch eigene Vertretungen zu schaffen, mit denen sie ihre spezifischen Interessen wahrnehmen konnten.
Als erste demokratische Organisation neben Parteien und Gewerkschaften entstand der Kulturbund zur demokratischen Erneuerung Deutschlands. Es waren vor allem der KPD angehörende Kulturschaffende, die sich im Auftrage des Zentralkomitees ihrer Partei der Aufgabe widmeten, humanistisch gesinnte Schriftsteller, Künstler, Wissenschaftler, Mediziner, Pädagogen, Journalisten und auch Geistliche zu sammeln. Dabei ging es darum, über den Kreis der in der Arbeiterbewegung organisierten oder dieser nahestehenden Intellektuellen hinaus auch all jene in die Demokratisierung des geistig-kulturellen Lebens einzubeziehen, die dem faschistischen Ungeist widerstanden hatten, die sich dem progressiven, humanistischen Erbe, den Ideen des Friedens, der Völkerverständigung und des Fortschritts verpflichtet fühlten. Darüber hinaus bemühte sich der Kulturbund, Männer und Frauen an sich heranzuziehen, die noch Suchende waren, die sich enttäuscht von der Vergangenheit abgewendet hatten, aber erst vage das Neue zu erkennen vermochten.
Am 3. Juli 1945 führte der Kulturbund zur demokratischen Erneuerung Deutschlands im Haus des Berliner Rundfunks seine Gründungskundgebung durch. Von dieser erging der Appell an alle fortschrittlichen Intellektuellen, am demokratischen Neuaufbau der Heimat und an der Erneuerung der deutschen Kultur mitzuwirken. Dieser Appell fand sein Echo in allen Ländern und Provinzen der sowjetischen Besatzungszone, in Städten der anderen Zonen wie auch bei noch im Exil weilenden antifaschistischen deutschen Kulturschaffenden. Geleitet wurde der Kulturbund von dem Dichter Johannes R. Becher als Präsidenten und dem Journalisten Heinz Wilimann als Generalsekretär; Vizepräsidenten waren der Maler Carl Hofer, der Schriftsteller Bernhard Kellermann und ab 12. Februar 1946 auch der Wissenschaftler Johannes Stroux.
Johannes R. Becher lebte anderen vor, wie sich Kunst und Politik zu beider Nutzen verbinden. Der einer Beamtenfamilie entstammende Dichter hatte über den Protest gegen Krieg und soziale Ungerechtigkeit den Weg zur KPD gefunden. Er zählte zu den Mitbegründern des Bundes proletarisch-revolutionärer Schriftsteller Deutschlands, zu dessen Vorsitzenden er 1928 gewählt wurde. Wie viele Große der deutschen Literatur verbrachte er die Zeit des Faschismus im Exil, von wo er schärfste Anklage gegen die nazistischen Verbrecher erhob. Vom Expressionismus herkommend, war Becher bestrebt, das humanistische Erbe und die deutsche Klassik für eine sozialistischrealistische Kunst produktiv zu erschließen. Demokratische Erneuerung der deutschen Kultur, die Suche nach dem neuen Vaterland und das Anderswerden des Menschen waren die großen Themen seiner Lyrik und Prosa. Nach der Befreiung vom Faschismus stellte er sich sofort in den Dienst des kulturellen Neuaufbaus.
Wie Becher, so verstanden auch andere Schriftsteller, daß die Zeit gebot, zunächst vor allem Kulturpolitiker und Funktionär des Aufbauwerkes zu sein. So wirkte Willi Bredel als Mitarbeiter der Bezirksleitung Mecklenburg-Vorpommern der KPD, übernahm Erich Weinert sofort nach seiner Rückkehr das Amt eines Vizepräsidenten der Deutschen Verwaltung für Volksbildung und stellte sich Hans Fallada in Feldberg als Bürgermeister zur Verfügung.
In den Monaten Juni bis August 1945 begannen bewährte Antifaschisten damit, Jungen und Mädchen für antifaschistische Jugendgruppen oder Ausschüsse zu gewinnen. Sie diskutierten mit den Jugendlichen über das Geschehene und halfen ihnen, wieder Mut zu fassen und der neuen Zeit aufgeschlossen gegenüberzutreten. Zwar gab es verschiedentlich Bestrebungen, proletarische und andere Jugendverbände zu reorganisieren, doch einigten sich KPD und SPD, auf die Schaffung eigener Jugendorganisationen zu verzichten. Sie sahen die Interessen der Jugend wie der ganzen Gesellschaft am besten gewahrt, wenn eine einheitliche antifaschistisch-demokratische Jugendorganisation vorbereitet wurde. Um die junge Generation, die am stärksten der Verführung durch die Faschisten ausgesetzt gewesen war, dem Einfluß des Nazismus zu entreißen, um sie für echte Ideale zu begeistern und ihre Tatkraft auf den Aufbau eines neuen Deutschlands hinzulenken, bedurfte es einer Jugendbewegung auf breitester Basis. Notwendig war eine Organisation, die alle Jugendlichen anzog, die einen neuen, besseren Weg suchten, und mit der die parteipolitische und konfessionelle Aufsplitterung der jungen Generation überwunden werden konnte. Diesen Anforderungen entsprachen zunächst am besten antifaschistisch-demokratische Jugendausschüsse, wie sie zum Beispiel in Berlin und in verschiedenen Städten Sachsens entstanden waren.
Am 31. Juli 1945 veröffentlichte die „Deutsche Volkszeitung“ eine Bekanntmachung der SMAD, mit der „die Schaffung antifaschistischer Jugendkomiitees bei den Bürgermeistereien der großen und mittleren Städte“ genehmigt wurde. Nun breitete sich die Bewegung der Jugendausschüsse mit Unterstützung sowjetischer Offiziere, die durch die Schule des Komsomol gegangen waren und sich der Arbeit unter der deutschen Jugend widmeten, rasch aus. Mehr und mehr Jugendliche fühlten sich angezogen durch den in diesen Ausschüssen gepflegten freundschaftlichen Zusammenhalt, durch gemeinsame Freizeiterlebnisse, aber auch durch die hier geführten heißen Debatten. Offenbarte sich auch immer wieder, wie tief sich die nazistische Ideologie in den Köpfen junger Menschen eingenistet hatte, so zeigte sich doch zugleich, daß die meisten von ihnen neue Ideale und eine richtige Weltsicht suchten.
Trümmerfrauen auf dem Heimweg. Pastell von Otto Nagel, 1947. Museum für Deutsche Geschichte, Berlin
Erich Honecker erhielt vom Sekretariat des Zentralkomitees der KPD den Auftrag, die Organisierung der Jugendbewegung im ganzen Land in die Hand zu nehmen. Er konnte sich dabei auf die vorbildliche Jugendarbeit stützen, wie sie in Leipzig unter Leitung von Hermann Axen und in Berlin unter Leitung von Heinz Keßler geleistet wurde. Am 10. September 1945 nahm ein aus je fünf Kommunisten und Sozialdemokraten bestehender Zentraler Jugendausschuß seine Tätigkeit auf, der bald darauf durch die Aufnahme von Vertretern der protestantischen und der katholischen Jugend erweitert wurde. Den Ausschuß leitete Erich Honecker, dem der sozialdemokratische J ugendvertreter Theo Wiechert zur Seite stand.
Auch antifaschistische Frauen fanden sich in Ausschüssen zusammen. Während jedoch die Jugendausschüsse ihre Tätigkeit als direkte Vorbereitung einer antifaschistisch-demokratischen Jugendorganisation aufnahmen, war für die Frauenausschüsse eine solche Orientierung zunächst nicht gegeben. Sie sollten vor allem helfen, die Frauen zu aktivieren, ihr Selbstbewußtsein zu stärken, sollten sie in die breite antifaschistisch-demokratische Front einbeziehen. Die Frauenausschüsse widmeten sich der Aufklärungsarbeit unter der weiblichen Bevölkerung, halfen Flüchtlingen und Umsiedlern, kümmerten sich um elternlose Kinder. Sie setzten sich für die Schaffung von Nähstuben, Volksküchen und angesichts des bevorstehenden Winters von Wärmehallen ein. Indem sie sich der Nöte der Frauen und der Familien annahmen, eröffneten sie ein breites Betätigungsfeld auch für Frauen aus Kreisen des Mittelstandes, für Frauen unterschiedlicher weltanschaulicher Überzeugung.
Am 23. August 1945 konstituierte sich ein Zentraler Frauenausschuß beim Berliner Magistrat, der mit seiner Tätigkeit für die ganze Bewegung der Frauenausschüsse richtungweisend wurde. Zu seiner Vorsitzenden wählte er Elli Schmidt von der KPD, zur stellvertretenden Vorsitzenden Toni Wohlgemuth von der SPD. Auch Frauenfunktionäre der CDU und der LDPD gehörten diesem Gremium an.
So war mit der Bildung der vier Parteien und ihrer Einheitsfront, mit dem Aufbau neuer freier Gewerkschaften und dem Entstehen fortschrittlicher Bewegungen der Kulturschaffenden, der Jugendlichen und der Frauen ein Prozeß in Gang gekommen, in dem es der marxistisch-leninistischen Vorhut der Arbeiterklasse gelang, die Kräfte für die antifaschistisch-demokratische Umwälzung zu formieren.
Die Sorben und die Erneuerung der Domowina
Die Befreiung vom Faschismus eröffnete auch günstige Bedingungen für die Lösung der Nationalitätenfrage der Sorben. Die Unterdrückungsund Germanisierungspolitik, der die sorbische nationale Minderheit im imperialistischen deutschen Staat ausgesetzt gewesen war, hatte in der Zeit der faschistischen Diktatur bedrohlich zugenommen. Als die Rote Armee einrückte, lebten in der Oberund der Niederlausitz etwa 100.000 Sorben. Sie waren größtenteils in der Landwirtschaft tätig. Unter den selbständigen Landwirten überwogen die Kleinbauern. Etwa ein Fünftel der Sorben gehörte der Arbeiterklasse an. Die zahlenmäßig geringe Schicht der Intelligenz bestand vor allem aus Lehrern und Geistlichen. In ihren Siedlungsgebieten im Land Sachsen und in der Provinz Mark Brandenburg betrug der Anteil der Sorben an der Bevölkerung etwa 15 Prozent, lag aber in einigen Kreisen deutlich über diesem Durchschnitt.
Mit der Zerschlagung des Faschismus setzte auch eine Erneuerung der sorbischen nationalen Bewegung ein. Deren Vertreter waren entschlossen, die Unterdrückung ihres Volkes ein für allemal zu beseitigen und seine nationalen Rechte einzufordern. Am 10. Mai 1945 wurde in Crostwitz in der Nähe von Bautzen die 1912 gegründete und 1937 verbotene nationale Organisation Domowina (Bund Lausitzer Sorben) erneuert, für deren Tätigkeit die sowjetische Kommandantur bereits eine Woche später die Genehmigung erteilte. Erster Vorsitzender der Domowina wurde der Jurist Jan Cyž, den die Faschisten zu einer Zuchthausstrafe verurteilt hatten. Parallel zur Domowina entstand in Prag der LuZiskoserbski narodny wuberk (Lausitzisch-sorbische Nationalausschuß) als ein zweites Zentrum unter Vorsitz von Mikławš Krječmar.
In beiden Gruppierungen wirkten nationalbewußte, antifaschistisch gesinnte Sorben, die meist dem Kleinbürgertum entstammten und der Bewegung kleinbürgerlich-bäuerlich-nationalistisch ee Züge verliehen. Doch unterschieden sich Domowina und Nationalausschuß in der Wahl sowohl des einzuschlagenden Weges als auch der vorrangigen Partner im Inund Ausland.
Als die Domowina ihr Konzept akzentuierte, geschah dies bereits unter dem Einfluß des Aufrufs der KPD vom 11. Juni 1945 und angesichts der erfolgreichen Aktionseinheit der beiden: Arbeiterparteien. An die Traditionen der antiimperialistischen, national-demokratischen Bewegung der sorbischen Bevölkerung anknüpfend, suchte die Domowina Lösungen der sorbischen Probleme im Rahmen der in der sowjetischen Besatzungszone in Gang kommenden gesellschaftlichen Umgestaltungen.
Der Nationalausschuß hingegen griff auf die bereits 1918 erhobene Forderung nach Anschluß der Lausitz an den slawischen Nachbarstaat Tschechoslowakei zurück, den er angesichts der mit Faschismus und Krieg gesammelten Erfahrungen und ermuntert durch nationalistische Kreise der tschechischen Bourgeoisie nun für noch dringlicher hielt.
Beide Flügel der sorbischen nationalen Bewegung, die nicht scharf voneinander abgegrenzt waren, sahen zunächst nicht, daß nur auf dem Boden des proletarischen Internationalismus und gemeinsam mit den Repräsentanten der deutschen Arbeiterklasse eine konsequente Lösung der sorbischen Probleme gefunden werden konnte. Statt dessen suchten sie den Ausweg in einer Absonderung der Sorben von der deutschen Bevölkerung und vom deutschen Staatswesen.
In der sowjetischen Besatzungszone wirkte die Einbeziehung von Sorben in den antifaschistisch-demokratischen Neuaufbau unrealen und nationalistisch übersteigerten Tendenzen entgegen. Indem Männer und Frauen sorbischer Nationalität Funktionen in den demokratischen Verwaltungen übernahmen zum Beispiel waren die Landräte von Bautzen und Hoyerswerda Sorben -, erkannten sie auch die Möglichkeiten einer Regelung des Nationalitätenproblems im Zusammenwirken mit deutschen Antifaschisten. Sorben wurden Mitglieder der Gewerkschaften und der beiden Arbeiterparteien.
Anfang Juli 1945 übernahm Pawol Nedo den Vorsitz der Domowina. Der Bund Lausitzer Sorben festigte sich organisatorisch. Im Juli veröffentlichte er seine programmatische Stellungnahme „Vorschläge für die deutsch-wendische Zusammenarbeit in der Lausitz“. Diese politische Plattform war vor allem durch ihre in die Zukunft weisenden antiimperialistisch-demokratischen Grundsätze und Forderungen charakterisiert, obwohl die Domowina zu diesem Zeitpunkt noch nicht von kleinbürgerlich-nationalistischen Anschauungen frei war bzw. die Tendenz einer sorbischen Exklusivität noch nicht überwunden hatte und obwohl in ihr ein klassenmäßig und politisch undifferenziertes Bild der Deutschen noch überwog. „Seit über tausend Jahren“, so hieß es in dem Dokument, „wohnen Wenden und Deutsche in der Lausitz beieinander. Sie sind nach unserer Auffassung während dieser langen Zeit zu einer nicht mehr trennbaren Einheit zusammengewachsen … Wir haben in diesen letzten Wochen viele höchst erfreuliche Beweise von Verständnis und gutem Willen von seiten der deutschen Sozialisten erfahren. Andererseits wollen wir auch nicht verhehlen, daß es bis zur wirklichen Herstellung einer Gleichheit und damit einer Sicherheit unserer völkischen Existenz noch ein sehr weiter Weg ist.“*? Die Vorschläge der Domowina enthielten berechtigte Forderungen, so nach Vertretung der Sorben in den Verwaltungen, nach Gleichberechtigung der sorbischen Sprache und Kultur, nach Neuregelung des Schulwesens und nach Berücksichtigung der sorbischen Bevölkerung bei der zu erwartenden Bodenreform. Die Domowina näherte sich damit Standpunkten, wie sie von den Arbeiterparteien und anderen demokratischen Organisationen der sowjetischen Besatzungszone verfochten wurden, und reihte sich zusehends in die gemeinsame Front der antifaschistischdemokratischen Kräfte ein.
Die Bildung der Landes- und Provinzialverwaltungen und von deutschen Zentralverwaltungen
Bis Anfang Juli 1945 standen amerikanische und britische Truppen in den westlichen Teilen der sowjetischen Besatzungszone, in die sie im Ergebnis der Kampfhandlungen gegen die faschistische deutsche Armee eingerückt waren. Nun mußten sie sich in die eigenen Besatzungszonen zurückziehen. Als sie Thüringen, den Westteil Mecklenburgs sowie große Teile des Landes Sachsen und der Provinz Sachsen verlieBen, waren die Entwaffnung der faschistischen Truppen und das Verbot der nazistischen Bewegung durchgesetzt und manche Säuberungen im Verwaltungsapparat vorgenommen. Doch ein grundlegender Neuaufbau der staatlichen Organe und eine wirksame Ingangsetzung der Wirtschaft waren nicht eingeleitet worden. Die Arbeiterbewegung und andere antifaschistische Kräfte hatten sich nicht legal organisieren können, sondern sich weiterhin oft konspirativer Methoden der Arbeit bedienen müssen. In den Verwaltungen dominierten meist altes Personal oder von Amerikanern und Briten eingesetzte Vertreter konservativer Auffassungen. Obwohl es auch Besatzungsoffiziere gab, die mit den deutschen Antifaschisten sympathisierten, waren die beträchtlichen demokratischen Aktivitäten in Leipzig, in Halle, im Gebiet um das Lager Buchenwald, im Mansfeldischen, in Zwickau und andernorts auf Verbote und Restriktionen der Besatzungsmächte gestoßen. Verschiedentlich waren sogar soeben den faschistischen Gefängnissen und Konzentrationslagern entronnene Antifaschisten festgenommen oder aus Stadtverwaltungen entfernt worden, während nazistische Beamte weiterregierten und Konzernvertreter ihren Herr-im-Hause-Standpunkt ih den Betrieben weiterhin durchzusetzen vermochten.
Als die amerikanischen und britischen Truppen die von ihnen zeitweise kontrollierten Gebiete räumten, rissen sie in einem organisierten Beutezug gemäß der vorbereiteten „Operation Overcast“ wertvolle technische Ausrüstungen, Patente, Rezepturen, Edelmetalle und anderes wertvolles Gut dieser industriell entwikkelten Gebiete an sich, in denen wichtige Werke der Chemie, des Schwermaschinenbaus, des Flugzeugbaus, der Feinmechanik und Optik lagen, die eine exponierte Stellung in der Rüstungswirtschaft eingenommen hatten. So verschwanden aus den Zeiss-Werken wichtige Patentschriften, das Zeiss-Archiv mit allen Zeichnungen der Zeiss-Geräte, Spezialwerkzeuge, die wichtigsten Optikmaschinen und die Zeiss-Linsensammlung, die größte Linsensammlung der Welt. Mitgenommen wurden Know-how der deutschen Raketenproduktion und Flugzeugindustrie sowie auch Wissenschaftler und hochspezialisierte Fachleute. Eine Liste, die Marschall G.K. Shukow über diesen Abtransport von Ausrüstungen und anderen Werten für die sowjetische Delegation zur Potsdamer Konferenz zusammenstellen ließ, umfaßte viele Seiten. Mehr als 10000 beladene Güterwagen, dazu Personenwagen und Lokomotiven rollten gen Westen. Diese Beute an materiellen, ideellen und personellen Ressourcen floß vorwiegend amerikanischen Konzernen, insbesondere den Giganten der Rüstungsindustrie, zu. Zugleich sollten der Wiederaufbau in der sowjetischen Besatzungszone und die Startbedingungen für die hier wirkenden antifaschistisch-demokratischen Kräfte des deutschen Volkes erschwert werden.
Für die deutschen Kommunisten und die an ihrer Seite stehenden Sozialdemokraten waren die Tage des Besatzungswechsels eine echte Bewährungsprobe. Sie bemühten sich, den Einwohnern Charakter und Rolle der Roten Armee und der sowjetischen Politik zu erläutern. Dank ihrer Initiative wurden die Anfang Juli in die geräumten Gebiete einrückenden sowjetischen Truppen in zahlreichen Industriestädten mit Fahnen und Spruchbändern, mit Aufrufen und teilweise mit Kundgebungen begrüßt.
Liste von amerikanischen Besatzungsbehörden in der Filmfabrik Wolfen requirierter Materialien
Mit der Unterstellung dieser Gebiete unter die unmittelbare Verantwortung der SMAD waren die Bedingungen gegeben, den administrativen Aufbau der sowjetischen Besatzungszone durchgängig zu organisieren. Die sowjetische Besatzungszone bestand ab Juli 1945 aus dem Land Sachsen mit der Landeshauptstadt Dresden, dem Land Thüringen mit der Landeshauptstadt Weimar, dem Land Mecklenburg-Vorpommern mit der Landeshauptstadt Schwerin, der Provinz Mark Brandenburg mit der Provinzhauptstadt Potsdam, der Provinz Sachsen mit der Provinzhauptstadt Halle und aus Berlin.
Das Land Sachsen, jetzt durch drei ehemals schlesische Kreise erweitert, besaß als staatlich-territoriale Einheit eine weit in die Feudalzeit zurückreichende Geschichte, die eine reiche Kultur mit vielen klangvollen Namen hervorgebracht hatte. Hier war die Wiege der von August Bebel und Wilhelm Liebknecht begründeten revolutionären deutschen Sozialdemokratie. Das Königreich Sachsen bzw. der spätere Freistaat Sachsen war nach seiner Bevölkerung der drittgrößte und nach seiner Fläche der fünftgrößte Staat des früheren Deutschen Reiches gewesen. Als das am dichtesten besiedelte Gebiet der Ostzone war es am durchgängigsten industrialisiert mit Betrieben vieler Branchen. Zugleich verfügte es über eine für damalige Verhältnisse intensive Landund Forstwirtschaft. Es besaß die am besten entwickelte Infrastruktur.
Das Land Thüringen, erst zu Beginn der zwanziger Jahre durch Zusammenlegung thüringischer Kleinstaaten im Freistaat Thüringen geschaffen, wurde durch die Eingliederung des ehemals preußischen Regierungsbezirkes Erfurt abgerundet. In Thüringen hatten Zentren des Großen Deutschen Bauernkrieges und Wirkungsstätten Thomas Müntzers gelegen. Mit seiner Landeshauptstadt Weimar verbanden sich aufs engste die Traditionen der deutschen Klassik und der Ruhm von Goethe und Schiller. Auch das Land Thüringen besaß eine überdurchschnittliche Bevölketungsdichte. Hier hatten sich wichtige Industrien angesiedelt, wie die feinmechanische, die optische, die keramische oder die Glasindustrie.
Begrüßung der Sowjetarmee auf dem Geraer Marktplatz, 2. Juli 1945
Mecklenburg hatte in der Weimarer Republik noch aus den beiden Freistaaten Mecklenburg-Schwerin und Mecklenburg-Strelitz bestanden, die aus den gleichnamigen Großherzogtümern bzw. Herzogtümern hervorgegangen waren und auf eine lange gemeinsame Geschichte zurückblickten. Jetzt wurden Mecklenburg das ehemals preußische Vorpommern und die Insel Rügen angeschlossen. Das so geschaffene Land Mecklenburg-Vorpommern gehörte zu den am geringsten besiedelten deutschen Territorien. Es trug ausgesprochen agrarischen Charakter und wies in seiner industriellen und verkehrsmäßigen wie in seiner kulturellen Entwicklung viele Defizite auf. Gleichwohl war es die Heimat bedeutender deutscher Patrioten und Demokraten, wie Ernst Moritz Arndt und Fritz Reuter.
Die Provinz Mark Brandenburg war das Kernland des preußischen Staates und auf das engste mit der Geschichte und den kulturellen Traditionen Preußens verbunden. Der Name seiner Hauptstadt Potsdam stand sowohl für den Ungeist des preußisch-deutschen Militarismus wie für Sanssouci mit seinen architektonischen, gartenkünstlerischen, bildnerischen, musikalischen und philosophischen Schöpfungen und Leistungen. Hier hatte Karl Liebknecht sein Mandat als Reichstagsabgeordneter errungen. Als territorial-administrative Einheit hatte die Provinz im Laufe des 19. Jahrhunderts Gestalt angenommen. Von der ehemaligen preußischen Provinz unterschied sich die Provinz Mark Brandenburg in ihrem territorialen Bestand durch die Abtrennung der östlich der Oder gelegenen Kreise. Obwohl im ganzen zu den relativ gering besiedelten, agrarischen Gebieten zählend, wies Mark Brandenburg auch industrielle Schwerpunkte auf, vor allem rund um Berlin und an der Oder, darunter Betriebe der Metallurgie, der Elektrotechnik und der Textilindustrie.
In Anlehnung an die frühere preußische Provinz wurde auch die Provinz Sachsen konstituiert. In ihr Gebiet wurden der ehemalige Freistaat Anhalt und zwei braunschweigische Enklaven einbezogen. Dieses Territorium und seine Menschen waren mit preußischer wie mit sächsischer Geschichte verbunden. Hier hatte die Reformation des Martin Luther ihren Ausgang genommen, hier waren Johann Sebastian Bach und Georg Friedrich Händel geboren. Die Provinz Sachsen zählte zu den verhältnismäßig dicht besiedelten Territorien. Sie umschloß die ertragreiche Landwirtschaft der Börde ebenso wie die industriellen Ballungsgebiete im Raum Halle-Merseburg mit ihren Chemiewerken oder die Magdeburger Industrie mit ihren Betrieben des Schwermaschinenbaus.
Waren auch kein Land und keine Provinz für sich allein lebensfähig, so stellten sie doch territoriale Einheiten dar, die nicht willkürlich verfügt, sondern historisch und verfassungsgeschichtlich in sich begründet waren und in denen das demokratische Aufbauwerk zu ersten Ergebnissen geführt werden konnte. Sie bildeten einen geeigneten strukturellen Rahmen, in dem die Überreste des Faschismus liquidiert und antifaschistisch-demokratische Umgestaltungen vollzogen werden konnten. In den Ländern und Provinzen verbanden sich die gesetzgeberischen Akte und die Aktivitäten der Verwaltungsorgane mit durch die Arbeiterparteien ausgelösten Aktivitäten der Werktätigen. Die leitenden Gremien der Länder und Provinzen bildeten für einige Jahre die oberste Ebene deutscher Eigenverantwortung im staatlichen Bereich; sie arbeiteten un. ter Anleitung und Kontrolle der sowjetischen Besatzungsorgane und zunehmend als deren geachtete Partner. Die Länder und Provinzen gliederten sich in Kreise, deren Verwaltungen von Landräten geleitet wurden. In den Provinzen existierte oberhalb der Kreisebene außerdem noch die Ebene der Oberlandratsämter bzw. Regierungsbezirke.
Die Berücksichtigung des föderativen Prinzips in der administrativen Struktur der sowjetischen Besatzungszone entsprach den gemeinsamen Vorstellungen der Alliierten. So ließen sich die verschiedenen Besatzungszonen zugehörigen Länder auch am ehesten zu einer einheitlichen, antifaschistisch-demokratischen deutschen Republik zusammenführen. Andererseits gebot die Zeit, verlangten das Darniederliegen der Wirtschaft und die Unterbrechung der Verkehrswege und Nachrichtenverbindungen, daß jedes Land und jede Provinz zunächst die eigenen Probleme nach besten Kräften bewältigte. Dabei konnten negative Auswirkungen auf die gegenseitigen Beziehungen, vor allem auf den Austausch industrieller und agrarischer Produkte, auf den Ausgleich zwischen vom Krieg schwer oder weniger schwer heimgesuchten Gebieten nicht ausbleiben. Gerade unter diesen Bedingungen erwies sich die ordnende, auf gemeinsames Vorgehen hinwirkende Einflußnahme der in Aktionseinheit handelnden Arbeiterparteien als unersetzlich. Sie trug wesentlich dazu bei, daß in allen Ländern bzw. Provinzen beim Aufbau und bei den antifaschistisch-demokratischen Umgestaltungen übereinstimmend zu Werke geschritten wurde.
Von der SMAD war die Aufforderung an die antifaschistisch-demokratischen Parteien ergangen, Vorschläge für die Besetzung der Präsidien der Landesbzw. Provinzialverwaltungen zu unterbreiten. Dabei legte die Besatzungsmacht Wert auf die Einbeziehung aller antifaschistisch-demokratischen Kräfte. Am 4.Juli 1945 bestätigte die SMAD die nach demokratischer Abstimmung zwischen den Parteien eingebrachten Vorschläge für die Präsidien der Landesverwaltungen von Sachsen und Mecklenburg-Vorpommern und der Provinzialverwaltung Mark Brandenburg, knapp zwei Wochen später die Vorschläge für die Präsidien der Landesverwaltung Thüringen und der Provinzialverwaltung Sachsen.
Vertreter der SMAD in einer Beratung mit der Provinzialverwaltung Mark Brandenburg. Zweiter v. l.: Karl Steinhoff, Präsident der Provinzialverwaltung
In diesen Gremien waren alle antifaschistisch-demokratischen Parteien vertreten. Präsident der Verwaltung wurde im Land Sachsen Rudolf Friedrichs (SPD), im Land Mecklenburg-Vorpommern Wilhelm Höcker (SPD), im Land Thüringen Rudolf Paul (parteilos), in der Provinz Sachsen Erhard Hübener (LDPD) und in der Provinz Mark Brandenburg Karl Steinhoff (SPD). Die 1. Vizepräsidenten waren solche bewährten kommunistischen Funktionäre wie Kurt Fischer im Land Sachsen, Hans Warnke in Mecklenburg-Vorpommern, Ernst Busse in Thüringen, Robert Siewert in der Provinz Sachsen oder der Mitstreiter des Nationalkomitees „Freies Deutschland“ Bernhard Bechler in Mark Brandenburg. In den Landesverwaltungen und ihren Präsidien wurden aber auch Politiker tätig, die ihre Ämter nutzten, um konsequent antifaschistisch-demokratische Maßnahmen zu behindern, wenn nicht gar zu durchkreuzen.
Die KPD und die klassenbewußten Sozialdemokraten hielten es für unerläßlich, schrittweise eine neue, antifaschistisch-demokratische Staatsorganisation zu errichten. Entsprechend hieß es in der „Verordnung über den personellen Neuaufbau der Landesverwaltung Sachsen“ vom 24.Juli 1945, es werde „jetzt nicht der Wiederaufbau oder die Säuberung des alten, sondern die Bildung eines neuen, demokratischen Verwaltungsapparates, gestützt auf alle freiheitlichen und fortschrittlichen Kräfte des Landes, durchgeführt. Nur mit diesem, mit neuem Geist erfüllten, mit neuen Menschen und Methoden arbeitenden, von allen nazistischen und unzuverlässigen Elementen freien Verwaltungsapparat wird die Landesverwaltung die groBen Aufgaben lösen können, die jetzt vor ihr stehen.“43
Am 27. Juli 1945 ordnete die SMAD mit ihrem Befehl Nr.17 den Aufbau deutscher Zentralverwaltungen (DZV) an. Bei der Ernennung der Präsidenten und leitenden Mitarbeiter dieser Verwaltungen stützte sie sich auf Vorschläge der antifaschistisch-demokratischen Parteien. Im Laufe des Monats August nahmen Zentralverwaltungen, die sich vielfach auch nur „deutsche Verwaltungen“ nannten, auf den Gebieten Verkehrswesen, Postund Fernmeldewesen, Brennstoffindustrie, Handel und Versorgung, Industrie, Landund Forstwirtschaft, Finanzen, Arbeit und Sozialfürsorge, Gesundheitswesen, Volksbildung und Justiz ihre Tätigkeit auf. In den folgenden Monaten entstanden noch die Zentralverwaltung für deutsche Umsiedler, die DZV für Statistik und die Zentrale Deutsche Kommission für Sequestrierung und Beschlagnahme (ZDK).
Sie alle hatten die Aufgabe, die SMAD bei der Ausübung der obersten Regierungsgewalt zu unterstützen. Sie arbeiteten unter unmittelbarer Leitung und Kontrolle der Fachabteilungen der SMAD und nahmen differenzierte, zweigspezifische Leitungs-, Organisations-, Regulierungs-, Verwaltungsund Kontrollfunktionen im Rahmen der sowjetischen Besatzungszone wahr. Die komplexe territoriale Verantwortung verblieb bei den Landesbzw. Provinzialverwaltungen. Ihnen gegenüber besaßen die Zentralverwaltungen keine Weisungsbefugnisse. Ebensowenig hatten sie, von wenigen Ausnahmen abgesehen, Rechtsetzungskompetenzen. Nur die DZV für Postund Fernmeldewesen und die DZV des Verkehrs übten gegenüber den ihnen direkt nachgeordneten Nachrichten-, Eisenbahnund Wasserstraßeninstitutionen eine zentrale Leitung aus.
Die deutschen Zentralverwaltungen waren von der SMAD zugleich als eine Vorstufe und als ein Beitrag der Sowjetunion für die Errichtung deutscher zentraler Verwaltungen im Rahmen der Alliierten Viermächteverwaltung gebildet worden. Das Schwergewicht deutscher Verantwortung für die anstehenden politischen, sozialen und geistig-kulturellen Veränderungen das unterstrich auch der Chef der SMAD, Marschall G.K. Shukow, nachdrücklich lag jedoch in den Ländern und Provinzen, deren Maßnahmen mit Hilfe der deutschen Zentralverwaltungen koordiniert und kontrolliert werden sollten.
Mit ihrer Tätigkeit in den neuen, demokratischen Verwaltungen der Gemeinden, Städte, Kreise und Länder bzw. Provinzen wie in den Zentralverwaltungen bekundeten die antifaschistisch-demokratischen Kräfte ihre Entschlossenheit, mit der alten Staatlichkeit zu brechen. Nach der Zerschlagung der zentralen Machtinstrumente des imperialistischen deutschen Staates durch die Anti-Hitler-Koalition galt es nun, auch dessen regionale und lokale Apparate und seine zahlreichen bereichsspezifischen Institutionen zu zerschlagen bzw. grundlegend demokratisch umzugestalten. Von der erfolgreichen Lösung dieser Aufgabe und der Bewährung der neuen Staatsorgane in der konstruktiven Aufbauarbeit hing das Schicksal der antifaschistisch-demokratischen Umwälzung in hohem Maße ab.
Erste Schritte zur Ingangsetzung von Industrie und Verkehrswesen
Voraussetzung, um das Leben der Bevölkerung wieder in normale Bahnen zu lenken und die Wirtschaft in Gang zu bringen, war die Elektroenergieversorgung der Städte und Gemeinden; denn seit Ende ApriV/ Anfang Mai funktionierte die Energiewirtschaft in dem von den sowjetischen Truppen besetzten Gebiet nicht mehr. Nur in einigen Regionen war es Arbeitern in Energiebetrieben gelungen, den faschistischen Befehlen trotzend, die Elektroenergieerzeugung auch während der Kampfhandlungen aufrechtzuerhalten, doch auch hier war das Übertragungsnetz für Elektroenergie stark in Mitleidenschaft gezogen. Darum galt die besondere Aufmerksamkeit der sowjetischen Besatzungsorgane, der Bürgermeister und der neuen Verwaltungen, der Arbeiter und Ingenieure den Energiebetrieben, den Kraftwerken und den Übertragungsanlagen.
Vor den Beschäftigten der Energiebetriebe stand die Aufgabe, die intakten Kraftwerke in den Städten wieder anzufahren, Schäden an Kraftwerksanlagen, so gut es unter den Bedingungen der ersten Nachkriegswochen möglich war, zu beheben und darin bestand das Hauptproblem das sehr in Mitleidenschaft gezogene Netz der Übertragungsanlagen wieder zu knüpfen. Die Struktur der Energiewirtschaft in der Ostzone war durch eine starke Konzentration der Erzeugungskapazität in Mitteldeutschland und durch ein dichtes Netz von Übertragungsanlagen sowie durch eine Vielzahl regionaler Kraftwerke gekennzeichnet. Die Großkraftwerke im Land Sachsen und in der Provinz Sachsen konnten erst dann die Elektroenergieversorgung der Städte und industriellen Ballungsgebiete übernehmen, wenn die Übertragungsanlagen wieder funktionsfähig waren.
In Berlin war am 27. April 1945 die Energieversorgung endgültig zusammengebrochen. Aber schon am folgenden Tag hatten sowjetische Offiziere das Kommando über die großen Kraftwerke übernommen und Pioniereinheiten befohlen, die Hochspannungsleitungen zu den Kraftwerken instand zu setzen. So konnten die Arbeiter und Ingenieure des Kraftwerkes Klingenberg in Rummelsburg bereits am 28. April die Notstromversorgung aufnehmen. Am 12. Mai 1945 hatte der Kriegsrat der 1. Belorussischen Front detaillierte Maßnahmen zur umfassenden Wiederherstellung der Elektroenergieversorgung für Berlin festgelegt, die bis . zum Sommer 1945 im wesentlichen ausgeführt waren. Entsprechende Schritte wurden in der gesamten sowjetischen Besatzungszone unternommen.
Die Zunahme der Elektroenergieerzeugung hing von der Bereitstellung der erforderlichen Brennstoffe ab. Bergleute hatten schon in den ersten Tagen nach der Befreiung vom Faschismus die Kohleförderung und die Brikettherstellung wieder aufgenommen. Im Braunkohlenund Großkraftwerk Böhlen, das durch Bombardierungen stark beschädigt war, trafen sich am 1.Mai 1945 fünf kommunistische Arbeiter mit einigen Ingenieuren und berieten, wie man das Werk wieder betriebsfähig machen könne. Sie riefen die Belegschaftsmitglieder in 36 umliegenden Ortschaften auf, wieder an die Arbeit zu gehen. Im Monat Juli wurden bereits 69424 Tonnen Brikett erzeugt, gegenüber 10582 Tonnen im Mai. In den Braunkohlengruben und Brikettfabriken der Provinz Sachsen stieg die Rohkohleförderung, und die Brikettproduktion erhöhte sich von 366876 Tonnen im Mai auf 800853 Tonnen im August 1945. Im sächsischen Steinkohlenbergbau verdoppelten die Kumpel von Mai bis Juli ihre Förderleistung.
Die Kohle konnte jedoch nur dann zu ihren Verbrauchern gelangen, wenn das Verkehrswesen wieder funktionierte. Eine Belebung der Wirtschaft und die Versorgung der Bevölkerung setzten also die Behebung der schweren Schäden im Verkehrswesen voraus. Das im allgemeinen gut ausgebaute Verkehrsund Nachrichtennetz war seit den letzten Kriegstagen vollständig lahmgelegt. Die Eisenbahnknotenpunkte, die ortsfesten Anlagen und die Instandsetzungsbetriebe der Deutschen Reichsbahn waren weitgehend zerstört. Über 3600 Kilometer Gleise, mehr als 2600 Hauptund Vorsignale, nahezu 3000 Weichen und über 1 800 Stellwerke waren zerbombt, 970 Eisenbahnbrücken, darunter die Elbbrücke bei Wittenberge, nicht mehr passierbar, 65 Prozent der Reichsbahnhauptwerkstätten vernichtet. Riesige Verluste gab es auch beim rollenden Material. Hier kam zu den Zerstörungen des Krieges noch hinzu, daß zunächst die nach Westen flüchtenden Faschisten und anschließend die abziehenden Amerikaner und Briten einen großen Teil des Lokomotivund Wagenparks weggeführt hatten. Sprengungen von Brücken und Schleusen hatten auch die Binnenschiffahrt zum Stillstand gebracht.
Beseitigung der Trümmer im Leunawerk durch Arbeiter und Angestellte, 1945
Die Arbeiter und Angestellten der Deutschen Reichsbahn gingen unmittelbar nach Ende der Kampfhandlungen daran, die Bahnanlagen betriebsbereit zu machen und beschädigte Lokomotiven und Waggons zu reparieren. Die in Dresden erscheinende „Volkszeitung“ berichtete am 3. August 1945: „Eine Riesenhalle in Zwickau, in der unter Hitler für Krieg und Zerstörung gearbeitet wurde, steht leer … Einige Arbeiter mit klarem Kopf und dem Willen zum Aufbau machen einen Plan, lassen ihn bestätigen und fangen an zu arbeiten. In dieser Halle werden jetzt Eisenbahnwaggons repariert. Mit 30 Arbeitern fing man dort an und schaffte 20 Waggons im Monat. Nach Beschaffung des nötigen Materials konnten 100 Arbeiter eingestellt werden, die Zahl der reparierten Waggons stieg auf 80. Das genügte den Zwickauer Arbeitern natürlich nicht. Sie haben sich für die nächsten drei Monate das Ziel gesetzt, mit 300 Arbeitern monatlich 160 Waggons zu reparieren.“ In Riesa setzten Arbeiter und Ingenieure des Stahlwerkes die gesprengten Elbbrükken instand, und Arbeiter der Maxhütte Unterwellenborn halfen den Eisenbahnern, den stark zerstörten Bahnhof Saalfeld herzurichten.
Aufräumungsarbeiten bei Bergmann-Borsig in Berlin-Wilhelmsruh
Auf ähnliche Weise wurden auch anderweitig Voraussetzungen für den Fahrbetrieb geschaffen, zunächst auf begrenzten Strecken, ohne Verbindung zum gesamten Netz. Am 11. Mai 1945 fuhr der erste Durchgangsgüterzug auf der von Eisenbahntruppen der Roten Armee notdürftig hergestellten Strecke BerlinDresden. Im Laufe des Monats Mai wurde der ständige Verkehr zwischen Berlin und Frankfurt an der Oder, Berlin und Angermünde, Berlin und Cottbus aufgenommen, um Lebensmittel und Brennstoffe zu transportieren. Unter großen Anstrengungen gelang es schließlich bis zum Sommer 1945, das Streckennetz der Eisenbahn, wenn auch vielfach provisorisch, benutzbar zu machen,
Wie in der Elektroenergiewirtschaft, im Kohlenbergbau und im Verkehrswesen nahmen auch in den anderen Industriezweigen die Beschäftigten unter unsäglichen Schwierigkeiten die Arbeit wieder auf. Häufig mußten sie zunächst zerstörte Produktionsstätten enttrümmern und verschüttete Maschinen bergen. Dabei achteten sie vielfach nicht darauf, ob sie entlohnt werden konnten. Sie brachten auch um überhaupt produzieren zu können ihr eigenes Werkzeug in die Betriebe mit. Es kam vor, daß Arbeiter und Angestellte, wie bei Opta Radio-AEG in Berlin-Steglitz, Geld sammelten, damit ihr Betrieb wieder aufgebaut werden konnte.
In diesen Frühjahrswochen leisteten auch viele Handwerker des Nahrungsmittelgewerbes Außerordentliches, um die Bevölkerung mit Grundnahrungsmitteln zu versorgen. Sobald Mehl herangeschafft war, wurde in den Bäckereien gebacken. Einzelhändler öffneten die Geschäfte, und entsprechend den neuen, von Ort zu Ort zunächst unterschiedlichen Zuteilungen gelangten wieder Lebensmittel zum Verkauf. Bauhandwerker begannen, Häuser und Wohnungen notdürftig zu reparieren.
Gewerkschaften und Betriebsräte im Ringen um die Arbeiterkontrolle
Die Initiative zur Ingangsetzung der Produktion lag vielfach bei den sich neu konstituierenden Vertretungen der Werktätigen, bei Gewerkschaftsleitungen und vor allem bei Betriebsräten. Für die klassenbewußten Arbeiter war es eine Selbstverständlichkeit, nach der Befreiung vom Faschismus die Tradition der Betriebsrätebewegung sofort wieder aufzunehmen. Doch trug diese nun einen anderen Charakter als in der Zeit der Weimarer Republik. Viele Betriebe waren von ihren Eigentümern verlassen worden. Oft taten Unternehmer oder Konzernleitungen nichts, um die Produktion in Gang zu bringen. Vielmehr waren es Arbeiter und Angestellte, die sich um die Betriebe und ihre Produktion kümmerten. Die einsetzende antifaschistisch-demokratische Umwälzung stellte die Betriebsrätebewegung vor viel weiter greifende politische und ökonomische Aufgaben, als sie je hatte bzw. haben konnte. Die allgemeine Notlage der Werktätigen übertrug ihnen zudem eine hohe Verantwortung bei der Wahrnehmung der sozialen Interessen und bei der Sicherung elementarer Lebensbedürfnisse der Arbeiter und Angestellten.
Die ersten Betriebsräte waren bereits im April/Mai 1945 entstanden, in den im Westen der sowjetischen Besatzungszone gelegenen Industriegebieten noch unter amerikanischer oder britischer Besatzung. So hatten zum Beispiel kommunistische und sozialdemokratische Bergarbeiter am 9. Mai 1945 im Lugau-Oelsnitzer Revier mit ihren Kollegen beraten, was zu tun sei, um aktive Nazis aus den Schachtanlagen zu entfernen und die Förderung wieder aufzunehmen. Der kurz darauf gebildete Gesamtbetriebsrat der Gewerkschaft „Gottes Segen“ hatte als eine der ersten Maßnahmen die Auflösung des Aufsichtsrates verfügt und drei Bergarbeiter und zwei Ingenieure mit der Bildung eines neuen verantwortlichen Gremiums beauftragt. Der faschistische Werkdirektor war festgenommen und den Amerikanern übergeben worden. Mit der Organisierung der. Kohleförderung, der Behebung der Kriegsschäden erfolgte zugleich die Entfernung von Nazifunktionären aus den Werkleitungen. Die Betriebsräte sorgten sich in diesen Tagen und Wochen aber auch um die Versorgung der Belegschaften mit Lebensmitteln.
Die meisten Betriebsräte rangen um umfassende Mitspracherechte und um Arbeiterkontrolle über die Produktion und die Verwaltung. Am 18. Juli 1945 wurden in Berlin „Vorläufige Richtlinien für die Arbeit der Betriebsausschüsse und des Hauptausschusses der AEG mit den Betriebsleitungen und Geschäftsleitungen“ erlassen, die in sechs Punkten Aufgaben und Rechte der Betriebsräte fixierten. In diesen Richtlinien, die als typisch für die Errungenschaften der fortgeschrittensten Betriebsräte der damaligen Zeit angesehen werden können, hieß es unter anderem: „1. Alle Einstellungen und Entlassungen dürfen nur mit Zustimmung des Betriebsausschusses erfolgen. Für die bestehende Betriebsund Geschäftsleitung und alle bereits abgeschlossenen Arbeitsverhältnisse ist diese Zustimmung nachzuholen. Ebenso bedarf die Um- und Neubesetzung aller Arbeitsplätze sowie die Versetzung von einem Werk zum anderen der Zustimmung der Betriebsausschüsse. Die eben genannten Maßnahmen sollen vor allem dem Zweck dienen, die ehemaligen aktiven Faschisten, Mitglieder oder Nichtmitglieder der NSDAP (oder einer ihrer Gliederungen), aus den Betrieben zu entfernen oder ihre Einstellung zu verhindern. 2. Alle sozialen Fragen (Unterstützung, Darlehen, Werkküche, Werkswohnungen) und Arbeitsschutzfragen können nur im Einvernehmen mit den Betriebsausschüssen geregelt werden … 3. Sämtliche Lohnund Gehaltsfragen und Sonderzuweisungen sind zwischen der Firma und dem Betriebsausschuß im Rahmen der von den zuständigen Gewerkschaften mit der Firma abgeschlossenen Tarifverträge zu regeln. 4. Bei der Produktionsgestaltung und Verwaltung ist der gewerkschaftliche Betriebsausschuß mitbestimmend … 5. Teilnahmerecht an allen Verhandlungen der Direktion mit Zivilund Besatzungsbehörden, Banken, Konzernfirmen etc. 6. Sämtliche Bekanntmachungen bedürfen der Gegenzeichnung des Betriebsobmannes.“* Im Zusammenhang mit der Kontrolle der Produktion und der Verwaltung war ausdrücklich von der Mitarbeit an der Planung und Durchführung der Produktion und von Einsichtnahme in die Geschäftsunterlagen die Rede.
In einer am 15. August 1945 unterzeichneten „Vereinbarung zwischen Vorstand und Hauptbetriebsausschuß AEG Berlin über Aufgaben der Betriebsausschüsse* mußte die Konzermleitung diese Punkte weitgehend akzeptieren. Diese vom Vorstand des FDGB Groß-Berlin in einer Reihe von Schulungsmaterialien propagierte Vereinbarung gewann orientierende Bedeutung.
Solche Mitbestimmungsund Kontrollrechte, wie sie auch in den Aufrufen beider Arbeiterparteien gefordert wurden, mußten den Unternehmern und Konzernvertretern in harten Auseinandersetzungen abgerungen werden. Hier lag ein wichtiges Bewährungsfeld der Aktionseinheit von Kommunisten, Sozialdemokraten und parteilosen Gewerkschaftern. Besonders in der Personalpolitik stießen die Interessen der Betriebsräte mit denen der Konzernleitungen hart aufeinander. Die Direktionen widersetzten sich den Forderungen der Belegschaftsvertreter nach der Entfernung bzw. Nicht-wieder-Einstellung aktiver Nazis. Sie versuchten, ihnen genehme Konzernangestellte ohne Rücksicht auf deren politische Vergangenheit gegen den Protest der Arbeiter in leitenden Positionen zu halten. So sah sich im Stahlwerk Riesa im August 1945 der Betriebsrat veranlaßt, gegen die Einstellung eines Mannes zu kämpfen, der nach Ansicht des Vertreters von Konzernchef Flick „bloß Mitglied der NSDAP und Wehrwirtschaftsführer und Inhaber des Kriegsverdienstkreuzes I. Klasse gewesen“ war und „pur einmal drei Gefolgschaftsmitglieder ins Konzentrationslager gebracht“ hatte.45
Das Ringen um Mitbestimmung war zugleich eine Kampfansage an jene Kapitalisten, die erneut Unternehmerorganisationen bilden wollten, die nichts anderes sein konnten als die mehr oder weniger getarnte Fortführung jener Verbände, die die Nazipartei mitfinanziert, die profitable Rüstungswirtschaft und die Ausplünderung anderer Länder mitorganisiert hatten. Die SMAD gab unmißverständlich zu verstehen, daß derartige Verbände nicht geduldet werden.
Auch Wortführer der nichtmonopolistischen Bourgeoisie setzten sich gegen den Anspruch der Arbeiter und Angestellten auf Mitbestimmung in den Betrieben zur Wehr. Am 31. Juli 1945 wandte sich in einer Zusammenkunft von Unternehmern und Gewerkschaftsfunktionären der Unternehmer und Landesvorsitzende der Thüringer CDU, Georg Große, gegen eine Kontrolle der unternehmerischen Geschäftsführung durch die Betriebsräte.
Angesichts des Widerstandes des Kapitals gegen umfassende Rechte der Betriebsräte verlangten viele Belegschaften eine gesetzliche Regelung des Betriebsrätewesens. In Thüringen entfaltete sich in den Sommermonaten eine starke gewerkschaftliche Bewegung für die juristische Verankerung umfassender Mitbestimmungsrechte der Arbeiterklasse. Im August entwarfen Erfurter Gewerkschafter eine „Verordnung über die Aufgaben und Rechte der Betriebsräte“. Während Betriebsräte, Gewerkschaftsfunktionäre und Belegschaften diese Verordnung noch erörterten, wur‚den in vielen Betrieben ihre grundlegenden Prinzipien bereits praktiziert. Nach eingehender Debatte beauftragte die Erfurter Betriebsrätevollversammlung die Thüringer Gewerkschaftsleitung, diesen vom antifaschistisch-demokratischen Geist geprägten und von der Arbeiterschaft getragenen Entwurf der Betriebsräteverordnung der Landesverwaltung zu übergeben. Er wurde am 10. Oktober 1945 zum „Gesetz… über die Bildung vorläufiger Betriebsräte, ihre Rechte und Aufgaben“46 erhoben, zum ersten Betriebsrätegesetz in Nachkriegsdeutschland.
Neuordnung des Finanzwesens
Das energische Handeln der fortgeschrittensten Werktätigen, ihre Arbeitstaten und ihr Einstehen für Arbeiterrechte kennzeichneten den sozialen Charakter der wieder anlaufenden Produktion. Den Bemühungen um die Demokratisierung der Wirtschaft konnte aber nur Erfolg beschieden sein, wenn auch in der Sphäre des Geld-, Bankund Kreditwesens progressive Veränderungen eintraten.
Mit dem Auseinanderbrechen des staatsmonopolistischen Regulierungssystems war auch das staatliche Finanzwesen zerfallen. Die Währung war zerrüttet, die Kassen der Versicherungen und der Verwaltungen waren leer. Es war unklar, wovon Löhne oder Renten gezahlt, wie Aufbauarbeiten finanziert werden sollten. Mit der Neuordnung des Finanzwesens entschied sich wesentlich, wer künftig den Haupteinfluß auf die Wirtschaft ausüben würde: das schuldbeladene Finanzkapital oder die Organe der antifaschistischen Demokratie.
Am 23.Juli 1945 wies der Oberste Chef der SMAD die Landesund Provinzialverwaltungen an, das staatliche Finanzwesen zu organisieren. Er verfügte, daß in jeder Landesbzw. Provinzialverwaltung Finanzabteilungen mit der Kompetenz eingerichtet werden, den staatlichen Haushalt zu führen, die Steuern zu erheben, zu verwalten und zu kontrollieren sowie die Löhne zu überwachen. Die bis Kriegsende gültigen Steuern und Abgaben an den Staat -Minderheiten diskriminierende Abgaben und Sonderabgaben zugunsten der Deutschen Arbeitsfront ausgenommen waren weiter zu entrichten. Die Länder und Provinzen hatten neue Banken mit Niederlassungen in den Kreisen und Städten einzurichten. Damit wurde zugleich die unmittelbar nach dem Ende der Kampfhandlungen von sowjetischen Kommandanten verfügte SchlieBung der monopolkapitalistischen Finanzinstitute bekräftigt. Seinen Rückhalt besaß das neue Finanzsystem in der Garantieund Kreditbank, die als Notenbank und Finanzinstitut der SMAD fungierte. Mit all diesen Maßnahmen wurden der Reaktion Waffen aus der Hand geschlagen, die sie wiederholt gegen den gesellschaftlichen Fortschritt eingesetzt hatte. Es gelang, die Währung einigermaßen stabil zu halten und die Inflation einzudämmen.
Unmittelbar nach Erlaß dieses finanzpolitisch gewichtigen Befehls gingen die Landesund Provinzialverwaltungen daran, aus den aus der Zeit des Faschismus überkommenen Dienststellen des Finanzwesens ihren Finanzapparat aufzubauen. Im August 1945 nahm die Deutsche Zentralfinanzverwaltung in Berlin ihre Tätigkeit auf. Sie übte ihren Einfluß aus, um das neue Finanzwesen und die Haushaltpläne nach einheitlichen Grundsätzen zu gestalten. Es wurde begonnen, einen Teil der in den Ländern und Provinzen erzielten Einnahmen zu konzentrieren, damit die zentralen Verwaltungen und Maßnahmen finanziert und Besatzungsund Reparationsverpflichtungen beglichen werden konnten.
Die erste Friedensernte und die neue Agrarpolitik
Als deutsche Antifaschisten die Verantwortung für den demokratischen Neuaufbau übernahmen, fanden sie infolge des Niedergangs der agrarischen Produktivkräfte in den letzten Jahren des faschistischen Krieges, des Zerfalls des volkswirtschaftlichen Organismus und vor allem der Kriegsschäden eine zerrüttete Landwirtschaft vor. Es drohte eine Ernährungskrise. Die Anwesenheit von Millionen Flüchtlingen und der einsetzende Strom von Umsiedlern verschärften noch die ohnehin angespannte Situation.
Am schlimmsten betroffen war die Landwirtschaft in den Gebieten entlang von Oder und Neiße und im Berliner Raum, wo schwere Kämpfe getobt hatten.
Im Kreis Spremberg, wo die Kriegsgeschehnisse besonders tiefe Spuren hinterlassen hatten, waren ein Viertel der dörflichen Bausubstanz in Mitleidenschaft gezogen und jedes zehnte Gebäude gänzlich zerstört. In diesem Kreis verfügte die Landwirtschaft im Vergleich zu 1939 nur noch über 28 Prozent der Pferde, 10 Prozent der Rinder, 1 Prozent der Schweine, 36 Prozent der Ziegen und 26 Prozent der Hühner. In der Ostzone insgesamt betrugen im Vergleich der Jahre 1938 und 1946 die Bestandsverluste bei Rindern 25 Prozent, bei Schweinen 65 Prozent und bei Pferden 20 Prozent. Etwa 30 Prozent der landwirtschaftlichen Maschinen waren unbrauchbar oder nicht mehr vorhanden. Am schlimmsten aber wirkte sich aus, daß Hunderttausende Bauern und Landarbeiter im Krieg ihr Leben oder ihre Gesundheit gelassen hatten und daß sich ein Großteil der Männer im arbeitsfähigen Alter in Kriegsgefangenschaft befanden.
Diese Situation der Landwirtschaft und der Mangel an Lebensmittelvorräten ließen in den ersten Wochen nach der Befreiung die Sicherung der Ernährung zu einer der schwierigsten Aufgaben der Antifaschisten in den neuen, demokratischen Verwaltungen werden. Nur die straffe Bewirtschaftung aller Ressourcen durch die Bürgermeister und Landräte sowie die Belieferung der Großstädte aus Beständen der Roten Armee verhinderten ein Ernährungschaos.
Dauerhafte Abhilfe konnte nur eine neue Agrarpolitik bringen, in der sich der zügige Wiederaufbau der Produktionsgrundlagen in der Landwirtschaft mit der Schaffung demokratischer Verhältnisse im Dorf verband. Bereits in den von der Parteiführung der KPD in Moskau vorbereiteten Materialien über die dringlichsten Aufgaben nach der Befreiung vom Faschismus hatte die KPD die vorrangigen agrarpolitischen Schritte konzipiert: Zerschlagung des faschistischen Reichsnährstandes, Aufhebung der Totalablieferungspflicht, Schaffung neuer Bestimmungen über Anbau, Viehhaltung und Ablieferung landwirtschaftlicher Produkte. Kernpunkt der neuen Agrarpolitik war die Vorbereitung und Durchführung einer demokratischen Bodenreform zugunsten der landlosen und landarmen Bauern sowie der Landarbeiter, wie sie die KPD in ihrem Aufruf vom 11.Juni 1945 proklamierte.
Mit einer ihrer ersten Maßnahmen beseitigte die SMAD das faschistische Reichsnährstandssystem. Am 18. Juni 1945 hob sie die Totalablieferung von Getreide, Kartoffeln, Gemüse und Ölsaaten auf und führte die Teilablieferungspflicht ein. Sie gestattete den Bauern, die ihnen nach Erfüllung ihrer Ablieferungsverpflichtungen verbleibenden Erzeugnisse frei das hieß unter den damaligen Bedingungeh zu höheren Preisen zu verkaufen. Einen Monat später wurde diese Regelung auf tierische Erzeugnisse ausgedehnt. Die Teilablieferungspflicht ermöglichte zum einen die Schaffung eines staatlichen Lebensmittelfonds als Basis für eine geregelte Versorgung der Bevölkerung, zum anderen interessierte sie die Bauern an der Steigerung ihrer Produktion. Dieses Ablieferungssystem, das auch auf Erfahrungen aus den frühen Jahren des Sowjetstaates gegründet war, wurde zu einem Eckpfeiler der Agrarpolitik der Arbeiterklasse und gewann große Bedeutung für die Bündnisbeziehungen zwischen der Arbeiterklasse und den werktätigen Bauern. Es spornte auch die Großbauern zur Produktionssteigerung an und entsprach damit der von der KPD in ihrem Aktionsprogramm vom 11. Juni 1945 zugesicherten Förderung der privaten Unternehmerinitiative beim wirtschaftlichen Wiederaufbau.
Zu einer Lebensfrage wurde im Sommer 1945 die schnelle und verlustarme Einbringung der Ernte. Wegen des Mangels an Arbeitskräften, Zugtieren, Transportmitteln und landwirtschaftlichen Maschinen konnte die Landbevölkerung die Ernte nur bergen, wenn sie Hilfe aus der Stadt erhielt. Die antifaschistisch-demokratischen Parteien und Organisationen wandten sich an alle Werktätigen. „Die Stadt, wir alle werden hungern, wenn dem Dorf, wenn den Landarbeitern und Bauern nicht geholfen wird. Die Ernte muß sichergestellt werden“, erklärte der Berliner Metallarbeiterverband am 8. Juli 1945. Die KPD hatte bereits am 1.Juli in der „Deutschen Volkszeitung“ ein Programm praktischer Erntehilfe unterbreitet. Auf Tagungen der Partei, auf Bürgermeisterund Landrätekonferenzen erläuterten ihre Funktionäre die Teilablieferungspflicht und die Ernteaufgaben. Von der KPD ging die Initiative für einen gemeinsamen Ernte-Aufruf des Blocks der antifaschistisch-demokratischen Parteien aus.
Die gesamte arbeitsfähige Bevölkerung in den Städten, sofern sie nicht in lebenswichtigen Betrieben tätig war, wurde durch Befehle der sowjetischen Militärverwaltung zur Erntearbeit verpflichtet. Ortsgruppen der KPD unterstützten, oft gemeinsam mit Sozialdemokraten, die Verwaltungen bei der Organisierung des Arbeitseinsatzes. So teilten sich zum Beispiel die KPD-Mitglieder in Rostock auf 40 Einsatzgruppen auf. Aus Crivitz im Kreis Schwerin wurde berichtet: „Aus der Stadt und der Umgebung wurden rund 5 000 Menschen durch das Arbeitsamt unter tätiger Mitarbeit der antifaschistischen Parteien zur Ernte eingesetzt. Die Betriebe von Crivitz sind geschlossen zur Erntearbeit abgerückt. Das Sägewerk Behrends z.B. hat mit seinen Treckern und der gesamten Belegschaft drei Wochen bei der Erntearbeit geholfen. Der Erfolg der Heranziehung aller vorhandenen Arbeitskräfte ist nicht ausgeblieben. 95% der Ernte sind bereits eingebracht.“48
Sowjetische Soldaten helfen im Kreis Stralsund beim Einbringen der Emte, Sommer 1945
Zahlreiche Landräte und Bürgermeister organisierten den Gemeinschaftseinsatz der Zugmittel und Erntemaschinen, ohne die Eigentumsrechte der Bauern anzutasten. Teilweise wurden alle Pferdegespanne, Traktoren und Lastkraftwagen der Städte an bestimmten Tagen gänzlich für die Ernte eingesetzt. Auf Initiative der Gewerkschaften stellten Betriebe einfache landwirtschaftliche Geräte her und übernahmen die Reparatur von Landmaschinen. Betriebsbelegschaften schickten Reparaturkolonnen auf die Felder.
Die örtlichen Kommandanturen der sowjetischen Militärverwaltung übten eine strenge Kontrolle über den Gang der Erntearbeiten in jeder Gemeinde aus. Die Offiziere der Landwirtschaftsabteilungen oft von Beruf Agronomen oder Zootechniker berieten die Funktionäre in den deutschen Verwaltungsorganen. Sie sicherten die Treibstoffversorgung der Traktoren. Vielfach stellten Truppenteile aushilfsweise Zugkräfte und Transportmittel zur Verfügung.
Am schwierigsten war die Lage auf den von ihren Besitzern verlassenen großen Gütern, die als Kriegsgefangene und Zwangsarbeiter in ihre Heimat zurückkehrten vielfach nahezu gänzlich von Arbeitskräften entblößt waren. Die zur geregelten Wirtschaftsführung von den Landräten bestellten Treuhänder vermochten nur mit Hilfe von Arbeitskolonnen aus den Städten die Erntearbeiten zu bewältigen. In dieser außerordentlich komplizierten Situation erwies es sich von Vorteil, daß nicht wenige der riesigen Gutsbetriebe von Wirtschaftskommandos der Roten Armee übernommen wurden. Da es sich hier in der Regel um Betriebe eingefleischter Faschisten, Militaristen und Kriegsverbrecher handelte, war damit zugleich der zu befürchtenden Sabotage der Ernte vorgebeugt. Mit Strenge wurde in den Gutsund Bauerndörfern pflichtwidriges Verhalten geahndet.
Die straffe Leitung der Erntekampagne und die beeindruckende gesellschaftliche Hilfe führten dazu, daß die werktätige Landbevölkerung Mut schöpfte und wieder optimistischer in die Zukunft sah. Die überwiegende Mehrheit der Bauern und Landarbeiter handelte mit Tatkraft. Mancherorts mußte das Getreide mit Sensen, ja sogar mit Sicheln gemäht werden und wie in Dörfern des von der Kriegsfurie heimgesuchten Randowbruchs mit Handwagen eingefahren bzw. mit Stangen abtransportiert werden.
Die Dorfbevölkerung faßte Vertrauen zu den im April und Mai 1945 aus den Reihen der Antifaschisten eingesetzten Bürgermeistern. In einer Reihe von Dörfern bildeten sich Erntekomitees bzw. Gutskomitees für die Ernte. Zum Schutz der Ernte vor Plünderern organisierte vor allem in städtischen Ballungsgebieten die neue Polizei gemeinsam mit Werktätigen den Flurschutz.
Bis Ende August 1945 wurden 90 Prozent des Getreides geborgen. Da die Anbauflächen zurückgegangen und die Hektarerträge im Vergleich zu denen der Vorkriegsjahre auf 70 Prozent gesunken waren, betrug die Getreideernte insgesamt nur 44 Prozent einer durchschnittlichen Vorkriegsernte. Diese Ernte mußte nun rasch verfügbar sein. So wurde das Getreide noch während der Ernte und der Herbstbestellung ausgedroschen und für die Pflichtablieferung erfaßt. Dies konnte erreicht werden, obwohl sich viele Bauern gegen ein Abgehen vom althergebrachten Arbeitsrhythmus sträubten und Reaktionäre das Gerücht ausstreuten, durch den vorzeitigen Drusch wolle sich die Besatzungsarmee das Getreide aneignen. Dank des raschen Erfassens des Erntegutes gelang es, die größten Versorgungslücken zu schließen. So wurde auch verhindert, daß ein Großteil der Erzeugnisse der Landwirtschaft in die Kanäle des schwarzen Marktes und in die Hände von Spekulanten gelangten. Bei der ersten Friedensernte bewiesen die antifaschistisch-demokratischen Kräfte ihre Fähigkeit, Landund Stadtbevölkerung in einer großen Kampagne zum Kampf gegen den Hunger zusammenzuführen. Im gemeinsamen Handeln unter der Losung „Stadt und Land Hand in Hand“ erkannten Bauern und Arbeiter besser die sie verbindenden Interessen. Viele Bauern und Landarbeiter begannen – während der Ernte durch die Landagitation mit den Forderungen der KPD bekannt geworden -, über die notwendige demokratische Umgestaltung des Dorfes nachzudenken. Das Bündnis zwischen Arbeiterklasse und werktätigen Bauern hatte konkreten Inhalt und praktische Formen angenommen.
Die Anfänge des kulturellen Lebens
Die mühselige Rückkehr der deutschen Bevölkerung in ein zivilisiertes und kultiviertes Leben begann in den ersten Nachkriegswochen mit der schrittweisen Wiederherstellung elementarster sozialer und kultureller Lebensbedingungen in den Städten und Gemeinden. Dies geschah unter Leitung deutscher Antifaschisten und mit tatkräftiger Unterstützung sowjetischer Besatzungsorgane. Ein Teller Suppe aus sowjetischen Feldküchen oder Notversorgungseinrichtungen antifaschistischer Ausschüsse, der Eimer sauberes Trinkwasser, das Ende des Verdunkelungszwanges, die zumindest stundenweise einsetzende Versorgung mit Stadtgas und Elektroenergie, ein allmählich wiederfunktionierendes Postund Fernmeldewesen, die Wiederaufnahme des städtischen Nahverkehrs und ähnliche Ereignisse waren Schritte auf diesem Wege.
Wenn auch in geringerem Maße, als befürchtet, trieben anfangs noch einzelne faschistische Splittergruppen ihr Unwesen, die ungeachtet ihrer fehlenden Massenbasis doch großen Schaden anrichten konnten. So erlitten die Berliner Museen ihren insgesamt größten und schwersten Verlust an Kunstwerken erst zwischen dem 14. und 18. Mai 1945. Durch eine faschistische Brandstiftung im Flakturm Friedrichshain, der den Museen als Auslagerungsdepot diente, gingen unersetzbare Werke von Rubens, Caravaggio, van Dyck, Caspar David Friedrich und anderen verloren, desgleichen bedeutende Bestände des Kunstgewerbemuseums, der Skulpturenund Antikensammlung, des Museums für Volkskunde, des Völkerkundemuseums sowie des Kupferstich-Kabinetts, des Ägyptischen und des Märkischen Museums, der Frühchristlich-byzantinischen Sammlung.
Hatten im chaotischen Durcheinander zwischen Krieg und Frieden die meisten Deutschen ans bloße Überleben gedacht, so packte sie doch bald der Hunger nach Information, nach Wissen über das, was sie erwartete, nach Orientierungspunkten für eigenes Handeln. Die ersten Plakatanschläge, Proklamationen und Bekanntmachungen der Alliierten und der antifaschistischen Verwaltungen wurden ebenso aufmerk: sam und begierig zur Kenntnis genommen wie die durch Lautsprecherwagen, Flugblätter und deutschsprachige Frontzeitungen verbreiteten Nachrichten und Befehle. Der Aufbau eines neuen, demokratischen Informationssystems erwies sich, nachdem die Goebbelsche Lügenmaschinerie hinweggefegt war, als eine der dringlichsten kulturpolitischen Aufgaben. Sie mußte von bewußt handelnden Antifaschisten in Angriff genommen werden, um im Kampf gegen die verhängnisvolle geistige Erbschaft der faschistischen Diktatur neuen Ideen, vor allem dem Gedankengut des Antifaschismus, weithin Geltung zu verschaffen.
Hohe Verantwortung fiel dabei der antifaschistischdemokratischen Presse zu. Die seit Sommer 1945 erscheinenden Tageszeitungen der politischen Parteien stellten neben der vom Kommando der Roten Armee herausgegebenen deutschsprachigen Zeitung „Tägliche Rundschau“ und der anfangs von der sowjetischen Kommandantur herausgegebenen, aber bereits am 20. Juni 1945 in die Hände des Magistrats gelegten „Berliner Zeitung“ die wichtigste Informationsquelle für die Bevölkerung dar. Bald begann auch die schrittweise Herausgabe regionaler Parteiblätter.
Am 20. Mai 1945 sprach Markus Wolf ein Sohn des antifaschistischen deutschen Arztes und Schriftstellers Friedrich Wolf im Berliner Rundfunk den ersten deutschen Kommentar nach der Zerschlagung des Faschismus. Noch im Mai konnten die Pioniere des antifaschistischen Rundfunks um Hans Mahle und Matthäus Klein bereits ein volles Tagesprogramm von 19 Stunden senden. Am 1.Oktober 1945 waren in der sowjetischen Besatzungszone schon wieder 1045000 Rundfunkempfänger registriert.
Die in Presse und Funk tätigen, von der Informationsverwaltung der SMAD angeleiteten deutschen Journalisten, vor allem die der Arbeiterparteien, deckten nun vor der Bevölkerung die Verbrechen der Nazis auf. Sie führten die Auseinandersetzung mit den faschistischen Irrlehren. Sie benannten die Ursachen der katastrophalen Situation und prangerten deren Urheber an. Sie erläuterten die gemeinsamen Ziele der antifaschistisch-demokratischen Kräfte, berichteten über die ersten Erfolge des Neuaufbaus und trugen so dazu bei, immer breitere Kreise der Bevölkerung zum Mittun zu bewegen.
Die Menschen, die die harte Arbeit zur Normalisierung des Lebens, das schwere Werk des Neuaufbaus und der Wiedergutmachung zu bewältigen hatten, bedurften der Ermunterung und Ermutigung durch ein kulturell-künstlerisches Angebot wie auch der Entspannung durch Unterhaltung. Schon bald nach der Befreiung erlaubten Ortskommandanten der Roten Armee und antifaschistische Verwaltungen in zahlreichen Städten und Gemeinden Kinderfeste, Varieteveranstaltungen und Konzerte. In Lichtspieltheatern gelangten sowjetische. Filme zur Aufführung wie auch Streifen deutscher Produktion, nachdem diese durch sowjetische Beauftragte geprüft und nazistische bzw. antisowjetische Passagen ausgemerzt worden waren.
Nach einem Bericht des Chefs für Rückwärtige Dienste der sowjetischen Besatzungstruppen in Deutschland, N. A. Antipenko, spielten am 21. Juni 1945 allein in Berlin 45 Varietes und Kabaretts sowie 127 Kinos, die täglich von etwa 80.000 bis 100.000 Personen besucht wurden. Zwischen Trümmern entfaltete sich eine kulturelle Aktivität, die ausländische Beobachter in Erstaunen versetzte. Schon am 18. Mai 1945 war Beethovens 9. Symphonie in einem gutbesuchten öffentlichen Rundfunkkonzert gespielt worden, und Ende Mai hatte Ernst Legal im Berliner RenaissanceTheater den unverwüstlichen Schwank „Der Raub der Sabinerinnen“ herausgebracht. Im Sommer und Herbst 1945 begannen die meisten Theater der sowjetischen Besatzungszone mitunter in provisorischen Spielstätten die neue Spielzeit. Leipzig erlebte am 29.Juli in einem notdürftig hergerichteten Konzertsaal eine Aufführung von Beethovens „Fidelio“. Eine der ersten Verordnungen der Landesverwaltung Sachsens hatte die Ehrung der am 22. April 1945 verstorbenen großen deutschen Graphikerin und Bildhauerin Käthe Kollwitz zum Inhalt. Die ersten Ausstellungen der bildenden Kunst, zum Teil antifaschistischen Künstlern wie Ernst Barlach und Käthe Kollwitz gewidmet, öffneten ihre Pforten.
Ankündigung der ersten Konzerte in Berlin, Sommer 1945
Eine unvergängliche Kulturtat vollbrachten Angehörige der Roten Armee und sowjetische Sachverständige, die den Schutz der Schlösser und Gärten von Sanssouci übernommen hatten, die Schätze der Dresdner Gemäldegalerie und andere Kunstwerke, die Bestände von Bibliotheken und Archiven bargen und deren Erhaltung bzw. wie vielfach notwendig war Restaurierung sicherten. Die ausgelagerten, Feuchtigkeit, Schmutz und anderen schädlichen Einwirkungen ausgesetzten Gemälde der Dresdner Galerie befanden sich zum Teil bereits in einem so desolaten Zustand, daß ihre Rettung kaum noch möglich schien.
Neuer Antrieb erwuchs dem kulturellen Leben aus den Aktivitäten der antifaschistisch-demokratischen Parteien und Organisationen. Mit dem Befehl Nr. 2 der SMAD war auch die Genehmigung erteilt worden, „Kultur-, Bildungs- und andere Aufklärungsanstalten und -organisationen“ zu schaffen.” KPD und SPD, die sich in ihren Aufrufen für die demokratische Erneuerung der deutschen Kultur ausgesprochen hatten, waren bemüht, in den eigenen Reihen Kulturtraditionen der Arbeiterklasse neu zu beleben. Die Veranstaltungen, mit denen sie sich nicht selten gemeinsam an die Werktätigen wandten, wurden häufig durch Musik und Rezitation umrahmt. Die alten Arbeiterlieder erklangen wieder, und das im antifaschistischen Kampf entstandene Liedgut fand nun Verbreitung.
Zu den dringlichsten Anliegen aller antifaschistisch-demokratischen Kräfte gehörte die Sorge um die nachwachsende Generation. Schon am 11. Juni 1945 hatte der Berliner Magistrat, in dem Otto Winzer und Ernst Wildangel (beide KPD) verantwortliche Funktionen auf dem Gebiet der Volksbildung ausübten, vorläufige Richtlinien für die Wiedereröffnung der Schulen erlassen. Er ordnete an, unverzüglich alle Nazis aus dem Bereich der Volksbildung zu entfernen und der Verwahrlosung der Kinder durch einen vorläufigen Schulbetrieb Einhalt zu gebieten. Am 25. August 1945 erließ die SMAD ihren Befehl Nr. 40, der die Wiederaufnahme des Schulunterrichts für den “1. Oktober 1945 vorsah und dazu die Vorbereitung neuer Lehrpläne und Lehrbücher und die Gewinnung neuer Lehrer anwies. Auf seiner Grundlage entfalteten die von Paul Wandel geleitete Deutsche Verwaltung für Volksbildung (DVV) und die Volksbildungsorgane in den Ländern und Provinzen der sowjetischen Besatzungszone eine intensive Tätigkeit zur allgemeinen Wiedereröffnung und Demokratisierung der Schulen.
Zum herausragenden künstlerischen wie kulturpolitischen Ereignis des Jahres 1945 wurde die Aufführung von Gotthold Ephraim Lessings „Nathan der Weise“ mit Paul Wegener, Gerda Müller und Eduard von Winterstein in den Hauptrollen, die am 7. September 1945 im Deutschen Theater in Berlin Premiere hatte. Auch das Dresdner Schauspielhaus und einige kleinere Theater eröffneten mit Lessings humanistischem Drama. Sein aufklärerischer Appell, sein Ruf nach Toleranz und sein faszinierender Entwurf eines einträchtigen Zusammenlebens von Menschen aller Völker, Rassen und Religionen übte nach der Barbarei des Faschismus und des Krieges eine tiefe Wirkung auf die zeitgenössischen Betrachter aus, motivierte sie, nicht beiseite zu stehen, wenn Handeln für eine bessere, menschenwürdigere Zukunft geboten war.
Neubeginn unter westalliierter BesatzungInhaltsverzeichnis#
- 1 Neubeginn unter westalliierter Besatzung
- 1.1 Amerikanische, britische und französische Besatzungspolitik in ihrer Anfangsphase
- 1.2 Auftragsverwaltungen und „politische Quarantäne“. Das Rheinstaatprojekt
- 1.3 Die Arbeiterparteien unter den Bedingungen der Halblegalität und nach ihrer Zulassung
- 1.4 Gründerkreise bürgerlicher Parteien auf der Suche nach politischem Profil
- 1.5 Monopolkapital und Besatzungsmächte
Amerikanische, britische und französische Besatzungspolitik in ihrer Anfangsphase
Amerikanische und britische Truppen hatten im September 1944 die deutsche Westgrenze überschritten und im März 1945 den Rhein erreicht. So verfügten sie im Sommer 1945 bereits über einige Monate Erfahrungen in der Besatzungspolitik. Frankreich, das erst durch die Krimkonferenz zur Übernahme einer Besatzungszone und zur Teilnahme am alliierten Kontrollmechanismus aufgefordert wurde, übernahm faktisch unvorbereitet seine Besatzungsaufgaben. Im Zusammenhang mit der Bildung des Alliierten Kontrollrates hatten die Westalliierten Anfang Juli 1945 mit ihren Truppen endgültig die ihnen zugewiesenen Besatzungszonen bezogen.
Paul Wegener und Eduard von Winterstein in Lessings „Nathan der Weise“ im Deutschen Theater in Berlin, 1945
Die britische Besatzungszone umschloß vorwiegend ehemals preußische Gebiete, die Provinzen Hannover, Schleswig-Holstein, Westfalen und den Norden der Rheinprovinz, dazu vor allem die Länder Oldenburg, Braunschweig — bis auf einige Exklaven -, Lippe, Schaumburg-Lippe sowie die Freie und Hansestadt Hamburg und zur Freien Hansestadt Bremen gehörende Gebiete. In der britischen Zone lag — mit dem Ruhrgebiet als Herzstück — der bei weitem überwiegende Teil der deutschen Kohleförderung, der Eisengewinnung und der Stahlerzeugung sowie auch der weiterverarbeitenden Eisenindustrie. Mit Hamburg gehörte auch der bedeutendste deutsche Hafen zu dieser Zone. Die Briten übernahmen Besatzungsfunktionen im dichtestbesiedelten und bevölkerungsreichsten Gebiet Deutschlands, dessen Bewohner meist in großen und mittleren Städten lebten. Nur in Schleswig-Holstein und dem späteren Niedersachsen gab es ausgedehnte agrarische Regionen. Somit war die britische Zone in hohem Maße auf die Einfuhr landwirtschaftlicher Produkte angewiesen. Großbritannien wurde sich bald bewußt, welche Verantwortung ihm für das Überleben der deutschen Bevölkerung in den industriellen Ballungsgebieten des nordwestdeutschen Raumes auferlegt war.
Die festgenommenen Mitglieder der Reichsregierung Dönitz beim Verlassen des britischen Hauptquartiers, Mai 1945. V.I.n.r. neben der britischen Ordonnanz: Speer, Dönitz und Jodl
Zur amerikanischen Besatzungszone gehörten vor allem Bayern — das nach dem Zerfall Preußens größte, nun wieder sein Eigengewicht stark hervorkehrende deutsche Land — ohne die Pfalz, der überwiegende Teil des Landes Hessen und der Provinz Hessen-Nassau und der Norden der Länder Baden und Württemberg. Zudem hatten die USA einen Hafen gefordert und die Städte Bremen und Bremerhaven zugesprochen erhalten, die so zu Enklaven in der britischen Zone wurden. Die amerikanische Zone verfügte neben landwirtschaftlichen Regionen über Gebiete mit einer hochentwickelten verarbeitenden Industrie, die stark von Rohstoffen und Zulieferungen aus anderen Zonen abhängig waren. Da die Masse der Bevölkerung in Dörfern und kleineren Städten lebte, war das Ernährungsproblem hier nicht so akut wie in der britischen Zone.
An Territorium, Bevölkerungszahl und -dichte deutlich kleiner als die anderen Zonen war die französische Besatzungszone, die auch als einzige an das Territorium der besetzenden Macht angrenzte. Die französische Zone umfaßte vor allem den Süden der ehemaligen preußischen Rheinprovinz mit dem Saargebiet, die Pfalz, Rheinhessen sowie den Süden Badens und Württembergs unter Einschluß des ehemaligen preußischen Regierungsbezirkes Sigmaringen (Hohenzollern). Vorherrschend waren Kleinindustrie und Kleinwirtschaft, ausgenommen im schwerindustriellen Saargebiet und im Gebiet von Ludwigshafen mit seiner chemischen Industrie.
Mithin war auch bei der Bildung der westlichen Besatzungszonen an frühere föderative Gliederungen angeknüpft worden, wobei sich territorial-administrative Neugliederungen nötig machten, wie sie in den ersten Nachkriegsjahren auch vollzogen wurden. Auch von den westlichen Besatzungszonen war keine so strukturiert, daß sie für sich genommen ökonomisch existenzfähig gewesen wäre.
Die westalliierte Besatzungspolitik, die der jeweiligen Deutschlandpolitik der imperialistichen Staaten untergeordnet war, ging in ihrer Anfangsphase vor allem von folgenden Voraussetzungen aus: Zu besetzen war ein Feindstaat, der einen erbarmungslosen Krieg geführt und sich über alle Normen des Völkerrechts und der menschlichen Moral hinweggesetzt hatte. Damit verband sich die Vorstellung, die Deutschen seien ein in seinem nationalen Wesen faschistisches Volk und mit einer handlungsfähigen deutschen antifaschistischen Bewegung sei nicht zu rechnen. Wegen des bis fünf Minuten nach zwölf geführten Krieges und unter dem Eindruck der Goebbels-Propaganda erwarteten die westlichen Besatzungsorgane Terrorakte fanatisierter Nazis, Aktionen des von den geschlagenen Faschisten angedrohten „Wehrwolfs“ in gefahrbringendem Ausmaß. Deshalb erhielten die Besatzungsorgane die Anweisung, daß Deutschland „als ein besiegter Feindstaat anzusehen und entsprechend zu behandeln ist.“
Anfangs waren in den westalliierten Besatzungsorganen Offiziere und Soldaten tätig, die unter Einsatz ihres Lebens die faschistischen Aggressoren bekämpft hatten. Nicht wenigen von ihnen war es ernst mit Entnazifizierung, Entmilitarisierung und Dekartellisierung. Auf den sogenannten „weißen Listen“ mit den Namen deutscher Politiker, die zur Zusammenarbeit herangezogen werden sollten, standen jedoch fast ausnahmslos von den Nazis gemaßregelte bürgerliche Politiker und einige Funktionäre der reformistischen Arbeiterbewegung, bei deren Mehrzahl es sich keinesweg um Personen handelte, die mit den in alliierten Beschlüssen fixierten Zielen konform gingen. Andererseits schritten die Briten nur zögernd gegen die sogenannte Geschäftsführende Reichsregierung unter Karl Dönitz ein, die sich in Flensburg mit den Überresten der Wehrmachtführung und noch intakten militärischen Einheiten umgeben hatte. Am 23. Mai jedoch wurden auf Grund sowjetischer Proteste und unter dem Druck der öffentlichen Meinung Dönitz, die Mitglieder seiner „Regierung“ und etwa 300 Generale und Offiziere festgenommen.
Im Frühjahr 1945 startete das gemeinsame westalliierte Oberkommando die langfristig vorbereitete Aktion „Goldcup“, in deren Ergebnis bei Fürstenhagen in der Nähe von Kassel das „Ministerial Collecting Center“ errichtet wurde. 1289 leitende Beamte ehemaliger deutscher Reichsbehörden und 834 Tonnen Dokumente wurden hier zu dem Zweck konzentriert, personelle und Arbeitsgrundlagen für deutsche Zentralverwaltungen bereitzustellen. Am 6. Juni 1945 ‚gab US-Oberbefehlshaber Dwight D. Eisenhower in einem Bericht an das State Department seiner Skepsis über das Funktionieren der Viermächteverwaltung Ausdruck und empfahl Vorbereitungsarbeiten für eine gesonderte Verwaltung der amerikanischen Zone mit der Perspektive auf einen westzonalen Zusammenschluß. Analoge Empfehlungen unterbreitete der britische Oberbefehlshaber Bernard L. Montgomery dem Kontrollamt in London.
Der Sitz von OMGUS im beschlagnahmten Gebäude der IG-Farben in Frankfurt am Main. US-Militärgouverneur Dwight D. Eisenhower in seinem Arbeitszimmer, 1945
Grundlage der amerikanischen Besatzungspolitik war die Anfang Mai 1945 vom Generalstab der Streitkräfte der USA in letzter Überarbeitung erlassene Direktive JCS 1067/8 für den Oberbefehlshaber der Besatzungstruppen, an deren Inhalt sich in der ersten Phase auch eine entsprechende Direktive der britischen Besatzungsbehörde anlehnte. Sie galt uneingeschränkt bis zum August 1945; dann wurde sie den Potsdamer Beschlüssen untergeordnet und revidiert.
Die Direktive JCS 1067/8 enthielt der Abrechnung mit dem Faschismus dienende Richtlinien, auf die sich die überzeugten Nazigegner in den westalliierten Armeen stützen konnten. Auf ihrer Grundlage erfolgten die Verhaftung und Internierung aktiver Nazis und als Kriegsverbrecher verdächtiger Personen, darunter auch von Direktoren der IG Farben und anderer Konzerne, und eine erste Säuberung öffentlicher Ämter. Die Großbanken, die IG Farben und eine Reihe anderer Konzerne wurden beschlagnahmt, die Konzernleitungen jedoch angewiesen, ihre Geschäftstätigkeit fortzusetzen. Zugleich begannen die Westalliierten eine Aufklärungskampagne, um die Verbrechen des Faschismus bloßzulegen und ihr eigenes Umerziehungsprogramm und ihre Demokratievorstellungen zu popularisieren. Die Direktive JCS 1067/8 trug widersprüchlichen Charakter, denn man wollte das Problem Faschismus fast ausschließlich von oben her bewältigen. Sie untersagte nicht nur jegliche Fraternisation mit der deutschen Zivilbevölkerung, sondern sie war auch auf eine Dämpfung der Eigeninitiative deutscher Antifaschisten angelegt. Zudem sah sie fürs erste eine Drosselung des wirtschaftlichen Wiederaufbaus vor. Die Militärregierungen wurden angewiesen, keine Schritte zu unternehmen, „die a) zur wirtschaftlichen Wiederaufrichtung Deutschlands führen könnten und b) geeignet sind, die deutsche Wirtschaft zu erhalten oder zu stärken“.°! In der Praxis bewirkte die Direktive JCS 1067/8 ein unterschiedliches Vorgehen, je nach ihrer Ausdeutung durch die verantwortlichen Militärs und deren politische Berater.
Französische Soldaten schleifen eine Nazifahne, Stuttgart 1945
Gegen JCS 1067/8 richtete sich bald eine doppelte Kritik aus den eigenen Reihen. Die einen waren unzufrieden, weil ohne ein Zusammenwirken mit den deutschen Antifaschisten und ohne eine zügige Inangriffnahme des Wiederaufbaus die deutsche Bevölkerung nicht vom Einfluß des Faschismus gelöst und zu demokratischer Aktivität geführt werden konnte. Die anderen wollten sich von den Auflagen der Direktive frei machen, weil diese die Rettung des deutschen Monopolkapitals und das Abrücken von den antifaschistischen Gemeinsamkeiten der Anti-Hitler-Koalition erschwerte.
Angesichts der Wirkungen des Beispiels der sowjetischen Besatzungspolitik und gemäß alliierten Vereinbarungen gestatteten die westlichen Besatzungsbehörden ab Herbst 1945 schrittweise die legale Betätigung, politischer Parteien. Bedingung war, daß diese sich vom Nazismus abgrenzten und daß ihre Gründer als unbelastete Personen galten. Auch die westlichen Besatzungsmächte waren daran interessiert, die parteipolitische Zersplitterung der Weimarer Zeit nicht wieder aufleben zu lassen. Vor allem suchten sie eine Zerstrittenheit des bürgerlichen Parteienlagers zu vermeiden.
Großbritannien — nun von der Labour Party regiert — setzte Hoffnungen auf die Sozialdemokratie. Da sich die Spitzenfunktionen der britischen Besatzungsbehörden aber durchweg in den Händen konservativer Militärs befanden, sah die Praxis so aus, daß diese und ihre politischen Berater vor allem Kontakte zur traditionellen deutschen Staatsbürokratie und zu christlich-demokratischen Politikern knüpften.
Auch die amerikanischen Behörden, die gern kirchlichen Würdenträgern ihr Ohr liehen, stützten sich vorwiegend auf konservative Kreise, dabei zunehmend auf die Christdemokraten. Auf lokaler Ebene tolerierten beide Mächte selbst offen antidemokratische Gruppierungen. Auch Parteigründungen im Zeichen eines unverblümten Separatismus oder Autonomismus wurden regional geduldet.
Vorherrschend war bei den amerikanischen wie beiden britischen Besatzungsbehörden die Tendenz, die Bildung von Parteien jener politischen Richtungen zu gestatten, die sich in der Ostzone bereits als die hauptsächlichen abgezeichnet hatten: Sozialdemokraten, Kommunisten, Christdemokraten und Liberaldemokraten. Daß in Berlin für das künftige Parteiensystem Zeichen gesetzt waren, geht aus einer Studie des USamerikanischen Geheimdienstes hervor. Darin wurde festgestelt, daß „die Berliner Parteien quasi automatisch eine Führungsrolle übernommen“ hatten. Man habe „im allgemeinen das Vier-Parteien-Modell übernommen, das in Berlin entwickelt worden war? Insgesamt erblickten jedoch weder die amerikanischen noch die britischen, noch die französischen Besatzungsbehörden in den sich formierenden deutschen Parteien und in deren Zusammenarbeit die ausschlaggebende politische Potenz für einen deutschen Beitrag zur Bewältigung der faschistischen Vergangenheit und zur Schaffung fester Friedensgarantien.
Im Bemühen, Vorkriegspositionen des französischen Imperialismus wiederzuerlangen, versuchte die französische Regierung, wie in ihrer Deutschlandpolitik, so auch in ihrer Besatzungspraxis eine eigenständige Linie einzuschlagen. Ihr waren vor allem parteipolitische Gruppierungen willkommen, die autonomistische Ziele verfolgten oder gar für den Anschluß des Saargebietes und linksrheinischer Territorien an Frankreich plädierten. Das Bestreben, französischen Sicherheitsinteressen durch eine Dezentralisierung Deutschlands und durch Korrekturen der deutschfranzösischen Grenze zugunsten Frankreichs Rechnung zu tragen, prägte auch die französische Besatzungspolitik. Frankreich tendierte von allen Besatzungsmächten von Anfang an am stärksten zu einer separaten Behandlung seiner Besatzungszone.
Andererseits zeigte sich in der ersten Zeit, daß in den Reihen der französischen Armee, die im Kampf der Resistance neu erstanden war, bei Soldaten wie Offizieren eine kämpferische antifaschistische Gesinnung überwog, wenngleich auch der Einfluß von Überläufern des Vichyregimes zu spüren war. Die Abschirmung der französischen Zone nach außen bewirkte unter anderem auch, daß sich hier die antifaschistische und Arbeiterbewegung längere Zeit eigenständig auf dem Boden der Aktionseinheit von Kommunisten und Sozialdemokraten entwickelte.
Schleppendes Anlaufen der Produktion. Betriebsräte und Gewerkschaften
Wenn auch in den westlichen Territorien Kampfhandlungen eines solchen Ausmaßes wie in den östlichen nicht stattgefunden hatten, so lag doch auch hier die Wirtschaft weitgehend darnieder. Das Ausmaß der Zerstörungen war beträchtlich, doch wesentlich geringer, als es auf den ersten Blick schien. Die in Vorbereitung des Krieges und während der ersten Kriegsjahre erheblich aufgestockten industriellen Kapazitäten waren zum größten Teil noch vorhanden oder rasch wiederherstellbar. Arbeitskräfte standen zur Verfügung. Als Hauptproblem erwies sich, die Transport-, Energieund Rohstoffversorgung in Gang zu bringen und die Ernährung der Industriearbeiter zu sichern.
Auch in den westlichen Besatzungszonen nahmen Arbeiter, Angestellte und Ingenieure als erste und in Eigenverantwortung die Arbeit wieder auf, besonders in den Wasserwerken, in der Energiewirtschaft, im Verkehrswesen und im Kohlenbergbau. Die Initiative lag vor allem bei Kommunisten, Sozialdemokraten und parteilosen Gewerkschaftern. Sie schreckten vor Schwierigkeiten nicht zurück und vollbrachten großartige Leistungen, um die Versorgung der Bevölkerung zu sichern und den Grundstein für den wirtschaftlichen Wiederaufbau zu legen, wobei sie anfangs allerdings oftmals durch Besatzungsorgane behindert wurden.
Gemäß dem Morgenthau-Plan hatten die Westmächte zunächst vorgesehen, die Kohlenbergwerke an der Ruhr unter Wasser zu setzen. Doch im Frühjahr 1945 waren sie bereits entschlossen, die Bergwerke möglichst rasch auf Höchstproduktion zu bringen und auch andere Produktionszweige unter vorrangiger Berücksichtigung der Bedürfnisse der Besatzungstruppen anzukurbeln. Dazu übernahmen die Besatzungsorgane das Bewirtschaftungssystem der früheren Reichsbehörden. Sie stützten sich auf die Industrieund Handelskammern und andere Unternehmerorganisationen. Aktivitäten von Betriebsräten und Gewerkschaftsausschüssen waren hingegen nicht gefragt.
Das hatte sich schon in Aachen, der ersten besetzten deutschen Stadt, gezeigt. Die hier bereits im Oktober 1944 gegründete Gewerkschaft wurde erst im März 1945 von der amerikanischen Militärregierung offiziell genehmigt. In ihr hatten sich Vertreter verschiedener politischer und weltanschaulicher Richtungen zusammengefunden. Sie erhoben nicht allein soziale Forderungen, sondern beschlossen, dem „preußischen Militarismus und Faschismus“ den Kampf anzusagen sowie bei „der Entfernung der Nazis aus Wirtschaft und Verwaltung“ mitzuhelfen, und verlangten die „Vertretung der Gewerkschaft in allen Zweigen des öffentlichen Lebens“.
Ebenfalls noch vor Kriegsende hatte sich in Gelsenkirchen-Buer ein gewerkschaftliches Zentrum und im ganzen Ruhrgebiet eine starke Betriebsrätebewegung herausgebildet. In dieser Bewegung erwarben sich dank ihrer Energie und Zielstrebigkeit Kommunisten hohes Vertrauen.
Hinter den deutlich klassenkämpferische Züge tragenden Aktivitäten, die sich in vielen Zentren der Arbeiterbewegung zeigten, blieb die von Köln ausgehende, unter dem Einfluß Hans Böcklers stehende Gewerkschaftsinitiative zurück. Doch auch hier war die Notwendigkeit der Einheitsgewerkschaft unumstritten. Böckler, der frühere Bezirksleiter des Deutschen Metallarbeiterverbandes für Rheinland und Westfalen, spielte anfangs sogar mit dem Gedanken einer Zwangsmitgliedschaft. Die klare politische Ausrichtung auf eine entscheidende Rolle der Gewerkschaften im antifaschistisch-demokratischen Erneuerungsprozeß fehlte hingegen. Das von Böckler entworfene Fünfpunkteprogramm, das von der britischen Besatzungsmacht am 2. August 1945 genehmigt wurde, forderte die „von Staat und Behörden, von Unternehmern und politischen Parteien völlig unabhängige Einheitsgewerkschaft der Arbeiter, Angestellten und Beamten“, die Regelung der „Lohn-, Arbeitsund Dienstverhältnisse ihrer Mitglieder“, „eine angemessene Vertretung der Gewerkschaft in allen amtlichen und halbamtlichen Körperschaften, die sich mit sozialen und wirtschaftlichen Fragen beschäftigen“, das Einstehen für den demokratischen Staat und die Völkerverständigung.°‘ Im ganzen nahm sich diese Programmatik im Vergleich zu anderen, prononciert antifaschistisch-demokratisch ausgerichteten und die umfassende Mitbestimmung der Werktätigen in der Wirtschaft betonenden Konzeptionen für den gewerkschaftlichen Neubeginn bescheidener aus.
Dennoch bremste die britische Besatzungsmacht selbst diesen Ansatz zum Aufbau einer zentralisierten Gewerkschaftsorganisation. Sie schrieb eine langsame, zunächst auf die lokale Ebene begrenzte Gewerkschaftsentwicklung vor. Mit dieser Verzögerungsstrategie, wie sie auch von Amerikanern und Franzosen praktiziert wurde, griffen die Besatzungsmächte zugunsten der Reorganisation alter Bürokratien und der Restauration der gegebenen Wirtschaftsstrukturen in die aufbrechenden neuen Auseinandersetzungen zwischen Kapital und Arbeit ein. Innerhalb der Gewerkschaftsbewegung bevorteilte dieses Vorgehen, das mit dem Protegieren alter Führungskader des ADGB und mit Repressionen gegen klassenkämpferische Kräfte verbunden war, die reformistischen Gewerkschaftsfunktionäre. Sie konnten ihren anfangs geringen Einfluß merklich ausbauen. Dabei waren sie in ihren Methoden mitunter wenig wählerisch. In Hamburg machten sie zum Beispiel mit den Besatzungsorganen gemeinsames Spiel, um die politisch profilierte, die Einheit der Arbeiterbwegung betonende Sozialistische Freie Gewerkschaft aufzulösen.
Trotz aller Behinderungen war auch für die Westzonen das im wesentlichen einheitliche Vorgehen von Betriebsräten und örtlichen Gewerkschaftsorganisationen, waren Wille und Bereitschaft der Belegschaften, die Lähmung des wirtschaftlichen Lebens zu überwinden, charakteristisch. Von den organisiert handelnden Arbeitern ging Druck aus, die Produktion auf Bedürfnisse der werktätigen Bevölkerung umzustellen, die Arbeitsaufnahme der Betriebe zu forcieren und Arbeitsplätze zu sichern. Wiederholt tauchten Forderungen nach Übernahme der Großindustrie und der für die Gesamtheit entscheidenden Unternehmen durch die öffentliche Hand auf.
Diesem Drängen aus den Reihen der Werktätigen versuchten die Konzernherren mit Unterstützung der Besatzungsmächte zu begegnen. Sie waren, einem schon in den letzten Monaten der faschistischen Herrschaft entworfenen Konzept folgend, bemüht, Arbeiter, Angestellte und Ingenieure weiter zu beschäftigen. Arbeitslosigkeit sollte vermieden werden, damit sich die Werktätigen von nach der Niederlage des Faschismus erwarteten revolutionären Aktionen fernhielten. Eine Reihe kleinere und mittlere Unternehmer waren ebenfalls bestrebt, ihre Betriebe möglichst ohne längere Unterbrechung fortzuführen. So trug auch das Kapital dazu bei, die Arbeitslosigkeit in Grenzen zu halten. Dadurch entstanden zugleich Betätigungsfelder für Betriebsräte und Gewerkschaftsorganisationen.
Dennoch verlief das Ingangsetzen der Produktion zunächst recht schleppend. Im Frühherbst 1945 machte die Industrieproduktion in der amerikanischen Besatzungszone ca. 10 Prozent und in der britischen Besatzungszone ca. 15 Prozent des Standes von 1936 aus. Schwerpunkte bildeten die Energiewirtschaft, der Bergbau und die Holzindustrie. Mit den ersten Schritten zur Normalisierung der Industrie gingen die Wiederherstellung der Postund Fernmeldeverbindungen und das Beheben von Schäden im Verkehrswesen einher. Die kapitalistischen Großbanken führten in den westlichen Besatzungszonen ihre Geschäfte nahezu ungehindert fort.
Auftragsverwaltungen und „politische Quarantäne“. Das Rheinstaatprojekt
Auch die Westmächte gingen davon aus, daß ihre Besatzungsbehörden sich eines deutschen Verwaltungsapparates bedienen mußten. Im Unterschied zum Vorgehen der Sowjetunion waren sie bestrebt, einen solchen nicht auf der Grundlage eines antifaschistisch-demokratischen Parteienund Organisationslebens, sondern zunächst als eine „unpolitische“ Auftragsverwaltung der Besatzungsmacht zu errichten. Sie erklärten, es erfordere Zeit, bis Bedingungen für eine organisierte demokratische Betätigung der Deutschen geschaffen seien, und verhängten zunächst eine sogenannte politische Quarantäne. Nachdem Amerikaner und Briten die bereits entstandenen antifaschistischen Ausschüsse zu Dutzenden verboten hatten, berichteten ihre Informationsbehörden über eine angebliche politische Interesselosigkeit der deutschen Bevölkerung. Kommunisten und andere Linke, die als erste politisch aktiv wurden, sollten auf diese Weise behindert und den bürgerlichen Politikern sowie auch antikommunistisch eingestellten Sozialdemokraten eine Atempause zur Sammlung und Gruppierung ihrer Kräfte verschafft werden. Inzwischen wurden mit Hilfe einer fest an die Besatzungsorgane gebundenen deutschen Administration die Weichen für den politischen Neubeginn nach den Vorstellungen der Westmächte gestellt.
Hauptanliegen war, eine deutsche Verwaltung zu installieren bzw. zu restaurieren, auf die man sich bei der Durchsetzung der Besatzungsdirektiven stützen konnte. Nach ihrem Einmarsch setzten die Westalliierten deutsche Bürgermeister, Landräte und schließlich auch Provinzialbzw. Landesverwaltungen ein. Vielfach fanden sie noch aus der Nazizeit herrührende Verwaltungsabparate vor, die sie weiterarbeiten ließen. Nur an die Spitze wurden in der Regel politisch unbelastete Personen gestellt, zumeist Parlamentarier, Regierungsbeamte, Kommunalpolitiker und Verwaltungsfachleute der Weimarer Republik, vorwiegend aus Kreisen der nichtfaschistischen bürgerlichen Parteien. Vor allem die Oberbürgermeister größerer Städte, die nur den Besatzungsbehörden verantwortlich waren, gelangten in der Anfangsphase zu starkem Einfluß.
Die Militärregierungen setzten faschistische Gesetze außer Kraft, unterließen jedoch Eingriffe, die den Charakter des Justizapparates nachhaltig geändert hätten. Bald ergingen Weisungen, den Verwaltungsapparat von ehemaligen Mitgliedern der NSDAP zu säubern, von denen aber in der Praxis viele Abstriche gemacht wurden.
Die von den Besatzungsbehörden in den Ländern und Provinzen sowie den beiden Freien und Hansestädten eingesetzten ersten Regierungschefs besaßen eine Stellung, in der sie sich jeder Kontrolle und Rechenschaftspflicht gegenüber deutschen Organisationen und Gremien entziehen konnten. Die frühen Regierungen, die mehr als Beratungsorgane des Regierungschefs fungierten, setzten sich in der Regel aus christlich-demokratischen, liberal-demokratischen, sozialdemokratischen und kommunistischen Politikern zusammen. Doch wurde den Kommunisten meist nur ein Regierungsamt zugestanden.
Im Oktober 1945 errichtete die US-Militärregierung für ihre Zone den Länderrat des amerikanischen Besatzungsgebietes. Ihm gehörten die Ministerpräsidenten von Bayern, der beiden im September bzw. Oktober 1945 neugebildeten Länder Württemberg-Baden und Groß-Hessen sowie der Senatspräsident von Bremen an. In diesem Gremium wurden nach den Auflagen der Militärregierung wichtige administrative und wirtschaftliche Maßnahmen koordiniert, wodurch sich die Vorrangstellung der Staatsbürokratie gegenüber den politischen Parteien und demokratischen Organisationen zusätzlich erhöhte. Beim Länderrat wurde ein Generalsekretariat geschaffen, das den Kontakt zur amerikanischen Militärregierung unterhielt und die laufenden Geschäfte erledigte.
In der britischen Zone vollzog sich die Schaffung zentraler Institutionen mehrschichtig und stufenweise. Ab Oktober 1945 wurden auf Zonenebene Zentralämter ins Leben gerufen, die nach Fachbereichen organisiert waren und zunehmend exekutive Befugnisse erhielten. Als Parallele zum Länderrat der amerikanischen Zone fungierte hier die Konferenz der Regierungschefs der Länder und Provinzen sowie Hamburgs. Später, im März 1946, wurde als beratende Körperschaft für die Militärregierung der Zonenbeirat konstituiert, dem die Regierungschefs, die Vertreter der Zentralämter und auch Repräsentanten politischer Parteien, der Gewerkschaften und anderer Organisationen angehörten. Seine Entscheidungen hatten für die Militärregierung nur empfehlenden Charakter. Er besaß eine Kanzlei, später ein Sekretariat.
Die französische Militärregierung errichtete in ihrer Besatzungszone zunächst fünf selbständige Gouvernements — Südwürttemberg-Hohenzollern (mit Lindau), Baden, Hessen-Pfalz, Rheinland-Hessen-Nassau und Saargebiet — mit deutschen Auftragsverwaltungen. Zentrale Koordinierungsorgane wurden von ihr auch nach der Herausbildung von Ländern im Laufe des Jahres 1946 nicht errichtet. Nur gelegentlich und zu bestimmten Themen berief die Militärregierung die Ministerpräsidenten bzw. Fachminister zu Konferenzen.
So traten zur territorialen Aufgliederung in Zonen und zu deren Abgeschlossenheit auch die Unterschiede im Aufbau der Verwaltungen und in deren Kompetenzen hinzu. Dies war um so schwerwiegender, als deutsche Zentralverwaltungen nicht zustande kamen und in den Westzonen nur in beschränktem Maße eine wirkliche politische Säuberung der staatlichen Organe von faschistischen und anderen reaktionären Beamten erfolgte. Die antifaschistische Linke als Gestalter einer neuen, demokratischen Staatsorganisation kam hier nicht eigentlich zum Zuge. Ein in Bayern unter konservativen Politikern kursierendes Rundschreiben vom 25. Juli 1945 führte hierfür folgende Begründung an: „Die formalistische Handhabung der Entlassung würde zu einem völligen Zusammenbruch der Staatsverwaltung und damit zwangsläufig zu politischem Radikalismus, dem Kommunismus und Bolschewismus, führen.
Die Mitglieder des Länderrates der amerikanischen Besatzungszone Karl Geiler, Ministerpräsident von Groß-Hessen, Reinhold Maier, Ministerpräsident von Württemberg-Baden, und Wilhelm Hoegner, Ministerpräsident von Bayern (v. r. n. I.) im Gespräch mit James Pollock, Berater des stellvertretenden US-Militärgouverneurs, Herbst 1945
Vor allem in den unmittelbar von den Militärregierungen gelenkten zentralen Ämtern setzte die alte Staatsbürokratie häufig ihre Tätigkeit nahezu ungebrochen fort, so daß selbst der Generalsekretär des Länderrates der amerikanischen Zone, Erich Roßmann, diese Instanzen als „Naturschutzpark der Zentralbehörden des Hitlerreiches“°° charakterisierte. Die für eine gründliche Abrechnung mit Faschismus und Militarismus notwendige Zerschlagung der alten Staatsmaschinerie fand in den Westzonen nicht statt.
Indes ging der Widerstand gegen die Errichtung einer einheitlichen, antifaschistisch-demokratischen deutschen Republik nicht in erster Linie von diesen Relikten der faschistischen Staatsmaschinerie aus. In den Vordergrund traten Politiker, die —ohne mit einer faschistischen Vergangenheit belastet zu sein — die Interessen des Großkapitals auf neuen Wegen und mit neuen Methoden zu vertreten vermochten. Symptomatisch hierfür war der Aufstieg des damals bereits neunundsechzigjährigen Konrad Adenauer, den die Amerikaner zunächst wieder als Oberbürgermeister von Köln einsetzten.
Der überaus erfahrene bürgerlich-konservative Politiker genoß das Vertrauen des rheinisch-westfälischen Großkapitals und des katholischen Klerus. In der Weimarer Republik Präsident des Preußischen Staatsrates und Oberbürgermeister der Stadt Köln, war er von den Nazis seiner Ämter enthoben worden. Obwohl er jeden Kontakt zum aktiven antifaschistischen Widerstand gemieden hatte, stand er auf der amerikanischen „weißen Liste“ für Deutschland obenan.
Bereits im Sommer 1945, bevor man sich überhaupt ein reales Bild von der Praxis sowjetischer Deutschlandund Besatzungspolitik zu machen vermochte, galt für Adenauer der von der UdSSR besetzte Teil Deutschlands als abgeschriebener Landstrich jenseits eines „Eisernen Vorhanges“. In einem von ihm nach Paris lancierten Memorandum’ hieß es: „Das von Rußland besetzte Gebiet scheint für eine nicht zu schätzende Zeit aus den Betrachtungen ausscheiden zu müssen.“ Um das rheinisch-westfälische Großkapital zu retten und die Auswirkungen der Kriegsniederlage des deutschen Imperialismus zu mildern, empfahl Adenauer — separatistische Vorstöße der Zeit nach dem ersten Weltkrieg aktualisierend — die Bildung eines Rheinstaates. „Stärkung der wirtschaftlichen Kraft Frankreichs durch Verflechtung mit einer leistungsfähigen rheinischen Industrie“ — mit dieser Offerte sollte Paris für derartige Pläne gewonnen werden. „Aus den Teilen, die bei Schaffung eines Rheinstaates übrigbleiben, dürften wohl zwei Staaten zu bilden sein. Diese dann bestehenden drei Staaten könnten dann ein loses, dem Commonwealth entsprechendes völkerrechtliches Gebilde werden. Alle drei Staaten müßten eine voneinander unabhängige Außenpolitik treiben dürfen, insbesondere eigene — jeder für sich — Auslandsvertretungen haben.“
Konrad Adenauer suchte also den Interessenausgleich zwischen den herrschenden Klassen des westlichen Europas und des westlichen Deutschlands. Ein solcher Kurs, der damals nicht öffentlich propagiert wurde, richtete sich sowohl gegen eine konsequente antifaschistisch-demokratische Erneuerung und die Schaffung einer friedliebenden, einheitlichen deutschen Republik als auch gegen den deutschlandpolitischen Konsens der Anti-Hitler-Koalition.
Die Arbeiterparteien unter den Bedingungen der Halblegalität und nach ihrer Zulassung
Bemühungen, auch in den Westzonen frühzeitig das legale Auftreten politischer Parteien zu erreichen, gingen vor allem von den Organisationen der KPD aus. Unter Bedingungen, die sich als Halblegalität charakterisieren lassen, hatten die Kommunisten in der amerikanischen, der britischen und der französischen Besatzungszone mit dem Aufbau ihrer Parteiorganisationen begonnen. Im Sommer 1945 war die Mehrzahl der Bezirksleitungen bereits konstituiert. Dies geschah im Rahmen der traditionellen Strukturen der KPD, auch dort, wo sich die so reorganisierten Bezirksparteiorganisationen über Territorien verschiedener Besatzungszonen erstreckten. Dies kam der Sammlung der Kader entgegen und unterstrich, daß die KPD sich als eine nach Bezirken aufgebaute, über Zonengrenzen hinweg vom Zentralkomitee geleitete, einheitlich handelnde Partei verstand.
So war es für die deutschen Kommunisten in den westlichen Besatzungszonen auch selbstverständlich, daß sie ihre Reihen auf dem Boden der mit dem Aufruf des Zentralkomitees vom 11.Juni 1945 entwickelten Politik formierten, was klärende Diskussionen und die Auseinandersetzung mit überholten Standpunkten einschloß. Die lokalen und regionalen Parteiorganisationen in den Westzonen suchten Kontakt zur Parteiführung in Berlin und handelten nach den für alle Parteibezirke verbindlichen Orientierungen des Zentralkomitees. Als schließlich nach der Potsdamer Konferenz die Militärregierungen für die westlichen Besatzungszonen die Zulassung politischer Parteien ankündigten, war der Klärungsprozeß innerhalb der kommunistischen Parteiorganisationen im wesentlichen abgeschlossen, waren Vorkehrungen für deren legales Auftreten getroffen. Vor allem in den Parteibezirken Wasserkante, Weser-Ems, Ruhrgebiet, Niederrhein, Mittelrhein, Hessen, Nordwürttemberg-Baden, Südbayern und Saargebiet hatten sich die Kommunisten unter Leitung solcher erfahrener Funktionäre wie Albert Buchmann, Walter Fisch, Max Reimann und anderer gut auf den neuen Abschnitt ihres Kampfes eingestellt.
So trug das organisierte Handeln der KPD und anderer Antifaschisten dazu bei, daß sich bei Besatzungsorganen der Westzonen die Einsicht durchsetzte, die „politische Quarantäne“ werde ihren Zweck nicht länger erfüllen. Es ergingen Anordnungen — am 27. August für die amerikanische, am 14. September für die britische und am 13. Dezember 1945 für die französische Zone -, politische Parteien zu lizenzieren. Dies hieß jedoch zunächst nur, daß die Besatzungsbehörden bereit waren, Anträge auf Zulassung von Parteiorganisationen in der Regel allerdings zunächst nur bis zur Kreisebene — entgegenzunehmen. Zur tatsächlichen Lizenzierung bedurfte es eines bürokratischen Prüfungsprozesses, der im Falle der KPD mitunter viele Monate dauerte. Deshalb konnte die KPD zwar Ende September/Anfang Oktober ihre ersten Öffentlichen Versammlungen abhalten, doch die Mehrzahl ihrer Organisationen arbeitete bis in das Jahr 1946 hinein noch halblegal. Wiederholt versuchten die Besatzungsorgane, die Genehmigung der KPD mit Auflagen zu verbinden. So wollten sie ihr nicht gestatten, den Namen Kommunistische Partei Deutschlands zu führen, untersagten die Bildung von Parteienblocks und nahmen Anstoß an Forderungen, die dem Aufruf des Zentralkomitees vom 11. Juni 1945 entnommen waren.
Dennoch machte die KPD nun auch in den Westzonen raschere Fortschritte. In zahlreichen lokalen Aufrufen spiegelte sich das Bestreben der Partei, die Bewältigung der Nachkriegsnöte der Werktätigen mit antifaschistisch-demokratischen Umgestaltungen zu verbinden. Viele Kommunisten leisteten in Verwaltungen und Ausschüssen konstruktive Aufbauarbeit und suchten die Verbindung zu Sozialdemokraten und anderen Antifaschisten. Die systematische Schulung der Parteimitglieder setzte ein, und in einer Vielzahl von Versammlungen erläuterten Kommunisten die Ziele ihrer Politik vor der Bevölkerung.
Ab September 1945 fanden die ersten Treffen führender Funktionäre im Rahmen der einzelnen B£&satzungszonen statt. Die KPD begann, ihre territoriale Struktur mit den Gegebenheiten der Zonen bzw. deren verwaltungsmäßiger Gliederung in Einklang zu bringen. Von der Aktivität der KPD beeindruckt, schätzte der Verfasser einer vertraulichen Studie für die amerikanischen Besatzungsbehörden ein: „Die Kommunistische Partei in Nordwürttemberg-Baden hat im Verhältnis zu ihren Konkurrentinnen die meisten beitragzahlenden Mitglieder in den Städten und zieht auf ihren Versammlungen die größten Menschenmassen an. Darüber hinaus wird allgemein anerkannt, daß sie hervorstechende organisatorische Talente und die jüngste und energischste Führungsgruppe von allen Parteien besitzt.“ Der Verfasser dieser Studie rechnete allerdings damit, daß „das Übergewicht einer konservativen und stark katholischen Bauernschaft“ und die „offensichtliche Bereitschaft der anderen Parteien, einschließlich der Sozialisten, sich unter der Losung ‚Stoppt den Kommunismus‘ zu einem Block zu vereinigen“, das Vordringen der KPD stoppen werden.’® Das waren Fingerzeige, auf welche Weise der Hinwendung vieler Werktätiger zu den Kommunisten begegnet werden sollte.
Auch die Sozialdemokraten der Westzonen hatten, noch bevor die Besatzungsmächte eine politische Betätigung erlaubten, mit dem Sammeln von Kadern und der Vorbereitung des organisatorischen Wiederaufbaus der Partei begonnen. Nicht selten lag die Initiative zur Wiedergründung sozialdemokratischer Parteiorganisationen in den Händen älterer Funktionäre, von denen viele zwar den Kapitulationskurs in der Endphase der Weimarer Republik nicht mitgetragen hatten, jedoch auch wenig Neigung zu einem durchgreifenden Neuanfang verspürten. Demgegenüber wurden aber auch manche Funktionäre, die der SPD in jener Phase den Rücken gekehrt und sich in der Sozialistischen Arbeiterpartei Deutschlands (SAP) oder im Internationalen Sozialistischen Kampfbund (ISK) organisiert hatten, nun auf dem organisatorischen Boden der SPD aktiv. Dies geschah meist in der Hoffnung, die SPD im Sinne einer linken Politik und der Aktionseinheit mit der KPD beeinflussen zu können. Ein beträchtlicher Teil von Sozialdemokraten betätigte sich in antifaschistischen Ausschüssen, in denen die Zusammenarbeit mit den Kommunisten meist gut funktionierte.
Aktionsprogramm von Kommunisten und Sozialdemokraten in Hamburg, Juli 1945
Im Grunde waren für die Sozialdemokraten in den Westzonen die gleichen Haltungen, Bestrebungen und Differenzierungen typisch, wie sie sich in der sowjetischen Besatzungszone beobachten ließen. Auch hier gab es große Bereitschaft, gemeinsam mit den Kommunisten und anderen Antifaschisten den Weg einer konsequenten demokratischen Erneuerung zu beschreiten. Auch hier wirkte zugleich das Erbe des Opportunismus. Was die Situation indes unterschied, das waren Einflußnahmen der Besatzungsmächte zugunsten des antikommunistisch eingestellten Flügels der SPD. Das bewußte Verzögern einer politischen Neubelebung bremste die Aktionsgemeinschaft der Arbeiterklasse und die Arbeiterbewegung insgesamt.
Dennoch war auch in den Westzonen die Aktionseinheit von Kommunisten und Sozialdemokraten zunächst auf dem Vormarsch. Das schon in den antifaschistischen Ausschüssen und Betriebsräten. bewährte Miteinander übertrug sich auch auf die Zusammenarbeit beider Arbeiterparteien. Davon zeugten Aktionsabkommen in Bremen, Braunschweig, Dortmund, Frankfurt am Main, Hamburg, Karlsruhe, Mannheim, München, Nürnberg, Stuttgart und zahlreichen anderen Städten, von denen nicht wenige an der Vereinbarung zwischen dem Zentralkomitee der KPD und dem Zentralausschuß der SPD vom 19. Juni 1945 orientiert waren.
„Es gilt aus der Vergangenheit zu lernen, um diesen neuen Weg gehen zu können“, hieß es im Aufruf der am 8. August 1945 in München vereinbarten Aktionsgemeinschaft SPD-KPD, „den Weg der radikalen demokratischen Erneuerung Deutschlands … Die Arbeiterparteien sind sich … einig in dem Willen, die gegenwärtig notwendigen Schritte gemeinsam zu gehen, die die große Aufgabe von heute umfassen: die Demokratisierung des politischen, sozialen und kulturellen Lebens der Nation!“59
Ausrottung aller Überreste des Faschismus, Kampf gegen Hunger, Not und Arbeitslosigkeit, gemeinsame Verantwortung für den demokratischen Neuaufbau, Mitbestimmung der Werktätigen in den Betrieben, Demokratisierung der Schule, der Justiz, des kulturellen Lebens waren wiederkehrende Forderungen, auf die sich Kommunisten und Sozialdemokraten geeinigt hatten.
Hingegen geriet der Aufbau zonaler Parteiorganisationen der SPD vor allem in der wegen ihrer industriellen Zentren für die Arbeiterbewegung so gewichtigen britischen Zone in die Hände von Gegnern der Aktionseinheit. Sie scharten sich um den ehemaligen Reichstagsabgeordneten Kurt Schumacher, der sich — aus dem KZ Dachau befreit — sofort dem Wiederaufbau der SPD widmete und deren antikommunistische Ausrichtung betrieb. Schumacher hatte im Juli 1945 unter dem Titel „Konsequenzen deutscher Politik“ Vorstellungen über den Standort der deutschen Sozialdemokratie veröffentlicht. Mit einigen Vertrauten bildete er in Hannover das sogenannte Büro Schumacher. Von hier aus begann er zunächst in der britischen, bald jedoch auch in den anderen Zonen Verbindungen zu Gesinnungsgenossen zu knüpfen. Gestützt auf sein Ansehen als ehemaliger Reichstagsabgeordneter und Verfolgter des Naziregimes, ausgestattet mit großer — seinem starken Selbst-, ja Sendungsbewußtsein entspringenden — Suggestivkraft, gewann Schumacher rasch an Einfluß, wobei ihm enge Beziehungen zur britischen Besatzungsmacht behilflich waren.
Als im Herbst 1945 auch in den Westzonen politische Parteien erlaubt wurden, war Schumacher eifrig bemüht, die sich neubildenden Vorstände der sozialdemokratischen Organisationen seiner nun schon festgeformten politischen Linie zu verpflichten. Im Ergebnis dieser Aktivitäten wurde die programmatische Ausrichtung der SPD in den Westzonen wenn auch nicht unumstritten, so doch maßgeblich von seinem Konzept beherrscht.
In Schumachers programmatischen Äußerungen verband sich die Überwindung der Überreste des Faschismus mit traditionellen Zielen der reformistischen Arbeiterbewegung. So wollte er eine Arbeiter, Angestellte und Vertreter der Mittelschichten umfassende Mehrheit für die SPD gewinnen. Auf diese gestützt, sollten Forderungen wie die nach Vergesellschaftung der Großindustrie, nach Planwirtschaft, nach Mitbestimmung oder nach Bildungsreform auf parlamentarischem Wege durchgesetzt werden.
Obwohl Schumacher in seinen Reden und Erklärungen Ziele benannte, wie sie ähnlich auch der Berliner Zentralausschuß der SPD verkündet hatte, verfolgte er doch eine wesentlich andere Politik, ging er von anderen theoretischen Erwägungen aus. Schumacher sah im Staat eine über den Klassen stehende Institution und wollte nicht wahrhaben, daß auch die Demokratie klassengebunden ist. Nach seinen Vorstellungen hatte sich die SPD zu Zeiten der Weimarer Republik unnötigerweise aus dem bürgerlichen Staat hinausdrängen lassen. Deshalb plädierte er für ihre politische und weltanschauliche Offenheit. Der Marxismus sollte nur eine geistige Grundlage der Partei neben anderen sein. Seine Bejahung bürgerlich-parlamentarischer Verhältnisse in der Gesellschaft und weltanschaulicher Pluralität innerhalb der Partei verband Schumacher mit einer radikal klingenden Kritik am Kapitalismus. Er behauptete, der Kapitalismus sei in Deutschland bereits zusammengebrochen, die kapitalistischen Mächte und reaktionären Kräfte lägen am Boden, und gab, ausgehend von dieser falschen Voraussetzung, die Losung vom „Sozialismus als Tagesaufgabe“ aus. Damit gewann er viele Sozialdemokraten für sich, die der in sozialistischen Kreisen besonders unter dem Eindruck des Wahlsieges der Labour Party vom Juli 1945 — verbreiteten Illusion anhingen, Westeuropa sei auf dem Wege, mittels eines „demokratischen Sozialismus“ zu einer „dritten Kraft“ zu werden.
Kernpunkt von Schumachers Konzept war sein Antikommunismus. In seinem antisowjetischen Eifer ging er von Anfang an auch auf kritische Distanz gegenüber gemeinsamen Grundsätzen und Zielen der Alliierten und einer Viermächteregelung der deutschen Frage. Aus seiner einseitigen Orientierung auf die Westmächte ergab sich eine ebenso einseitige Ausrichtung der von ihm beeinflußten sozialdemokratischen Politik auf die Westzonen Deutschlands. Zwischen den von Schumacher proklamierten antifaschistisch-demokratisch, antikapitalistisch akzentuierten Zielen und den Bedingungen, unter denen er sie erreichen wollte, tat sich eine unüberbrückbare Kluft auf. Das Scheitern seines Konzepts war vorprogrammiert. Ob gewollt oder nicht, Schumacher mußte nach der Logik seiner Politik in nahezu allen praktisch zur Entscheidung stehenden Fragen auf die Seite derer geraten, die das bürgerlich-kapitalistische System retten und neuordnen wollten. Nicht für jeden war durchschaubar, daß es sich bei dem von Schumacher propagierten „Sozialismus“ im Grunde nur um das erneut aufgegriffene opportunistische Konzept der „Wirtschaftsdemokratie“ bzw. des „demokratischen Sozialismus“ handelte, das bereits nach dem ersten Weltkrieg fehlgeschlagen war.
Mit verbalem Radikalismus machte sich Schumacher auch zum Verfechter nationalistischer Stimmungen, indem er sich als Kritiker der Besatzungspolitik im allgemeinen und der der Sowjetunion im besonderen zu profilieren suchte. Um nicht Rechtskräften das Feld zu überlassen, sollte die SPD zu einem Auffangbecken selbst für offene Gegner einer aufrichtigen Politik der Wiedergutmachung und der Aussöhnung des deutschen Volkes mit dem Sowjetvolk werden. Antisowjetismus wurde damals öffentlich von niemandem so militant vorgetragen wie von Schumacher.
Bei einem derartigen Kurs mußte für Kurt Schumacher die KPD mit Zwangsläufigkeit zum politischen Hauptgegner werden. Als einzig „mögliche Form sozialdemokratisch-kommunistischer Annäherung“ bezeichnete er „die völlige Sozialdemokratisierung der kommunistischen Anhänger“. Für eine echte Aktionseinheit von KPD und SPD bot seine Politik demzufolge keinen Raum, wenngleich er in seinen ersten Äußerungen dem starken Drang nach gemeinsamem Handeln von Sozialdemokraten und Kommunisten gewisse Zugeständnisse machen mußte.
Gründerkreise bürgerlicher Parteien auf der Suche nach politischem Profil
In den Ländern der amerikanischen, der britischen und der französischen Zone nahm die Gründung bürgerlicher Parteien längere Zeit in Anspruch und erfolgte in größerer Vielfalt als in der sowjetischen Zone. Die Mehrzahl der Gründungsaufrufe wurden im September und Oktober 1945, zum Teil aber erst Anfang 1946 oder noch später veröffentlicht. Doch waren Mitte 1945 in verschiedenen Territorien die Organisierung künftiger bürgerlicher Parteien und das Nachdenken über deren Ziele in Gang gekommen, auf das kleinbürgerlich-antimonopolistische Stimmungen zunächst in starkem Maße einwirkten. Im allgemeinen waren die Parteigründer auf der Suche nach einer bürgerlichen Politik, die den Faschismus verurteilte, mit preußisch-militaristischen Traditionen brach und den Rückgriff auf die Weimarer Verfassung mit Anleihen an das amerikanische bzw. britische Demokratieverständnis verband.
In den west- und südwestdeutschen Kernlanden des politischen und sozialen Katholizismus bildeten sich interkonfessionelle christlich-demokratische Parteien heraus, die auf breite Schichten Einfluß gewinnen sollten. Die Initiatoren, die den ersten lokalen Parteibildungen unterschiedliche Namen gaben, kamen vor allem aus der früheren katholischen Anhängerschaft des Zentrums und der christlichen Gewerkschaften. Hinzu gesellten sich Vertreter des protestantischen Konservatismus und in geringem Maße Kräfte des liberalen bzw. demokratischen Bürgertums.
Der stärkste Einfluß ging von dem Gründerkreis in Köln aus. Hier einigten sich am 17. Juni 1945 einige ehemalige Zentrumsfunktionäre, keine Wiederoder Neugründung der Zentrumspartei vorzunehmen, sondern eine von den Arbeiterparteien abgegrenzte, regierungsfähige bürgerliche Partei auf dem Boden der christlichen Soziallehre ins Leben zu rufen. An den folgenden, im Dominikanerkloster Walberberg bei Köln stattfindenden Beratungen nahmen bereits auch Politiker aus protestantischen und liberalen Kreisen teil. Repräsentativ für die Kölner Gründung wurden Politiker wie die Katholiken Leo Schwering und Karl Arnold oder von protestantischer Seite Otto Schmidt. Die im Juni von dieser Richtung veröffentlichten „Kölner Leitsätze“ enthielten bemerkenswerte Einsichten in den Zusammenhang des Nationalsozialismus mit der „Herrschsucht des Militarismus und der großkapitalistischen Rüstungsmagnaten“. Sie sprachen sich für einen „christlichen Sozialismus“ und die Schaffung eines friedlichen und sozial gerechten Deutschlands aus, in dem auf parlamentarischem Wege die „Vorherrschaft des Großkapitals, der privaten Monopole und Konzerne“ gebrochen wird und das auf Fundamenten des Christentums und der „abendländischen Kultur“ basiert.‘
Die „Kölner Leitsätze“, die bald schon abgeschwächt wurden, brachten in sich widersprüchliche, kleinbürgerlich-antimonopolistische Vorstellungen zum Ausdruck. Wenn auch der „christliche Sozialismus“ letztlich nur auf Beseitigung von Gebrechen des Kapitalismus abzielte, so hätten die „Kölner Leitsätze“ durchaus zur programmatischen Plattform für eine Politik antifaschistisch-demokratischer Erneuerung werden können.
Noch weiter gehend war das bei den Leitsätzen der Frankfurter Christdemokraten vom September 1945 der Fall, die unter dem theoretischen Einfluß linksorientierter antifaschistischer Intellektueller wie Walter Dirks und Eugen Kogon standen. Sie akzentuierten eindeutig die Notwendigkeit der konsequenten Überwindung des Faschismus und forderten die Überführung der Urproduktion, der Großindustrie und der Großbanken in Gemeineigentum sowie eine geplante Lenkung der Wirtschaft.
Es war ein Symptom der Schwäche und der politisch-moralischen Defensive, in der sich die deutsche Großbourgeoisie und deren politische Interessenvertreter auch in den Westzonen Deutschlands befanden, wenn sie darauf aus waren, die mit solchen antimonopolistischen Forderungen ins Leben tretende christlich-demokratische Sammlungsbewegung zu ihrem parteipolitischen Hauptinstrument zu machen. Bei der nordrheinischen CDU waren es Konrad Adenauer, der Bankier Robert Pferdmenges und andere, die der christlich-demokratischen Partei beitraten und an deren Spitze drängten, um die weitere Profilierung, vor allem aber die praktische Politik dieser Partei zu lenken. Taktierend, doch beharrlich wandte sich Adenauer gegen jene CDU-Politiker, die einen „christlichen Sozialismus“ und einen „Brückenschlag zwischen Ost und West“ propagierten.
Vom 14. bis 15. Dezember 1945 fanden sich in Bad Godesberg Abgesandte verschiedener christlich-demokratischer Gründerkreise — darunter auch Vertreter der Berliner Führung der CDU zu einem sogenannten Reichstreffen zusammen. Sie einigten sich auf den Namen „Christlich-Demokratische Union“, was allerdings nicht die Zustimmung aller christlich-demokratisch orientierten Organisationen fand. In ihrer Mehrheit befürworteten die Teilnehmer des Bad-Godesberger Treffens einen „Sozialismus aus christlicher Verantwortung“, doch blieben sie schon zu diesem Zeitpunkt hinter der sozialen Programmatik der ersten Wegbereiter der CDU zurück. Ihre vagen Sozialisierungsforderungen waren durch die betonte Abgrenzung von der marxistischen Bewegung, durch das Hervorkehren marktwirtschaftlicher Prinzipien und durch das Ablenken von einer konsequenten Beseitigung aller sozialökonomischen und politischen Wurzeln des Faschismus beträchtlich entwertet. Zwar war der Formierungsprozeß der CDU noch nicht abgeschlossen’und war noch nicht endgültig entschieden, welche Kräfte in der CDU der Westzonen bestimmend werden sollten, doch begann sich die Waagschale schon jetzt zugunsten des katholisch-konservativen Flügels zu neigen.
Die CDU stellte sich als etwas gänzlich Neues im deutschen Parteienspektrum vor. Als Sammlungsbewegung vermochte sie ihren Anspruch, „Volkspartei“ zu sein, für viele glaubhaft zu machen. Nicht in antidemokratischen Rechtsparteien, wie sie in der Weimarer Republik bestanden hatten, sondern in dieser „Union“ sah das Monopolkapital die aussichtsreichste Wahrerin seiner Interessen. Von ihr erhoffte es sich die Abwehr aller Bestrebungen, die politischen und sozialen Verhältnisse einschneidend zu verändern.
Zu den Organisationen, die nicht uneingeschränkt in den Formierungsprozeß der CDU einschwenkten, gehörte vor allem die bayrische, die den Namen „Christlich-Soziale Union“ (CSU) annahm. Die CSU entstand mit dem über allgemeine christlich-demokratische Grundsätze hinausgreifenden Ziel, die bayrische Staatsidee zu beleben. Sollte für manche CSUPolitiker die Forderung nach dem „christlichen Bollwerk Bayern“ der Abschottung gegenüber antifaschistisch-demokratischen Bestrebungen dienen, so traten andere bereits mit einem Sendungsbewußtsein auf, das dem christlichen Bayern eine abendländischmissionarische Funktion zuschrieb. Die für die CDU anfangs typische antikapitalistische Stimmung spielte in Bayern eine weitaus geringere Rolle, denn Hauptadressaten der CSU-Politik waren Bauern, Handwerker und Gewerbetreibende. In zwei sich heftig befehdende Flügel zerrissen, die sich mit liberaler, interkonfessioneller Tendenz um Josef Müller und mit bayrisch-separatistisch-katholischer Orientierung um Fritz Schäffer und Alois Hundhammer gruppierten, waren sich die Gründer der CSU in der Behauptung ihrer Parteiautonomie weitgehend einig. Hier war eine Partei im Entstehen, die in dem voranschreitenden Prozeß restaurativer Neuordnung bald eine Vorreiterrolle übernahm.
Einige ehemalige Zentrumspolitiker, die sich nicht in die CDU oder CSU integrieren wollten, erneuerten die Zentrumspartei.
Politische Bestrebungen, die schließlich in die Herausbildung der Freien Demokratischen Partei (FDP) einmündeten, gingen in den Westzonen von Politikern aus, die meist in den Traditionen der früheren Deutschen Demokratischen Partei, der Deutschnationalen Volkspartei oder anderer bürgerlicher Gruppierungen standen. Ihre politischen Motive und Zielvorstellungen waren oft denen der Christdemokraten verwandt, und in manchen Gebieten kam es erst allmählich zu einer klaren Abgrenzung gegenüber den Gründerkreisen der CDU.
Im südwestlichen Raum, in Bremen und Hamburg knüpften die Parteigründer an frühere Landesorganisationen der DDP an, für die eine linksliberale Einstellung typisch war. Sie betonten den demokratischen Charakter der künftigen Partei, die sie als eine Kraft des politischen und sozialen Ausgleichs profilieren wollten. Repräsentativ für diese Richtung wurden Politiker wie Theodor Heuss, Reinhold Maier und Ernst Mayer. Demgegenüber war in anderen Territorien, so in Westfalen, Hessen und dem späteren Niedersachsen, die Tendenz vorherrschend, eine Sammlungspartei mit scharf antisozialistischem Akzent zu schaffen. Hier wurden Projekte geboren, die darauf abzielten, alle Kräfte rechts von den beiden Arbeiterparteien oder gar das ganze politische Spektrum rechts von der KPD zusammenzuführen. Das erwies sich allerdings sehr rasch als unrealistisch. Auf die politische Profilierung der Freien Demokraten nördlich der Mainlinie erlangten vor allem Franz Blücher, August-Martin Euler und Friedrich Middelhauve Einfluß.
Der Prozeß der Konzentration und Vereinheitlichung der organisatorischen Vorläufer der FDP gestaltete sich so schwierig und langwierig, daß er sich über Jahre hinzog. In den süddeutschen Ländern verfochten sie betont föderalistische Prinzipien und nahmen sie die demokratischen Traditionen ernster als anderweitig. Hingegen suchte sich die liberale Demokratie in Hessen, in Nordrhein und in Westfalen stärker als nationale Kraft in Szene zu setzen. Deshalb bekundete sie hier größere Bereitschaft zur Zusammenarbeit mit dem Vorstand der LDPD in Berlin. Zugleich versuchte sie aber, konservative und rechte Kräfte an sich zu binden. Schon in der Gründungsperiode stellte sich heraus, daß die christlich-demokratische Richtung die größere Fähigkeit besaß, sozial und politisch heterogene Elemente parteipolitisch zu integrieren, als die liberal-demokratische, so daß diese nicht ernsthaft mit ihr konkurrieren konnte.
Auch in den Westzonen gab es Ansätze der antifaschistisch-demokratischen. Zusammenarbeit der Arbeiterparteien mit den bürgerlichen Parteien, so in einer Reihe von Städten des Ruhrgebietes, in Frankfurt am Main, in Lübeck und anderenorts. Generell war jedoch die Bereitschaft der bürgerlichen Parteien zur Bildung eines antifaschistisch-demokratischen Blocks gering, zumal sich die Besatzungsbehörden deutlich gegen die Blockpolitik ausgesprochen hatten. So erklärte im September 1945 der Chef der amerikanischen Militärregierung in Deutschland, Dwight D.Eisenhower, der Meldung einer Nachrichtenagentur zufolge, „die Bildung einer Einheitsfront der vier politischen Parteien werde von amerikanischer Seite in ihrer Zone nicht gefördert, da dies der amerikanischen Auffassung der Demokratie nicht entspreche“.
War es in der Ostzone Ausnahmeerscheinung gewesen, daß neben den vier großen Parteien auch andere Gruppierungen nach parteipolitischer Betätigung drängten, so geschah dies in den Westzonen häufiger. Hier sahen auch antidemokratische, konservative und separatistische Politiker die Chance, Parteigebilde der Weimarer Republik zu erneuern bzw. alte Parteien und Vereinigungen den neuen Bedingungen anzupassen, selbst solche, die durch den Anschluß an die Nazibewegung oder dadurch, daß sie sich von dieser hatten aufsaugen lassen, diskreditiert waren. Obwohl die westalliierten Militärbehörden an der Belebung derartiger Organisationen nicht interessiert waren, gewährten sie ihnen doch wiederholt auf lokaler und regionaler Ebene Spielraum.
In der britischen Zone bildeten sich mit Schwerpunkt in Schleswig-Holstein und im späteren Niedersachsen Organisationen, die Traditionen der monarchistisch orientierten preußischen Konservativen, der Deutschnationalen Volkspartei und der Deutschvölkischen Freiheitspartei unter Anpassung an die veränderten Verhältnisse fortzusetzen versuchten, woraus im März 1946 die Deutsche Konservative ParteiDeutsche Rechtspartei hervorging. Gewicht erlangte die Niedersächsische Landespartei (NLP), deren Gründerkreis sich Mitte 1945 formierte und die an die Traditionen der antipreußischen Deutschhannoverschen Partei von 1866 anknüpfte. Sie profilierte sich als konservative Partei mit eindeutiger „Westorientierung“, und aus ihr ging später die Deutsche Partei hervor.
In Nordrhein entstand in Anknüpfung an die separatistischen Bestrebungen der zwanziger Jahre die Rheinische Volkspartei. Ihre Begründer behaupteten, in den rheinischen Landen sei das in Preußen „denaturierte Deutschtum“ in seiner edelsten Gestalt verkörpert. Separatistische Tendenzen äußerten sich auch in der Bildung der Südschleswigschen Wählervereinigung, die als Organisation der dänischen Minderheit ihre Berechtigung hatte, sich aber auch als Vertreter der „national-friesischen Bevölkerung“ verstand.
Auch in der amerikanischen Zone gab es Parteigründungen außerhalb der Hauptrichtungen. In einigen Kreisen Hessens konstituierte sich im Oktober 1945 die erzreaktionäre, ständisch-monarchistische Nationaldemokratische Partei. Stockreaktionär — deshalb wurde sie von amerikanischen Besatzungsbehörden bald wieder verboten — war auch die im Oktober 1945 gebildete Bayerische Heimatund Königspartei.
In Bayern entstanden aber auch zwei Parteien, die für einige Zeit Bestand erlangten und erst nach und nach der Rivalität der CSU erlagen: die Bayernpartei und die Wirtschaftliche Wiederaufbau-Vereinigung (WAV). Die vor allem in bäuerlichen und kleinbürgerlichen Schichten Altbayerns verankerte Bayernpartei war ein Sammelbecken bayrischer Separatisten und königstreuer Traditionalisten. Demgegenüber stellte die WAV, die sich zwar nicht separatistisch oder partikularistisch gab, jedoch auf Bayern beschränkt blieb, ein recht konzeptionsloses Sammelsurium dar. Sie gewann, indem sie die Existenzängste des Mittelstandes und der Umsiedler artikulierte, einige Zeit Einfluß vor allem auf durch Faschismus und Krieg verunsicherte Schichten.
Neben CDU und CSU, den unter den Namen FDP, LDP oder Demokratische Volkspartei (DVP) hervortretenden liberal-demokratischen Parteigründungen, SPD und KPD als den dominierenden Parteien gelangten auch die Zentrumspartei, die NLP und die WAV in die eine oder andere Landesregierung.
Bei all ihrer Differenziertheit zeigten die bürgerlichen Parteigründungen doch auch deutlich gemeinsame Merkmale. Typisch war das Streben nach Konzentration der Kräfte bei Überwindung konfessioneller Schranken. Die Bildung einer Sammelpartei auf dem Boden christlicher Weltanschauung entsprach einem in ganz Westeuropa zu beobachtenden Trend. Die tonangebenden Politiker bürgerlicher Parteien versuchten Einfluß zu gewinnen, indem sie den Naitonalsozialismus und dessen Verbrechen verurteilten, sich von jeder Diktatur sowie von Preußentum und Militarismus distanzierten. Dabei blieben ihre Aussagen über die Ursachen des Faschismus sehr vage, und mithin fehlten auch praktikable Konzepte, wo bei der Überwindung des Faschismus, bei der Beseitigung seiner Wurzeln und bei der Bestrafung der Schuldigen angesetzt werden sollte. Diese Tatsachen widerspiegelten, wie sehr die bürgerlichen Schichten in das faschistische Herrtschaftssystem verstrickt gewesen waren und wie wenig souverän die meisten ihrer politischen Repräsentanten die Auseinandersetzung mit dem Faschismus zu führen vermochten. Bei keiner Partei fehlten das Bekenntnis zum Frieden und die Hinwendung zu humanistischen Werten, zur „abendländischen Kultur“ und zu demokratischen Lebensformen. Das schloß oft auch Forderungen nach einer Demokratie ohne die Schwachpunkte der Weimarer Republik und nach einer sozial gerechten Ordnung ein. Bemerkenswert war die Verurteilung monopolkapitalistischer Kräfte, das Verlangen nach einer gemeinwirtschaftlichen Ordnung mit antikapitalistischer Tendenz in einer Reihe von Aufrufen. Doch blieben auf Veränderungen der sozialökonomischen Struktur abzielende Aussagen meist allgemein und unverbindlich und wurden in vielen Fällen schon bald wieder entschärft.
Nicht einmal ansatzweise gab es Versuche, die Möglichkeiten und Erfordernisse einer auf die Schaffung einer einheitlichen, demokratischen deutschen Republik orientierten Politik unter Berücksichtigung der Prinzipien und Ziele der Viermächteverwaltung Deutschlands und der Existenz von vier Besatzungszonen auszuloten. Keine der bürgerlichen Parteien zog die Schlußfolgerung, daß die restlose Überwindung des Faschismus, die Ausrottung der Quellen deutscher Aggressionspolitik, der Wiederaufbau der Heimat und die Vertretung deutscher Interessen im Hinblick auf einen künftigen Friedensvertrag ein zwischen allen Parteien abgestimmtes Vorgehen erforderten, gewissermaßen so etwas wie einen politischen ‚Gesamtwillen in der Wahrnehmung elementarer Interessen des deutschen Volkes. Statt dessen wurde versucht, den Mangel an politischer Weitsicht und das Fehlen mobilisierender Aktionsprogramme durch überbetonte weltanschauliche Bekundungen zu kompensieren. Man tat so, als ob „Verchristlichung“, „Liberalität“ oder „abendländische Werte“ an sich die Reste des Faschismus und dessen Quellen aus dem Leben der Gesellschaft verbannen könnten. Dieses Vorgehen riß weltanschauliche Gräben im antifaschistischen Lager auf, die gemeinsamem Handeln im Wege standen.
Monopolkapital und Besatzungsmächte
Die Verquickung von faschistischer Herrschaft und deutschem Rüstungskapital war so offensichtlich, daß auch in regierenden Kreisen der Westmächte eine Bestrafung der schuldigen Wirtschaftskapitäne für unerläßlich gehalten wurde. Ein von Senator Harley M. Kilgore geleiteter Ausschuß des Senats der USA zur Untersuchung der Verbrechen der deutschen Hochfinanz war im Frühjahr 1945 zu folgendem Ergebnis gelangt: „Es ist nicht wahr, daß die deutschen Groß-Industriellen sich erst im letzten Augenblick und halb gezwungen dem Nationalsozialismus angeschlossen haben. Sie waren von Anfang an seine begeisterten Förderer. Die Unterstützung seitens der deutschen Schwerindustrie und Hochfinanz ermöglichte den Nationalsozialisten die Machtergreifung. Die Umstellung der deutschen Wirtschaft auf die Kriegswirtschaft und auf die fieberhafte Rüstung zum Angriffskrieg erfolgte unter der unmittelbaren Leitung der deutschen Industriellen.“® Eine vom Kilgore-Ausschuß zusammengestellte Liste benannte 42 schwerbelastete deutsche Großindustrielle, darunter Flick, Klöckner, Krupp, Röchling, Siemens, Schmitz, von Schnitzler, Pferdmenges, Poensgen, Thyssen, Vögler und Zangen. In einer Denkschrift des US-Kriegsministeriums vom März 1945 wurden sogar 1800 Konzernund Bankherren aufgelistet, die aus ihren Stellungen entfernt und angeklagt werden sollten.
Die zunächst noch widersprüchliche Haltung der Westmäche zu den Exponenten des deutschen Monopolkapitals hatte sich auch in den wirtschaftspolitischen Grundsätzen der Direktive JCS 1067/8 niedergeschlagen. Die Anweisung, nichts für den wirtschaftlichen Wiederaufbau zu tun, kollidierte mit der durch die Besatzungsmächte übernommenen Verantwortung als oberste Gewalt in Deutschland und war nicht aufrechtzuerhalten. Doch bot die Direktive in Verbindung mit alliierten Vereinbarungen zur Liquidierung aller Überreste des Faschismus eine Handhabe, um gegen die Hintermänner des Faschismus aus den Reihen des deutschen Finanzkapitals vorzugehen.
Sehr bald jedoch nahm in der Besatzungspolitik der Amerikaner der Einfluß jener Kreise des USA-Kapitals überhand, die durch viele Fäden mit den deutschen Monopolisten verbunden waren. Analoge Entwicklungen zeigten sich auch im britisch und im französisch besetzten Gebiet. So konnte der damalige Geschäftsführer der Kölner Industrieund Handelskammer befriedigt konstatieren: „Die Finanzund Wirtschaftsoffiziere, mit denen wir zu tun hatten, waren teilweise Bankiers aus dem Mittelwesten und als Kaufleute sichtlich bestrebt, die Produktion im Rahmen ihrer Vollmachten in Gang zu bringen.“ * Der damals auf verantwortlichem Posten in der amerikanischen Militärregierung tätige bürgerliche Demokrat Arthur D. Kahn schrieb über das Verhältnis von Vertretern der Besatzungsmacht zu den deutschen Konzernherren: „Viele der Offiziere unserer Militärregierung, die selbst Unternehmer waren, erstarrten vor Ehrfurcht vor den Magnaten der internationalen Kartelle.“
Obwohl zeitgenössische Dokumente erkennen lassen, wie sehr monopolkapitalistische Kreise zunächst verunsichert waren, entstanden in den Westzonen auf ökonomischem wie auf politischem Felde Handlungsbedingungen, die jene Kräfte bevorteilten, die den Fortbestand überkommener Strukturen und traditioneller „Eliten“ sichern wollten. So konnten sich Konzernleitungen reorganisieren und trotz Beschlagnahmemaßnahmen ihre Geschäftstätigkeit fortsetzen. Der Wiederaufbau vom Monopolkapital dominierter Unternehmerverbände schritt zügig voran, rascher als der vielfältig behinderte Aufbau der Gewerkschaften.
Das Potsdamer Abkommen und die Friedenssicherung auf deutschem Boden
Inhaltsverzeichnis
- 1 Das Potsdamer Abkommen und die Friedenssicherung auf deutschem Boden
- 1.1 Der Einzug von Truppen der Westmächte in die Berliner Westsektoren
- 1.2 Die Potsdamer Konferenz und ihre Beschlüsse
- 1.3 Die Haltung Frankreichs
- 1.4 Stellungnahmen von deutscher Seite zum Potsdamer Abkommen und zur Abrechnung mit dem Faschismus
- 1.5 Der Alliierte Kontrollrat, die Alliierte Kommandantur und die Konstituierung des Internationalen Militärgerichtshofes
- 1.6 Die Chance zur Errichtung eines einheitlichen, antifaschistisch-demokratischen deutschen Friedensstaates
Der Einzug von Truppen der Westmächte in die Berliner Westsektoren
Die Regierungen der Sowjetunion, der USA und Großbritanniens hatten sich am 2. Juni 1945 definitiv darüber geeinigt, ihre letzte Kriegskonferenz in Berlin durchzuführen. Da sich in der zerstörten Stadt die Voraussetzungen dafür als unzureichend erwiesen, wurde das in unmittelbarer Nähe gelegene Potsdam Babelsberg als Tagungsort gewählt.
Im Vorfeld der Konferenz traten die in der gemeinsamen Erklärung vom 5. Juni 1945 vereinbarten Maßnahmen zur Übernahme der obersten Regierungsgewalt in Deutschland in Kraft. Vor allem wurden nun Voraussetzungen dafür geschaffen, daß der Alliierte Kontrollrat und die Alliierte Kommandantur der Stadt Berlin ihre Arbeit aufnehmen konnten. Den getroffenen Übereinkünften entsprechend und von sowjetischen Streitkräften auf Einhaltung der vereinbarten Stärke kontrolliert, rückten Anfang Juli 1945 amerikanische und britische Truppen in die für sie vorgesehenen Sektoren der Stadt ein. Am 30. Juli erfolgte dann die Bildung des französischen Sektors.
Die Fernund die S-Bahn sowie das Wasserstraßennetz in Berlin verblieben unter der alleinigen Verwaltung und Kontrolle der SMAD. Auf ihrer ersten Sitzung erklärte die Alliierte Kommandantur von Berlin ausdrücklich, daß sämtliche Befehle und Anordnungen der sowjetischen Militärbehörden und der unter ihrer Kontrolle tätigen deutschen Verwaltungen für Berlin in Kraft bleiben. All dies unterstrich ein weiteres Mal, daß die Zugehörigkeit ganz Berlins zur sowjetischen Besatzungszone von der zeitweiligen Stationierung amerikanischer, britischer und französischer Truppenkontingente in den westlichen Verwaltungsbezirken der Hauptstadt nicht berührt wurde.
Obwohl die Anwesenheit westalliierter Truppen an klar umrissene, von den Siegermächten gegenseitig eingegangene Verpflichtungen gebunden war, setzte in den Westsektoren bald eine hierzu in Widerspruch stehende Praxis ein. Amerikanische, britische und französische Besatzungsbehörden ergriffen Maßnahmen, die bereits von der sowjetischen Kommandantur erlassenen Befehlen und Weisungen des Berliner Magistrats zuwiderliefen. Sie untersagten den deutschen Verwaltungen jegliche Einflußnahme auf die Produktion und die Lenkung der Betriebe. In ihren Sektoren entfernten sie bewährte Antifaschisten wegen angeblicher Untauglichkeit oder wegen Mißachtung von Befehlen der Besatzungsmacht aus ihren Ämtern und ersetzten sie durch konservative Beamte oder andere ihnen willfährige Personen. Im August 1945 wurde im amerikanischen Sektor die Tätigkeit der Straßenund Hausobleute verboten, die sich als Bindeglied zwischen den demokratischen Verwaltungen und der Bevölkerung bestens bewährt hatten. Die britischen und die französischen Besatzungsorgane schlossen sich diesem Vorgehen an.
Wenngleich dies zunächst nur erste Anzeichen einer von der gemeinsamen Verantwortung für die Entmilitarisierung, Entnazifizierung und Demokratisierung Deutschlands abrückenden westalliierten Politik waren, so signalisierten sie doch, daß sich mit dem Einrücken westalliierter Truppen die Bedingungen für die antifaschistisch-demokratische Bewegung in Berlin verschlechtert hatten.
Die Potsdamer Konferenz und ihre Beschlüsse
Am 17.Juli 1945 wurde im Schloß Cecilienhof in Potsdam-Babelsberg die letzte der Kriegskonferenzen der „Großen Drei“ eröffnet. An der Spitze der sowjetischen Delegation stand der Vorsitzende des Rates der Volkskommissare der UdSSR, J. W. Stalin. Die amerikanische Delegation leitete der Präsident der USA, Harry S. Truman, die britische Delegation der Premierminister Großbritanniens, Winston S. Churchill. Am 25. Juli wurde die Konferenz unterbrochen, weil Churchill und seine Begleitung zur Bekanntgabe des Ergebnisses der Wahlen in Großbritannien und wegen der Neubildung der Regierung nach London flogen. Zur allgemeinen Überraschung kehrten die Briten am 28. Juli ohne Churchill, den Führer der Konservativen, nach Potsdam zurück. Die Leitung der britischen Delegation übernahm der nach dem Wahlsieg der Labour Party zum Premierminister berufene Labourpolitiker Clement Attlee.
Die Verhandlungen der Potsdamer Konferenz vollzogen sich im Zeichen verschiedenartiger, zum Teil divergierender Voraussetzungen und Tendenzen. Die Völker, die große Opfer bei der Niederringung der faschistischen Aggressoren gebracht hatten und einen dauerhaften Frieden ersehnten, erwarteten von ihren verantwortlichen Politikern, daß diese Garantien gegen jegliche Wiederbelebung des Faschismus und gegen neue Kriegsdrohungen schufen. Die meisten Bürger der alliierten Staaten sahen es als selbstverständlich an, daß die Großmächte mit diesem Ziel die in der Anti-Hitler-Koalition bewährte Kooperation fortführten. Dazu waren von früheren Konferenzen, vor allem von der Krimkonferenz, bereits tragfähige Fundamente gelegt worden.
Die Potsdamer Konferenz vom 17. Juli bis 2. August 1945. Plenarsitzung in der 2. Konferenzphase. Am Konferenztisch Mitte: die sowjetische Delegation unter Leitung J. W. Stalins, links: die britische Delegation unter Leitung Clement Attlees (zweiter von links), rechts: die amerikanische Delegation unter Leitung Harry S. Trumans (ganz rechts)
Mit der UdSSR war auf der Konferenz eine Siegermacht vertreten, die ihre stark gewachsene internationale Autorität dafür einsetzte, den Fortbestand alliierter Zusammenarbeit im Interesse eines dauerhaften Friedens zu sichern. Sie verfocht die im gemeinsamen Kampf gegen die Aggressoren bewährten antifaschistischen Prinzipien und trat als Anwalt jener antiimperialistisch-demokratischen Kräfte auf, die im Ergebnis des Kampfes und mit der Befreiung von Faschismus und Kollaborationsregimen in ihren Ländern die politische Macht übernommen hatten.
Noch war der zweite Weltkrieg nicht beendet, die Kapitulation Japans stand noch aus. Deshalb waren die USA nach wie vor darauf bedacht, die Sowjetunion zur Kriegserklärung gegen Japan zu bewegen.
Denn ohne Operationen der Roten Armee gegen die Guandongarmee waren die japanischen Festlandtruppen schwer zu bezwingen. Diese und andere Momente berechtigten zu der Erwartung, daß die Potsdamer Konferenz trotz der nicht zu übersehenden spezifischen Interessenlagen der Teilnehmerstaaten zu positiven Ergebnissen führen werde. Doch fand die Konferenz zu einem Zeitpunkt statt, an dem einflußreiche Kreise des amerikanischen und des britischen Imperialismus an Boden gewannen, die, einseitig und ohne auf Interessen der UdSSR Rücksicht zu nehmen, imperialistische Ansprüche durchzusetzen versuchten. In den Konferenzvorbereitungen der Westmächte war das Wirken jener Politiker zu spüren, die den alliierten Konsens nicht mehr respektieren wollten. Sie glaubten, man könne der Sowjetunion Bedingungen stellen bzw. deren berechtigte Forderungen ignorieren. Sie wollten sich auf der Potsdamer Konferenz Entscheidungsbefugnisse über die künftige gesellschaftliche Entwicklung in Polen und in Staaten Südosteuropas sichern, um die volksdemokratischen Revolutionen zu stoppen.
Sowohl die amerikanische als auch die britische Delegation fuhren indes mit Positionspapieren nach Potsdam, die grundsätzlich von der Zusammenarbeit der drei Mächte ausgingen, war diese doch vielfältig vertraglich festgeschrieben und institutionalisiert. Ein völliger und abrupter Kurswechsel lag zu diesem Zeitpunkt nicht im Bereich des Möglichen. Ein Scheitern der Konferenz konnte man nicht riskieren, doch sollte der UdSSR eine harte Verhandlungsrunde bereitet werden.
Am Vorabend der Potsdamer Konferenz war die Arbeit an der amerikanischen Atombombe so weit gediehen, daß deren Test unmittelbar bevorstand. Am fünften Konferenztag, dem 21. Juli, erreichte Truman in Potsdam ein ausführlicher Sonderbericht über die Atombombenexplosion, die in Alamogordo in New Mexico gezündet worden war. Als Truman erfuhr, daß der Test dieser Waffe, deren Wirkung alle bisherigen menschlichen Vorstellungen überstieg, gelungen war, glaubte er, die USA hätte nun eine militärische Überlegenheit erreicht, der sich jeder beugen müsse, und mit diesem Trumpf könne die amerikanische Delegation auf der Potsdamer Konferenz ihre Position mühelos durchsetzen. Doch die sowjetische Delegation, mit der er am Verhandlungstisch saß, ließ sich durch seine Mitteilung über die amerikanische Superwaffe nicht irritieren. Truman hatte es mit einem Verhandlungspartner zu tun, der zwar kompromißbereit war, seine Grundsätze und Interessen aber mit großem Sachverständnis und diplomatischem Geschick beharrlich zu vertreten wußte.
Zu den strittigen Punkten gehörten die Anerkennung der sowjetischen Reparationsansprüche, die Regelung der polnischen Westgrenze und die Frage der Anerkennung der neuen Regierungen Bulgariens, Rumäniens und Ungarns. Während sich die Verhandlungen hierüber in die Länge zogen, einigte man sich über die politischen Grundsätze der Behandlung Deutschlands bereits am zweiten Konferenztag. Die sowjetische Delegation akzeptierte die von der amerikanischen Seite eingebrachten Entwürfe, zu denen sie lediglich drei, allerdings gravierende Ergänzungen vorschlug. Diese umrissen die Hauptziele der Besetzung Deutschlands in Anlehnung an die Krimdeklaration klarer, legten die Errichtung deutscher zentraler Verwaltungen fest und charakterisierten den Personenkreis, der in Verwaltungen und Wirtschaftsleitungen an die Stelle der zu entfernenden Faschisten treten sollte.
In den üblicherweise als Potsdamer Abkommen bezeichneten „Mitteilungen über die Berliner Konferenz der drei Mächte“ bzw. in dem später veröffentlichten, „Protokoll“ genannten Dokument dieser Konferenz trafen die UdSSR, die USA und Großbritannien wichtige und weitreichende völkerrechtliche Vereinbarungen zu einem großen Kreis internationaler Fragen. Sie bekräftigten ihre Übereinkünfte über das Kontrollsystem in Deutschland, über die völlige Entmilitarisierung und die vollständige Vernichtung der NSDAP mit allen ihren Gliederungen und Unterorganisationen, über die Aufhebung aller nazistischen Gesetze sowie über die Bestrafung der Kriegsverbrecher bzw. schwer belasteten Faschisten.
In den politischen Grundsätzen wurde es als Ziel der Besetzung Deutschlands bezeichnet, die Verwaltungen, die Gerichte, das Erziehungswesen und andere Bereiche des öffentlichen Lebens zu demokratisieren. Die Verwaltung sollte in Richtung auf eine Dezentralisation der politischen Struktur und eine örtliche Selbstverantwortung entwickelt werden. In allen Besatzungszonen waren demokratische politische Parteien und Gewerkschaften zuzulassen und, sobald es gerechtfertigt sein würde, Wahlen zu den lokalen und regionalen Vertretungen abzuhalten. Eine deutsche Zentralregierung, so hieß es, werde bis auf weiteres nicht gebildet. Doch waren dank des sowjetischen Eintretens für einen deutschen Einheitsstaat einige „wichtige zentrale deutsche Verwaltungsabteilungen unterderLeitungvon Staatssekretären“ vorgesehen, und zwar zunächst „auf den Gebieten der Finanzen, des Transports, des Nachrichtenwesens, des Außenhandels und der Industrie“. Die wirtschaftlichen Grundsätze des Potsdamer Abkommens ordneten die Vernichtung des deutschen Kriegspotentials an. Die künftige Friedenswirtschaft sollte der deutschen Bevölkerung einen mittleren Lebensstandard ermöglichen. Das war mit drastischen — später modifizierten — Produktionseinschränkungen und -kontrollen verbunden.
Wesentlich war, daß das Abkommen strukturelle Eingriffe zur Demokratisierung der Wirtschaft vorsah, wenngleich es die Frage der Eigentumsformen nicht eindeutig entschied. „In praktisch kürzester Frist“, so wurde erklärt, „ist die deutsche Wirtschaft zu dezentralisieren mit dem Ziel der Vernichtung der bestehenden übermäßigen Konzentration der Wirtschaftskraft, die sich besonders in Form von Kartellen, Syndikaten, Trusts und anderen Monopolvereinigungen verkörpert.“67
Dem deutschen Volk wurde die Verpflichtung auferlegt, durch Reparationen einen Teil der von den faschistischen Aggressoren und Okkupanten angerichteten Schäden wiedergutzumachen. Dabei wurde der vorrangige Anspruch der Sowjetunion auf Wiedergutmachungsleistungen im Abkommen festgeschrieben, nicht aber die Höhe der Reparationssumme, obwohl in Jalta schon 20 Milliarden Dollar, von denen die Sowjetunion die Hälfte erhalten sollte, als Verhandlungsgrundlage akzeptiert worden waren. Abgelehnt wurde von westlicher Seite eine interalliierte Kontrolle des Ruhrgebiets, des größten Rüstungskomplexes des deutschen Imperialismus.
Die Unterschriften J. W. Stalins, Harry S. Trumans und Clement Attlees unter die „Mitteilung“ über die Potsdamer Konferenz
Alle Deutschland betreffenden Festlegungen waren dem zentralen Ziel der in Potsdam vereinbarten alliierten Politik untergeordnet: „Der deutsche Militarismus und Nazismus werden ausgerottet, und die Alliierten werden in Übereinstimmung miteinander in der Gegenwart und in der Zukunft auch andere Maßnahmen treffen, die notwendig sind, damit Deutschland nie wieder seine Nachbarn oder die Erhaltung des Friedens in der ganzen Welt bedrohen kann.““® Die Alliierten bekundeten zugleich, daß es nicht ihre Absicht sei, „das deutsche Volk zu vernichten oder zu versklaven. Die Alliierten wollen dem deutschen Volk die Möglichkeit geben, sich darauf vorzubereiten, sein Leben im weiteren auf einer demokratischen und friedlichen Grundlage wiederaufzubauen. Wenn die eigenen Anstrengungen des deutschen Volkes unablässig auf dieses Ziel gerichtet sein werden, wird es ihm möglich sein, mit der Zeit einen Platz unter den freien und friedlichen Völkern der Welt einzunehmen.“
Das Potsdamer Abkommen und die auf seiner Grundlage in den folgenden Jahren mit den ehemaligen Verbündeten Hitlerdeutschlands abgeschlossenen Friedensverträge fixierten einen neuen territorialen Status in Europa. Die deutsch-polnische Grenze wurde in dem „Polen“ überschriebenen Teil des Protokolls entlang der Oder und der westlichen Neiße festgelegt. Dies sollte von der künftigen Friedenskonferenz noch bestätigt werden, doch ließ die ebenfalls in Potsdam gegebene Zustimmung zur Umsiedlung der deutschen Bevölkerung an der Endgültigkeit dieser Grenzregelung kaum Zweifel. Die Übergabe der Gebiete östlich von Oder und Neiße an Polen war ein Akt der Wiedergutmachung für die vom deutschen Faschismus und Militarismus am polnischen Volk begangenen Verbrechen. Über 17 Prozent seiner Vorkriegsbevölkerung hatte Polen verloren, und es war somit das Land, dem der faschistische deutsche Imperialismus den im Verhältnis zur Bevölkerungszahl höchsten Blutzoll auferlegt hatte. Polen — über Jahrhunderte hinweg Spielball seiner Nachbarstaaten konnte nun sein nationales Leben in sicheren Grenzen neu gestalten. Die Konferenz bestätigte die Übergabe von Königsberg und des angrenzenden Gebietes an die Sowjetunion.
In einem gesonderten Abschnitt einigten sich die drei Mächte, „daß die Überführung der deutschen Bevölkerung oder eines Teils derselben, die in Polen, der Tschechoslowakei und Ungarn zurückgeblieben ist, nach Deutschland durchgeführt werden muß“?®. Obwohl die Mitteilung über die Potsdamer Konferenz keine Zahlen nannte, stand fest, daß Millionen Männer, Frauen und Kinder in den vier Besatzungszonen aufzunehmen sein werden. Mit der Steuerung dieser Umsiedlungen und der Verteilung der Umsiedler auf die einzelnen Besatzungszonen wurde der Alliierte Kontrollrat beauftragt.
Die Teilnehmerstaaten der Potsdamer. Konferenz einigten sich, einen Rat der Außenminister der fünf Großmächte ins Leben zu rufen, und luden die Regierungen Frankreichs und Chinas zur Mitarbeit ein. Als vordringliche Aufgabe dieses Gremiums wurde die Vorbereitung der Friedensverträge für Italien, Rumänien, Bulgarien, Ungarn und Finnland bezeichnet. Der Rat sollte auch „zur Vorbereitung einer Friedensregelung für Deutschland mit der Maßgabe genutzt werden, daß das entsprechende Dokument durch eine für diesen Zweck geeignete Regierung Deutschlands, nachdem eine solche gebildet sein wird, angenommen wird“.
Mit seinen demokratischen, antifaschistischen Grundsätzen entsprach das Potsdamer Abkommen dem gerechten Charakter des Krieges gegen die Aggressorstaaten. Es erlegte dem deutschen Volk ein Leben in neuen Grenzen — zunächst unter alliierter Regierungsgewalt — und auf Jahre hinaus zu leistende Wiedergutmachungsverpflichtungen auf. Es räumte ihm aber auch die Chance ein, nach grundlegender demokratischer Erneuerung als geachtetes Mitglied in die Völkergemeinschaft zurückzukehren.
Explosion der Atombombe über Nagasaki, 9. August 1945
Im Potsdamer Abkommen widerspiegelte sich das neue internationale Kräfteverhältnis, das entscheidend vom Sieg der Sowjetunion im Großen Vaterländischen Krieg und von der Befreiermission der UdSSR beeinflußt war. Das Abkommen bildete eine tragfähige Grundlage für eine gemeinsame Politik der Alliierten, für deren Partnerschaft bei der Schaffung einer Nachkriegsordnung mit gesichertem Frieden. Es lieferte ein Beispiel dafür, daß Mächte gegensätzlicher Staatsund Gesellschaftsordnungen trotz unterschiedlicher Standpunkte und Interessen — zu einer Übereinkunft gelangen können, wenn sie sich von den Lebensfragen der Völker leiten lassen und Verständigungsbereitschaft beweisen.
Während die Sowjetunion die Potsdamer Beschlüsse als eine Bekräftigung ihrer bereits praktizierten Besatzungspolitik werten konnte, war die uneinheitliche und widersprüchliche Besatzungspolitik der Westalliierten erst auf diesen völkerrechtlichen Boden zu stellen. Die USA und Großbritannien orientierten ihre Besatzungsbehörden offiziell auf die grundlegende Gültigkeit des Potsdamer Abkommens für Deutschland und wiesen sie an, bisherige Besatzungsdirektiven entsprechend zu modifizieren. In der Praxis setzte sich diese Orientierung jedoch nur partiell durch.
Für die antifaschistisch-demokratischen Kräfte des deutschen Volkes wurde das Potsdamer Abkommen zur völkerrechtlichen Grundlage ihres Wirkens, ihres Kampfes um Demokratie, sozialen Fortschritt, nationale Einheit und gerechten Frieden.
Am 2. August 1945 wurde die Potsdamer Konferenz abgeschlossen. Vier Tage darauf, am 6. August, warfen die USA die Atombombe auf die japanische Stadt Hiroshima, und am 9. August ereilte Nagasaki das gleiche Schicksal. Dieser durch nichts zu rechtfertigende Atombombenabwurf brachte 180000 Menschen den Tod, und mehr als 100.000 starben noch Jahre danach an den Folgen dieses Verbrechens. Die Entscheidung der USA für den Einsatz der von ihnen monopolisierten Massenvernichtungswaffe setzte einen die Zukunft auf schreckliche Weise gefährdenden Schlußpunkt des zweiten Weltkrieges. Sie war zugleich Auftakt zur Atombombendiplomatie der USA, zu einer amerikanischen Politik der Stärke, die den in Potsdam erneuerten Konsens der Staaten der Anti-Hitler-Koalition untergraben mußte. Selbst in der Regierung der USA gab es Stimmen, die vor der Illusion warnten, das Monopol der Atomwaffe ließe sich aufrechterhalten. Schon damals wurde die Gefahr eines atomaren Infernos erkannt. Dennoch verwarfen Präsident Truman und seine engste Umgebung die Idee einer Sicherheitspartnerschaft der Großmächte, die auch in der USA-Administration Fürsprecher hatte, und lösten ein atomares Wettrüsten aus. Damit trat eine bis dahin ungekannte Bedrohung der gesamten Menschheit in die Welt, die zur größten Herausforderung für die internationale Politik in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts werden sollte.
In Erfüllung ihrer Bündnisverpflichtungen erklärte die Sowjetunion am 8. August 1945 Japan den Krieg und eröffnete sofort die Offensive gegen die im Norden Chinas operierende japanische Guandongarmee. Die Rote Armee befreite — unterstützt durch Verbände der Mongolischen Volksarmee — die Innere Mongolei, die Mandschurei und den Norden Koreas.
Alliierter Kontrollrat für Deutschland Alliierte Kommandantur der Stadt Berlin Alliiertes Kriegsverbrechergefängnis Office of Military Government for Germany United States(OMGUS) Berlin Control Commission for Germany/British Element (CCG/BE) Berlin & Militärflughafen Berlin-Gatow PS Militärflughafen Berlin-Tempelhof
Zugleich ging auch die chinesische Volksbefreiungsarmee zum Angriff über. Am 14. August sah sich Japan gezwungen, seine Bereitschaft zur Kapitulation zu erklären. An Bord des amerikanischen Schlachtschiffes „Missouri“ nahmen die Alliierten, vertreten durch Australien, China, Frankreich, Großbritannien, Kanada, Neuseeland, die Niederlande, die UdSSR und die USA, am 2. September 1945 die japanische Kapitulation entgegen.
Der zweite Weltkrieg hatte sein Ende gefunden; die Auseinandersetzungen zwischen den Kräften des Krieges und denen des Friedens aber nahmen ihren Fortgang.
Die Haltung Frankreichs
Frankreich — obwohl Mitunterzeichner der Erklärung über die Niederlage Deutschlands vom 5. Juni 1945 und vierte Besatzungsmacht — war zur Potsdamer Konferenz nicht eingeladen worden. Die USA, aber auch Großbritannien zögerten, Frankreich als gleichberechtigte Hauptmacht der Anti-Hitler-Koalition zu behandeln, und nutzten die geschwächten Positionen der Französischen Republik zum eigenen Vorteil aus. Hatte erst die unrühmliche Haltung der französischen Großbourgeoisie gegenüber dem Faschismus und gegenüber der deutschen Okkupation dem Prestige Frankreichs Abbruch getan, so rief nach der Befreiung Frankreichs die Stärke der Linkskräfte den Unwillen der USA und Großbritanniens und deren Neigung zur Einmischung in die französischen Angelegenheiten hervor. Angesichts dieser Situation erwies sich der sowjetisch-französische Freundschaftsund Beistandspakt vom 10. Dezember 1944 als ein von der Mehrheit des französischen Volkes gefeierter außenpolitischer Erfolg, der jedoch von der Regierung de Gaulle nicht in möglichem Maße zur Erhöhung der Autorität Frankreichs genutzt wurde.
Ende Juli/Anfang August 1945 übermittelten Großbritannien, die USA und die UdSSR in eigenständigen Noten Frankreich die Einladung zur Mitwirkung im Rat der Außenminister und setzten die französische Regierung von den Entscheidungen der Potsdamer Konferenz in Kenntnis. Der französische Außenminister Georges Bidault nahm in mehreren Schreiben vom 7. August 1945 hierzu Stellung. Er billigte den Grundgehalt des Potsdamer Abkommens und legte zugleich in einer Reihe nicht unwesentlicher Fragen Vorbehalte Frankreichs dar.
Frankreich erklärte seine Bereitschaft, im Rat der Außenminister mitzuwirken. Es akzeptierte nachdrücklich die auf Entmilitarisierung, Entnazifizierung und Demokratisierung Deutschlands gerichteten Beschlüsse sowie das grundsätzliche Herangehen der drei Mächte an die Regelung der Grenzfragen und die Umsiedlung der deutschen Bevölkerung. Es gab aber keine Erklärung ab, die einen Beitritt zum Potsdamer Abkommen bedeutete.
Auf die Aufgabenstellung des Rates der Außenminister bezugnehmend, wurde von seiten Frankreichs erklärt, die französische Regierung könne „nicht a priori die Wiederherstellung einer Zentralregierung in Deutschland, die für einen unbestimmten Zeitpunkt in Aussicht genommen zu sein scheint, akzeptieren“.’? Frankreich hatte auch Einwände gegen „die Wiederherstellung der politischen Parteien für ganz Deutschland, die Schaffung zentraler Verwaltungsstellen, die von Staatssekretären geleitet würden“.”? Es erhob keinen Einspruch gegen die Oder-Neiße-Grenze und die Übergabe des Gebietes um Königsberg an die UdSSR, forderte aber Regelungen für alle Grenzen, womit es eigene Gebietsansprüche zur Geltung bringen wollte. Mit Verweis auf den zu erwartenden Bevölkerungszustrom umging Frankreich eine endgültige Stellungnahme zur Frage der Umsiedlungen. Damit hatte es Positionen umrissen, die sein Auftreten im Alliierten Kontrollrat und seine Besatzungspraxis für längere Zeit bestimmten.
Stellungnahmen von deutscher Seite zum Potsdamer Abkommen und zur Abrechnung mit dem Faschismus
Die völkerrechtlich verbindlichen Festlegungen des Potsdamer Abkommens stellten für alle gesellschaftlichen Kräfte in Deutschland einen Prüfstein dar. An der Haltung zu den Beschlüssen von Potsdam war ablesbar, wer konsequent und vorbehaltlos bereit war, alle Überreste des Faschismus auszurotten sowie einen Beitrag zur Wiedergutmachung zu leisten, und wer diese Konsequenzen zu umgehen suchte. Während in der sowjetischen Besatzungszone das Potsdamer Abkommen weite Verbreitung fand und der Bevölkerung sofort erläutert wurde, war das in den westlichen Besatzungszonen kaum der Fall.
Für die KPD, die schon die Mitteilung über die Krimkonferenz gründlich ausgewertet und ihren strategisch-taktischen Entscheidungen mit zugrunde gelegt hatte, bedeutete das Potsdamer Abkommen im wesentlichen eine Bestätigung ihrer Politik und ihrer Einschätzung der gegebenen Situation. Deshalb bedurfte es auch keinerlei Korrektur der Generallinie der KPD, wie sie im Aufruf vom 11. Juni 1945 dargelegt wurde, in dem sich die Partei auch klar zu deutscher Schuld und Mitschuld geäußert hatte. Das Sekretariat des Zentralkomitees nahm sofort zu den Ergebnissen der Potsdamer Konferenz Stellung. Seine Mitglieder traten auf Funktionärberatungen in den Parteibezirken auf. Die Potsdamer Beschlüsse und ihre Bedeutung für die Arbeit aller Mitglieder und Funktionäre wurden Gegenstand der Parteischulung.
Die Vorsitzenden der vier Blockparteien mit dem Berliner Oberbürgermeister auf der öffentlichen Kundgebung in Berlin am 12. August 1945. V. I, n. r.: Otto Grotewohl (SPD), Andreas Hermes (CDU), Wilhelm Pieck (KPD), Arthur Werner (parteilos), Waldemar Koch (LDPD)
Einen Tag nach Abschluß der Konferenz empfahl Wilhelm Pieck im Block der antifaschistisch-demokratischen Parteien, auf einer gemeinsamen Kundgebung das Potsdamer Abkommen zu begrüßen. Dieser von der SPD unterstützte Vorschlag wurde angenommen. Bei der Vorbereitung einer gemeinsamen politischen Erklärung zeigten sich allerdings erhebliche Meinungsverschiedenheiten. CDU und LDPD versuchten zunächst, eine definitive Stellungnahme zum Potsdamer Abkommen, das sie für zu hart hielten, zu umgehen. Ihre Vertreter wollten insonderheit einer ausdrücklichen Anerkennung der Pflicht zur Wiedergutmachung und der Neuregelung der Ostgrenze ausweichen. Dank des abgestimmten Auftretens der beiden Arbeiterparteien konnten jedoch zu allen Fragen Übereinkünfte aller vier Parteien bzw. Kompromißformeln erreicht werden.
Die gemeinsame Kundgebung fand am 12. August 1945 im Großen Sendesaal des Berliner Rundfunks statt. Das Wort ergriffen die Vorsitzenden der Blockparteien, Wilhelm Pieck für die KPD, Otto Grotewohl für die SPD, Andreas Hermes für die CDU und Waldemar Koch für die LDPD. Die Kundgebungsteilnehmer stimmten der im Gemeinsamen Arbeitsausschuß der Einheitsfront der antifaschistisch-demokratischen Parteien vorbereiteten gemeinsamen Erklärung einmütig zu und begrüßten die Zusammenarbeit der vier Parteien. Mit dieser ersten Öffentlichen Demonstration vereinten Handelns rückte die Blockpolitik ins Blickfeld vieler Werktätiger. In ihrer Erklärung werteten die vier Parteien das Potsdamer Abkommen als „Möglichkeit zur friedlichen Erneuerung unseres Vaterlandes“”, als Grundlage für eine demokratische Entwicklung und für den wirtschaftlichen Wiederaufstieg. Sie klagten die Schuldigen an Faschismus und Krieg an und sprachen offen aus, daß das gesamte deutsche Volk Verantwortung für die Ergebnisse des durch den Faschismus vom Zaume gebrochenen Krieges tragen und zu Wiedergutmachungsleistungen bereit sein muß. Hervorgehoben wurden jene Festlegungen des Potsdamer Abkommens, mit denen dem deutschen Volk die Chance des Neubeginns auf antifaschistisch-demokratischer Grundlage eingeräumt wurde.
Dieses Bekenntnis hatte für die antifaschistisch-demokratische Willensbildung im deutschen Volk und für sein Ansehen bei den friedliebenden Völkern der Welt großes Gewicht. Zugleich stellte die gemeinsame Erklärung die Blockpolitik auf eine stabilere Grundlage, denn bei völlig kontroversen Einschätzungen des Potsdamer Abkommens und damit der völkerrechtlichen Grundlagen der antifaschistisch-demokratischen Erneuerung Deutschlands wäre der Block nicht lebensfähig gewesen.
Am 12. August 1945 bekräftigten die vier Parteien ihre Entschlossenheit, gemeinsam Deutschland von allen Überresten des Naziregimes zu säubern. Der Gemeinsame Ausschuß der Einheitsfront diskutierte wiederholt einen Entwurf für „Richtlinien für die Bestrafung der Naziverbrecher und Sühnemaßnahmen gegen die aktivistischen Nazis“. Er betrachtete die Abrechnung mit dem Faschismus als ureigenste Aufgabe der demokratischen Kräfte des deutschen Volkes. Die Anfang November veröffentlichten Richtlinien sahen vor, alle Naziverbrechen, die nicht vor alliierten Gerichten verhandelt wurden, deutschen Gerichten zu übergeben und die Verfolgung der Naziverbrecher mit äußerster Energie in die Wege zu leiten. Aktive Nazis sollten von allen Stellungen, die des Vertrauens der Öffentlichkeit bedurften, ausgeschlossen sein und auch keine anderen politischen Rechte — eingeschlossen die Zugehörigkeit zu Parteien und Gewerkschaften — besitzen. Als Sühnemaßnahmen waren Sach-, Arbeits- und Geldleistungen vorgesehen. Demgegenüber wollten die vier Parteien allen sonstigen Mitgliedern der NSDAP und ihrer Gliederungen die Möglichkeit der Bewährung einräumen, in der Erwartung, „daß sie mit ihrer politischen Vergangenheit vollkommen brechen und sich mit ihrer ganzen Kraft am Wiederaufbau unseres Landes beteiligen“. Ausgenommen von diesen Entnazifizierungsmaßnahmen waren alle nach dem 1. Januar 1920 geborenen nominellen Mitglieder der NSDAP und ihrer Gliederungen. Diese Jugendlichen wurden also nicht dafür haftbar gemacht, daß sie den Naziparolen Glauben geschenkt hatten. Aus vertrauenswürdigen, sachund personenkundigen deutschen Antifaschisten zusammengesetzte Entnazifizierungsausschüsse konnten auf der Grundlage dieser Richtlinien eine wirksame Säuberung aller Verwaltungen, Institutionen, Betriebe, kulturellen und sonstigen Einrichtungen einleiten.
In den westlichen Besatzungszonen gab es bei Abschluß der Potsdamer Konferenz noch keine von den Militärbehörden lizenzierten deutschen Parteien, mithin auch noch kein politisches Leben im eigentlichen Sinne. Eine wirksame Aufklärung der Bevölkerung über Zweck und Ergebnisse der Potsdamer Konferenz unterblieb. Die programmatischen Überlegungen der sich formierenden bürgerlichen Parteien und des Büros Schumacher waren durch eine schroffe Ablehnung des Potsdamer Abkommens gekennzeichnet, die allerdings erst dann Öffentlich vorgetragen werden konnte, als die Westmächte selbst vom Potsdamer Abkommen abzurücken begannen. Die KPD ausgenommen, bewerteten die Parteien in den Westzonen das Potsdamer Abkommen vor allem unter dem Aspekt der Oder-Neiße-Grenzregelung und der Reparationsverpflichtungen. Die schwere Lage der Bevölkerung unter den Bedingungen der Nachkriegs- und Besatzungszeit wurde wesentlich als Folge des Potsdamer Abkommens hingestellt. Konrad Adenauer bezeichnete das Potsdamer Abkommen 1946 als „die Ursache für die Not und das Elend, in das Deutschland versinkt, für die Hungersnot und die Notlage der Wirtschaft“. Auch Kurt Schumacher bezog eine durch und durch negative Haltung zu diesem Abkommen. Er rühmte sich: „Die deutsche Sozialdemokratie hat 1945 als erster Faktor Deutschland und der Welt erklärt, die Oder-Neiße-Linie ist unannehmbar als Grenze.“’” Ihre Anerkennung sei „Nationalverrat“.
Die Ablehnung der Beschlüsse der Potsdamer Konferenz wirkte sich um so schädlicher aus, weil in den Westzonen außerhalb der Arbeiterbewegung keine Partei praktikable eigene Konzepte für die Überwindung aller Überreste des Faschismus vorlegte. Die Aussagen der bürgerlichen Parteien zur Entnazifizierung, zur Beseitigung der sozialen Wurzeln von Faschismus und Militarismus waren äußerst knapp und unverbindlich, oft nichtssagend. Der KPD aber wurde von bürgerlicher Seite wie auch vom Büro Schumacher wiederholt vorgeworfen, sie weise dem deutschen Volk undifferenziert eine Kollektivschuld zu, obwohl es einen solchen Begriff in den Aussagen ihres Zentralkomitees nicht gab.
Zu dieser Zeit befaßten sich auch beide großen Kirchen mit der Frage von Schuld und Mitschuld. Sie reagierten damit nicht zuletzt auf Kritik aus den Reihen der Gläubigen, die eine Erklärung zur Haltung der Kirchenführung in der Zeit der faschistischen Diktatur erwarteten.
Am 23. August 1945 beschloß die Fuldaer Bischofskonferenz einen Hirtenbrief, in dem sich die römischkatholische Kirche darauf berief, daß sie für die Rechte der Persönlichkeit eingetreten sei und Übergriffe des Staates in das kirchliche Leben zurückgewiesen, daß sie ihre Stimme gegen Rassendünkel und Völkerhaß erhoben habe. Sie bekannte zugleich: „Viele Deutsche, auch aus unseren Reihen, haben sich von den falschen Lehren des Nationalsozialismus betören lassen, sind bei den Verbrechen gegen menschliche Freiheit und menschliche Würde gleichgültig geblieben; viele leisteten durch ihre Haltung den Verbrechen Vorschub, viele sind selber Verbrecher geworden.“ Ohne Zweifel half eine solche kritische Botschaft vielen Gläubigen, ihr eigenes Tun in den zwölf Jahren Faschismus zu bedenken und sich mit der kollektiven und individuellen Verantwortung für das Geschehene auseinanderzusetzen. Allerdings blieb dieses Bekenntnis der Bischöfe gänzlich im Allgemeinen und benannte weder die wahren Schuldigen am Faschismus, noch fragte es nach der Rolle des Vatikans und des hohen Klerus beim Zusammenspiel zwischen faschistischem Staat und römisch-katholischer Kirche.
Ebenfalls im August 1945 fanden sich in Treysa, das in der amerikanischen Zone lag, Vertreter der evangelischen Kirche zusammen. Sie legten auf dieser Zusammenkunft die organisatorische Grundlage für die Evangelische Kirche Deutschland (EKD). Versammelt hatten sich Vertreter fast aller Landeskirchen der vier Besatzungszonen und der verschiedenen Flügel des deutschen Protestantismus. Dominierenden Einfluß erlangten in Treysa nicht die nach religiöser Erneuerung und demokratischer Konsequenz strebenden Theologen, die sich an Karl Barth oder Martin Niemöller orientierten, sondern Landesbischöfe und Bischöfe mit deutschnationaler Vergangenheit wie Otto Dibelius und Theophil Wurm.
Als sich im Oktober 1945 der Rat der EKD in Stuttgart erneut zusammenfand, bedurfte es erst der Aufforderung eines ausländischen Vertreters des Ökumenischen Rates der Kirchen, ehe eine Stellungnahme der deutschen evangelischen Kirche zur faschistischen Vergangenheit zustande kam. In diesem später oft als Schuldbekenntnis der evangelischen Kirche bezeichneten Dokument hieß es, daß sich die Kirche mit dem deutschen Volk in einer Gemeinschaft des Leidens und einer Solidarität der Schuld wisse. „Wohl haben wir lange Jahre hindurch im Namen Jesu Christi gegen den Geist gekämpft, der im nationalsozialistischen Gewaltregiment seinen furchtbaren Ausdruck gefunden hat; aber wir klagen uns an, daß wir nicht mutiger bekannt, nicht treuer gebetet, nicht fröhlicher geglaubt und nicht brennender geliebt haben.“’? Es war dies eine Absage an die nazistische Vergangenheit und für viele Protestanten ein Anstoß zum Nachdenken und zur Selbstbesinnung. Doch so eindringlich diese Selbstanklage vor Gott war, so unpräzis war sie auch; denn sie benannte weder Ursachen noch Urheber der faschistischen Gewaltherrschaft.
So widerspiegelten sich im Echo auf die Potsdamer Konferenz, in den von der Begründung einer differenzierten Schuldzuweisung bis zu Reinwaschungsversuchen reichenden Stellungnahmen zur faschistischen Vergangenheit und zur Verantwortung für das Geschehene sehr unterschiedliche Standpunkte. Es gab keine gemeinsame Berufung auf die mit dem Potsdamer Abkommen eingeräumte Chance der Errichtung eines antifaschistisch-demokratischen deutschen Friedensstaates. Doch es bedurfte gemeinsamer Wiederaufbauarbeit, gemeinsamen Strebens nach einer einheitlichen, demokratischen deutschen Republik, um die in Potsdam gegebenen Zusicherungen der alliierten Siegermächte im Interesse des deutschen Volkes zum Tragen zu bringen.
Es war Wilhelm Pieck, der bereits am 19. Juli 1945 vor einer Flucht aus der Verantwortung für die Vergangenheit warnte. Manche Stimmen gingen dahin, erklärte er, über die „Mitschuld und Mitverantwortung besser nicht zu sprechen, weil damit das deutsche Volk noch mehr belastet würde. Wir Kommunisten halten eine solche Auffassung für falsch und schädlich, weil sie dem deutschen Volke den Ausweg aus seiner schweren Lage versperrt. Ohne diese Erkenntnis über seine Mitschuld und Mitverantwortung wird unser Volk nicht die ernsten Lehren aus dieser Katastrophe ziehen, wird es sich die Erkenntnis von der Notwendigkeit der Wiedergutmachung erschweren, wird es die gleichen Fehler wie 1918 wiederholen, wird es sich nicht befreien von der verhängnisvollen Ideologie des preußischen Militarismus, des räuberischen Imperialismus und der Hetze gegen die anderen Völker, wird es nicht den Ausweg zu einem neuen, demokratischen Deutschland finden und sich nicht den Platz in der Gemeinschaft der anderen Völker erobern. Das alles hängt von dieser Erkenntnis ab. Darum steht die Frage so ernst.“
Der Alliierte Kontrollrat, die Alliierte Kommandantur und die Konstituierung des Internationalen Militärgerichtshofes
Nachdem das alliierte Besatzungsregime entsprechend den getroffenen Abmachungen und festgelegten Zonen errichtet war und die Potsdamer Konferenz eine Einigung über Prinzipien und Ziele der Behandlung Deutschland erbracht und deren praktische Umsetzung in Sichtweite gerückt hatte, waren alle Voraussetzungen für die Konstituierung des Alliierten Kontrollrates in Berlin gegeben. Am 30. Juli 1945, noch vor Abschluß der Potsdamer Konferenz, konstituierte sich der Kontrollrat und nahm seine Tätigkeit in dem im amerikanischen Sektor gelegenen ehemaligen Berliner Kammergericht auf.
Der Alliierte Kontrollrat bestand aus einem mehrstufigen Apparat: dem eigentlichen Kontrollrat, den die vier Oberbefehlshaber bildeten, und dem Kontrollapparat, bestehend aus zwölf Direktoraten, die unter Leitung eines vierseitigen Koordinierungsausschusses arbeiteten, der die Sitzungen des Kontrollrates vorbereitete. Die Direktorate waren ebenfalls vierseitig zusammengesetzt. Ihnen unterstand wiederum eine Vielzahi von ebenfalls vierseitig besetzten Kommissionen und Unterkommissionen sowie besonderen Arbeitsgruppen. Alles in allem verfügte der Kontrollrat über einige zehntausend Mitarbeiter.
Der Alliierte Kontrollrat hatte die Aufgabe, alle Deutschland als Ganzes betreffenden Fragen zu entscheiden und für eine angemessene Koordinierung der Besatzungspolitik in den vier Zonen zu sorgen. Seine Tätigkeit gipfelte in Gesetzgebungsund Rechtsetzungsakten in Form von Proklamationen, Gesetzen und Direktiven, die sich auf Deutschland als Ganzes bezogen bzw. für alle Besatzungszonen Geltung haben sollten. Das geschah, indem sich die Zonenbefehlshaber auf sie bezogen oder sie für ihre Zone bekräftigten und ihnen in Form von eigenen Gesetzgebungsoder Rechtsetzungsakten Gültigkeit verliehen. Der Kontrollrat arbeitete nach dem Einstimmigkeitsprinzip; kein Mitglied konnte durch Mehrheit überstimmt werden.
Auch nach der Konstituierung des Alliierten Kontrollrates verblieb dem jeweiligen Oberbefehlshaber die oberste Gewalt für seine Besatzungszone, die er auf Weisung seiner Regierung ausübte. So konnte er auch in jenen Fragen selbständig handeln, über die es im Kontrollrat zu keiner Einigung kam oder über die noch keine Übereinstimmung erzielt worden war. Diese Möglichkeit barg die Gefahr des unkoordinierten Vorgehens und einer unterschiedlichen Entwicklung der Besatzungszonen in sich. Die in Aussicht genommene Bildung deutscher Zentralverwaltungen konnte und sollte dem entgegenwirken.
Eine alliierte Militärregierung für Deutschland mit unmittelbar exekutiver Gewalt im eigentlichen Sinne war der Alliierte Kontrollrat somit nicht. Er war vielmehr das höchste Gesetzgebungs-, Rechtsetzungs-, Koordinierungsund Kontrollorgan.
Personell bildeten den Kontrollrat am Beginn seiner Tätigkeit die vier Oberbefehlshaber G. K. Shukow (UdSSR), Dwigth D. Eisenhower (USA), Bernard L. Montgomery (Großbritannien) und Marie-Pierre Koenig (Frankreich). Ihre Stellvertreter, die zugleich an der Spitze des Koordinierungsausschusses standen, waren W. D. Sokolowski (UdSSR), Lucius D. Clay (USA), Brian H. Robertson (Großbritannien) und Louis-Marie Koeltz (Frankreich). Sie nahmen zusammen mit den politischen Beratern im Range von Botschaftern und weiteren Mitarbeitern bzw. Spezialisten an den Beratungen des Kontrollrates teil. Hinzu kamen noch sechs bis acht Mitglieder des Sekretariats des Kontrollrates, so daß der Beraterkreis, ohne Dolmetscher und technisches Personal, in der Regel 25 bis 30 Personen umfaßte.
Der Kontrollrat trat am 10., 20. und 30. Tag jedes Monats unter jeweils wechselndem Vorsitz zu seinen Sitzungen zusammen. Schon kurze Zeit nach Aufnahme seiner Tätigkeit erließ er — gestützt auf von der UdSSR, den USA und Großbritannien 1944/45 in der Europäischen Beratenden Kommission ausgearbeitete oder vorbereitete Dokumente — zahlreiche Proklamationen, Gesetze und Direktiven, an denen sich die antifaschistisch-demokratischen Kräfte des deutschen Volkes im Ringen um die Überwindung von Militarismus und Faschismus, um Demokratisierung und Friedenssicherung orientieren konnten. Dazu gehörten Gesetze und Direktiven über die Entmilitarisierung Deutschlands, die Beseitigung aller Naziorganisationen, der Nazigesetzgebung, über die Umgestaltung des Gerichtsund Rechtswesens, die Entfernung von Militaristen und Nazis sowie bestimmter nazistisch belasteter Kategorien von Personen aus dem öffentlichen Leben und aus leitenden Stellungen in der Wirtschaft, die Bestrafung von Naziund Kriegsverbrechern und die Einsetzung antinazistisch-demokratischer Personen in verantwortliche Ämter. Am Schluß der Direktive Nr. 24 vom 12. Januar 1946 wurde zusammenfassend der bedeutsame Grundsatz proklamiert: „Es ist wesentlich, daß die leitenden deutschen Beamten an der Spitze von Provinzen, Regierungsbezirken und Kreisen erwiesene Gegner des Nationalsozialismus sind, selbst wenn dies die Anstellung von Personen nach sich zieht, deren Eignung, ihren Aufgabenkreis zu erfüllen, geringer ist.“!
Der Sitz des Alliierten Kontrollrates in Deutschland im Gebäude des früheren Kammergerichts in Berlin-Schöneberg
Der Kontrollrat gelangte im Fall des IG-Farben-Konzerns zu einem gemeinsamen Beschluß, der dem in Potsdam bekräftigten Ziel entsprach, die deutschen Monopolvereinigungen zu beseitigen. Er beschlagnahmte am 30.November 1945 mit Gesetz Nr.9 sämtliche in Deutschland gelegenen Anlagen und Vermögenswerte, die sich im Eigentum oder unter der Kontrolle dieses Konzerns befanden. Diese Maßnahme erfolgte, um „jede künftige Bedrohung seiner Nachbarn oder des Weltfriedens durch Deutschland unmöglich zu machen, und mit Rücksicht auf die Tatsache, daß die I. G. Farbenindustrie sich wissentlich und in hervorragendem Maße mit dem Ausbau und der Erhaltung des deutschen Kriegspotentials befaßt hat …“ Es wurde bestimmt, daß alle Rechte der IG Farben auf den Kontrollrat übergehen. Dieser sollte einen speziellen Viermächtekontrollausschuß bilden, dessen Aufgabe es sein sollte, die Bereitstellung von Teilen der Anlagen und Vermögenswerte der IG Farben für Reparationen, die Zerstörung ihres ausschließlichen Kriegspotentials, die Veränderung der Eigentumsrechte an den verbleibenden Anlagen und Vermögenswerten, die Liquidierung aller Kartellbeziehungen sowie die Kontrolle der Forschungs- und Produktionstätigkeit zu sichern.
Der Kontrollrat gelangte auch schnell zu einvernehmlichen Entscheidungen hinsichtlich der Umsiedlung deutscher Bevölkerungsteile.. Gemäß den Beschlüssen der Potsdamer Konferenz verabschiedete er bereits am 21.November 1945 einen Plan, der die Verteilung der Umsiedler — zunächst ging man von 6650000 Menschen aus — auf die einzelnen Besatzungszonen regelte. Indem sich der Alliierte Kontrollrat mit der Umsiedlung befaßte und mit seinen Direktiven die Aufnahme von Umsiedlern regelte, war es möglich, diese Umsiedlung so durchzuführen, daß sie bei aller ihr innewohnenden Härte nicht in einer Katastrophe endete. Zugleich wurde damit bekräftigt, daß die Siegermächte der Grenzveränderung im Osten keinen provisorischen, sondern im Prinzip endgültigen Charakter beimaßen.
Wirksamkeit und bleibende Erfolge der Tätigkeit des Alliierten Kontrollrates hingen wesentlich von der Bildung deutscher Zentralverwaltungen ab. Diesen kam mit Blick auf die angestrebte Viermächteregelung der deutschen Frage und für die Wiedererlangung deutscher Souveränität höchste Bedeutung zu, zumal sie die Vorstufe einer künftigen deutschen Regierung darstellen konnten. Bereits Ende 1945 lagen für die Errichtung deutscher Zentralverwaltungen für Post und Verkehr, für Transport, für Außenhandel, für Finanzen und für Industrie Entwürfe vor, die eine vom Wirtschaftsdirektorat eingesetzte Arbeitsgruppe „Deutsche Zentralverwaltungen“ vorbereitet hatte. Doch handelte es sich nur um dreiseitige Entwürfe, denn der französische Delegierte nahm seit dem 22.Oktober 1945 an der Tätigkeit dieser Arbeitsgruppe nur noch als Beobachter teil. Die französische Sektion des Alliierten Kontrollrates hatte ihren grundsätzlichen Vorbehalt gegenüber deutschen Zentralverwaltungen angemeldet; nach französischer Auffassung mußte vor deren Bildung eine Klärung von Grenzfragen — wobei vor allem an die französisch-deutsche Grenze gedacht war — und des Schicksals des rheinisch-westfälischen Industriegebietes erfolgen. Damit beeinträchtigte die französische Sektion die Handlungsfähigkeit des Alliierten Kontrollrates bereits in seiner Anfangsphase in einer gewichtigen, übergreifenden Angelegenheit.
Dennoch gelangte der Kontrollrat in den ersten Monaten seines Wirkens — wenngleich oft erst im Ergebnis hartnäckig geführter Verhandlungen zu einer beträchtlichen Zahl einvernehmlich gefaßter Beschlüsse. So schien die Erwartung berechtigt, daß die Meinungsverschiedenheiten über die deutschen Zentralverwaltungen beigelegt und eine Einigung auch in dieser Frage erzielt werden könnte. Wenn auch die Ansichten der vier Mächte darüber auseinandergingen, mit welchem Inhalt, in welchen Formen und auf welchen Wegen die Liquidierung des deutschen Faschismus und Militarismus, die Beseitigung der Monopolvereinigungen und die Demokratisierung des öffentlichen Lebens vor sich gehen sollten, so erbrachte der Alliierte Kontrollrat doch den Beweis, daß Kompromißformeln gefunden werden konnten und daß die Viermächteverwaltung zunächst generell funktionierte.
Gleiches traf auch auf die Interalliierte Kommandantur für Groß-Berlin (ab August 1945 Alliierte Kommandantur der Stadt Berlin) zu. Sie konstituierte sich am 11. Juli im Gebäude der sowjetischen Zentralkommandantur, die ihren Sitz von Berlin-Lichtenberg nach Berlin-Mitte verlegt hatte, unter Vorsitz des sowjetischen Militärkommandanten Generaloberst A.W.Gorbatow. Ihren ständigen Sitz nahm sie im ehemaligen Stadtbezirksgericht Berlin-Dahlem im amerikanischen Sektor. Nachdem die französischen Truppen am 12. August 1945 die ihnen zugewiesenen Stadbezirke besetzt hatten, beteiligte sich auch der französische Vertreter an der Arbeit der Alliierten Kommandantur. Die ebenfalls mit wechselndem Vorsitz tagende Alliierte Kommandantur unterstand dem Alliierten Kontrollrat bzw. unmittelbar seinem Koordinierungsausschuß.
Wachposten der Alliierten Kommandantur in Berlin-Dahlem, 1945
Eng arbeiteten die Hauptmächte der Anti-Hitler-Koalition bei der Verfolgung und Bestrafung von Nazi- und Kriegsverbrechern zusammen, wie sie das auf ihren Konferenzen vereinbart hatten. Einem Viermächteabkommen vom 8. August 1945 gemäß, dem sich in der Folgezeit weitere 19 Staaten anschlossen, wurde ein Internationaler Militärgerichtshof gebildet. Er trat am 18. Oktober 1945 im Großen Sitzungssaal des Gebäudes des Alliierten Kontrollrates in Berlin-Schöneberg zu seiner Eröffnungssitzung zusammen und nahm die Anklageschrift gegen die Hauptkriegsverbrecher entgegen. Diese enthielt vier Anklagepunkte: Punkt eins: Gemeinsamer Plan bzw. Verschwörung gegen den Frieden; Punkt zwei: Verbrechen gegen den Frieden; Punkt drei: Kriegsverbrechen; Punkt vier: Verbrechen gegen die Humanität.
Angeklagt waren mit den 21 inhaftierten Hauptbeschuldigten zugleich die Reichsregierung, faschistische Organisationen, der deutsche Generalstab und andere Institutionen des’ „Dritten Reiches“ und damit das faschistische Regime als Ganzes.
Die Hauptverhandlung im Prozeß gegen die nazistischen Hauptkriegsverbrecher begann am 20. November 1945 in Nürnberg. In dem zehn Monate währenden Prozeß unterbreiteten die Vertreter der Anklage eine erdrückende Fülle von Beweismaterial über den verbrecherischen Charakter des deutschen Faschismus und die Schuld der Hauptangeklagten. Die internationale und die deutsche Öffentlichkeit erfuhr durch eine umfassende Berichterstattung das ganze Ausmaß der Verbrechen der Naziführung: deren gezielte Kriegsvorbereitungen, deren barbarische Kriegführung, deren Ausrottungspolitik gegen andere Völker, gegen Menschen anderer Überzeugung und anderen Glaubens. Bloßgelegt wurde der unmenschliche Perfektionismus ihrer terroristischen Maschinerie.
Viele Deutsche, die bisher vor den Tatsachen die Augen geschlossen hielten, mußten nun bittere Wahrheiten zur Kenntnis nehmen. Für manchen gläubigen Hitleranhänger brach eine Welt zusammen. Der Nürnberger Prozeß gehörte zu jenen Ereignissen, von denen die stärksten Impulse für den politisch-ideologischen Klärungsprozeß im deutschen Volke ausgingen. In der Stellung zum Nürnberger Prozeß schieden sich die Geister. Jeder Deutsche war gefordert, sich Rechenschaft über sein Verhalten während der zwölf Jahre Naziherrschaft abzulegen.
Die Chance zur Errichtung eines einheitlichen, antifaschistisch-demokratischen deutschen Friedensstaates
Mit der Befreiung vom Faschismus hatten die Worte von Friedrich Engels aus dem Jahre 1848 erneut höchste Aktualität erlangt: „Soll Deutschlands Blut und Geld nicht länger gegen seinen eigenen Vorteil zur Unterdrückung anderer Nationalitäten vergeudet werden, so müssen wir eine wirkliche Volksregierung erringen, das alte Gebäude muß bis auf seine Grundmauern weggeräumt werden.“® Die Erfahrungen der Geschichte, insonderheit die schlimmen Resultate eines halben Jahrhunderts imperialistischer Politik, geboten, endlich einen wahrhaft progressiven deutschen Staat zu schaffen.
Die Herausbildung eines solchen einheitlichen deutschen Friedensstaates lag im Interesse europäischer Friedenssicherung. Gelang es, eine deutsche Republik zu schaffen, die sich von allen „großdeutschen Träumen“ verabschiedete, die keine Revanchepläne hegte und keine Aufrüstung betrieb, die zur Wiedergutmachung bereit war, deren Neutralität und Unantastbarkeit von den Großmächten garantiert wurden, so war nicht nur im Zentrum Europas jeglicher Kriegsherd ausgetreten, sondern ließ sich auch entschiedener der Herausbildung und Konfrontation von Militärblöcken auf dem europäischen Kontinent entgegenwirken. Das politische, ökonomische und kulturelle Gewicht eines solchen deutschen Staates mußte in der europäischen und Weltpolitik zugunsten der Kräfte des Friedens, der Demokratie und des sozialen Fortschritts in die Waagschale fallen.
Indes war die Existenzberechtigung eines deutschen Einheitsstaates in politisch tonangebenden Kreisen der westalliierten Siegermächte umstritten. Überlegungen, die deutsche Frage durch eine Aufgliederung des Landes oder die Bildung deutscher Teilstaaten zu lösen, waren nicht aufgegeben, auch wenn sie zeitweise kaum Öffentlich erörtert wurden, nachdem man sich von der Bildung der Besatzungszonen einen ähnlichen Effekt versprach. Andererseits hatten die alliierten Mächte auf ihren Konferenzen Zeichen gesetzt, die von den Verfechtern einer einheitlichen, antifaschistisch-demokratischen deutschen Republik als Ermutigung angesehen werden durften. Die Alliierten hatten sich in völkerrechtlich verbindlichen Dokumenten dafür ausgesprochen, mit dem entmilitarisierten, entnazifizierten und demokratisierten Deutschland einen Friedensvertrag abzuschließen und ihm seine Souveränität wiederzugeben. In der Sowjetunion, die an einem deutschen Friedensstaat am stärksten interessiert war, besaß das deutsche Volk einen Anwalt, der in der internationalen Arena die antifaschistisch-demokratischen Übereinkünfte der Anti-Hitler-Koalition auch nach Beendigung des Krieges energisch und beharrlich weiterverfocht und sie der eigenen Deutschland-und Besatzungspolitik zugrunde legte.
Vor allem in der sowjetischen Besatzungszone verfügten die Vorkämpfer der einheitlichen, demokratischen deutschen Republik über große Entfaltungsmöglichkeiten; hier konnten sie den politischen und sozialen Grundlagen des angestrebten deutschen Friedensstaates bereits reale Gestalt verleihen. Mit diesem Staat wollten sie einen Boden erobern, auf dem die Frage der weiteren gesellschaftlichen Perspektive in offener, demokratischer Auseinandersetzung entschieden werden konnte.
Aus all dem ergab sich die Chance einer historischen Wende. Sie konnte jedoch nur dann Realität werden, wenn sie von allen demokratischen Parteien und Organisationen, von allen Antifaschisten und Patrioten bewußt und engagiert genutzt wurde. Dazu bedurfte es eines politischen Zentrums, für das nur die historisch gewachsene Hauptstadt Berlin in Frage kam. Wesentliche Bedingung waren das einheitliche Handeln der Arbeiterklasse, die Überwindung der Spaltung der Arbeiterbewegung.
Viel hing davon ab, daß die politischen Parteien von einer gemeinsamen Verantwortung für die Zukunft des deutschen Volkes ausgingen und über alle Differenzen hinweg in den kardinalen Fragen einen Konsens herstellten, etwa so, wie er in den Manifestationen des Blocks der antifaschistisch-demokratischen Parteien enthalten war.
Eine derartige Übereinstimmung kam jedoch nur in der sowjetischen Besatzungszone zustande. In den Westzonen verlief der politische Auftakt anders. Frühzeitig dominierte hier die Rivalität der politischen Lager. Zudem grenzten sich die Führer bürgerlicher Parteien und das Büro Schumacher von den gesellschaftlich progressiven Veränderungen im Osten Deutschlands ab, oft bevor sie sich überhaupt gründlich mit den Geschehnissen vertraut gemacht hatten. Damit verbunden war die Abkehr von der Metropole Berlin, der von verschiedenen Seiten die Berufung zur künftigen deutschen Hauptstadt abgesprochen wurde. Schon 1945 traten bürgerliche Politiker mit Plänen hervor, die auf eine separate Entwicklung bestimmter Territorien oder auf eine weitgehende Auflockerung des deutschen Nationalverbandes abzielten. Obwohl nur bei fortdauernder alliierter Zusammenarbeit Aussicht bestand, die nationale Einheit der Deutschen in einer friedliebenden, demokratischen Republik zu bewahren, setzten bürgerliche und manche sozialdemokratische Politiker auf Differenzen zwischen den Siegermächten. Sie glaubten, aus einem neuerlichen antisowjetischen Kurs der Westmächte Vorteile für die eigene Politik ziehen zu können.
Diese Optionen und Handlungen, die wenig Einsicht in die für die deutsche Nation bereits entstandenen und weiter zunehmenden Gefahren erkennen ließen, mußten aber noch nicht das letzte Wort bürgerlicher und sozialdemokratischer Politik in den Westzonen sein. Noch handelten auch dort zahlreiche kommunistische und sozialdemokratische Parteiorganisationen in enger Aktionsgemeinschaft. Es existierten Felder, auf denen Vertreter aller Parteien der Westzonen zusammenwirkten: Verwaltungen von Ländern bzw. Provinzen, Kreisen, Städten und Gemeinden, Redaktionen von Zeitungen und Zeitschriften oder des Rundfunks, antifaschistische Komitees und Entnazifizierungsausschüsse. Viele Entscheidungssituationen standen erst noch bevor. Es war noch offen, welche Linie deutscher Nachkriegspolitik sich durchsetzen wird. Doch außer Zweifel stand, daß die Auseinandersetzung um den weiteren Entwicklungsweg zur Drehachse der politischen Kämpfe in Deutschland werden mußte.
Antifaschistisch-demokratische Umgestaltungen und Gründung der SED, Die gesellschaftlich-politische Polarisierung auf deutschem Territorium (Herbst 1945 bis Herbst 1946)

Antifaschistisch-demokratische Umgestaltungen und Gründung der SED. Die gesellschaftlich-politische Polarisierung auf deutschem Territorium (Herbst 1945 bis Herbst 1946)
Die demokratische Bodenreform
Inhaltsverzeichnis [verstecken]
- 1 Die demokratische Bodenreform
- 1.1 Forderungen nach einer Bodenreform
- 1.2 Die Konzeption der KPD
- 1.3 Die Bodenreformverordnungen
- 1.4 Junkerland in Bauernhand
- 1.5 Die Ergebnisse der Bodenreform
Forderungen nach einer Bodenreform
Die Sicherung der Ernährung war eines der drängensten Probleme. Parteien in allen Besatzungszonen artikulierten Forderungen nach einer Agrarund Bodenreform, allerdings mit unterschiedlichen, ja gegensätzlichen Vorstellungen.
Die KPD verband von vornherein den Kampf um das Brot mit dem Ringen um eine demokratische Wende auf dem Lande. Bei der Ernteeinbringung konzentrierte sie ihre politische Arbeit stärker auf das Dorf. Ihre Bemühungen zur Mobilisierung aller Kräfte verband sie mit der Aufklärung insbesondere über den Punkt 7 ihres Aufrufes vom 11.Juni 1945, in dem die Liquidierung des Großgrundbesitzes und die Verteilung des Grund und Bodens sowie des Inventars der Güter an „die durch den Krieg ruinierten und besitzlos gewordenen Bauern“! gefordert worden waren. Bereits Mitte August 1945 veröffentlichte die Schweriner „Volkszeitung“, das Organ der KPD für MecklenburgVorpommern, Berichte über Dorfversammlungen, so aus Demern im Kreis Schönberg und aus Leezen im Landkreis Schwerin. Die Frage, wie es mit der Bewirtschaftung der großen Güter weitergehen soll, bewegte immer mehr Menschen. Nachdem das Sekretariat des ZK der KPD zu Beginn der dritten Augustdekade die sofortige Inangriffnahme der Bodenreform beschlossen hatte, wurde die gesamte Partei für die intensive politisch-ideologische Kampagne mobilisiert. Die Parteipresse begründete in vielen Artikeln die Notwendigkeit der Bodenreform. In Hunderten von Dörfern sprachen Funktionäre der KPD mit Landarbeitern, Bauern und Umsiedlern und beriefen Versammlungen ein. Zustimmende Resolutionen zur Bodenreform wurden von den Zeitungen in steigender Zahl publik gemacht. Kleinbauern und Landarbeiter richteten Briefe an die Landesbzw. Provinzialverwaltungen mit der Bitte, gesetzliche Bestimmungen zu erlassen.
Wenn in den Dorfversammlungen auch die Zustimmung zu den Vorschlägen der Kommunisten überwog, so mußten sich die Funktionäre der KPD doch mit vielen Zweifeln und Vorbehalten auseinandersetzen. Die meisten waren überrascht, daß schon jetzt eine Bodenreform durchgeführt werden sollte, wo doch die Kriegsfolgen noch schwer auf dem Dorf lasteten. Im Ergebnis der intensiven politischen Arbeit wurde schließlich breiten Kreisen der werktätigen Landbevölkerung zunehmend bewußt, daß die Vorschläge der KPD in ihrem eigenen Interesse lagen. Die Losung „Junkerland in Bauernhand“, die Forderung nach der Landaufteilung, übte auf die landarme und landlose Dorfbevölkerung, nicht zuletzt auch auf die Umsiedler, eine starke Anziehungskraft aus.
Diese breite Resonanz hatte auch Rückwirkungen auf die KPD selbst. Als die Parteiführung Anfang August 1945 auf Funktionärsberatungen in den Ländern und Provinzen das Bodenreformkonzept zur Diskussion gestellt hatte, waren von seiten nicht weniger Funktionäre Bedenken gegen eine Aufteilung der Güter geäußert worden. Statt diese aufzusiedeln, sollte man sie als Staatsgüter oder genossenschaftliche Betriebe weiterführen. In Dorfversammlungen erlebten dann die Vertreter solcher Auffassungen, wie fern frühere Losungen dem Trachten der Landbevölkerung standen.
Anfang September begann sich eine Massenbewegung der Landarbeiter, landarmen Bauern, kleinen Landpächter und Umsiedler zu entwickeln. Mancherorts bildeten sie bereits — ohne eine Gesetzgebung abzuwarten — Komitees zur Landaufteilung. In Mecklenburg-Vorpommern geschah das in rund 500 von 2400 Gemeinden. Die Kommunisten setzten sich dafür ein, daß die Werktätigen im Geiste der Volkssouveränität die Schranken bürgerlicher Staatlichkeit überschritten. Mit dieser Bewegung entstand nun jene gesellschaftliche Kraft im Dorf, die imstande war, die Agrarumwälzung durchzusetzen.
War es KPD und SPD bei der Organisierung der Ernte vielfach schon gelungen, in jenen Dörfern, wo bereits vor 1933 ein starker Einfluß der organisierten Arbeiterbewegung bestanden hatte, Ortsgruppen zu bilden, so kamen nun weitere hinzu.
Den Auftakt für die Bodenreform bildeten Anfang September von der KPD organisierte Massenkundgebungen und Bauernkonferenzen. Am Sonntag, dem 2. September, sprach Wilhelm Pieck auf einer Konferenz in Kyritz vor Bauern, Landarbeitern und Umsiedlern aus dem Kreis Ostprignitz. Er begründete die Notwendigkeit der Bodenreform und erläuterte die Vorstellungen der KPD. In einer Entschließung stimmten die Teilnehmer den Vorschlägen der KPD einmütig zu und gelobten, „alle Kräfte an die Vorbereitung und Durchführung der Bodenreform zu setzen und auch damit Garantien für die Schaffung eines friedlichen, demokratischen Deutschlands zu schaffen und den Wiederaufbau unserer durch Hitler ruinierten Wirtschaft zu fördern“.?
In Weimar, der thüringischen Landeshauptstadt, tagte am 2. September eine Landesbauernkonferenz mit rund 2000 Delegierten. Die Konferenzteilnehmer forderten in einem Aufruf an alle Bauern Thüringens „die Enteignung aller aktiven Nazibauern und die Enteignung der Höfe wohlbegüterter Leute, die keine Bauern sind (Direktoren, Bankiers usw.)“. Sie erklärten: „Wir Thüringer Bauern sind uns einig im Willen, ein festes Band mit den Arbeitern zu knüpfen. Wir Bauern sehen in dem Aufruf der KPD den Weg, der uns aus Not und Elend, Tod, Ruinen und Schmach zur Freiheit des Volkes und zu einem neuen, würdigen Leben führen wird.“? In der Provinz Sachsen fanden in 31 von 35 Kreisen Kreisbauernkonferenzen statt, nachdem schon in zahlreichen Dörfern — nach Schätzungen in etwa einem Drittel -— Dorfversammlungen stattgefunden hatten.
In allen Ländern war zu dieser Zeit die Bildung von Bodenreformkommissionen bereits im Gange. In Mecklenburg-Vorpommern wurden an diesem Tag allein im Kreis Ludwigslust in 44 Dörfern Bauernkomitees gewählt. Die werktätige Landbevölkerung, die die Losung „Junkerland in Bauernhand“ aufgegriffen hatte, ging zum praktischen Handeln über.
Die Konzeption der KPD
Am 22. August 1945 verabschiedete das Sekretariat des ZK der KPD eine Direktive über die Durchführung der Bodenreform in der sowjetischen Besatzungszone bis Ende Oktober 1945. Hauptpunkte waren: entschädigungslose Enteignung des privaten Großgrundbesitzes über 100 Hektar und der Höfe von Naziaktivisten und Kriegsverbrechern unabhängig von der Besitzgröße; Bildung eines staatlichen Bodenfonds aus den enteigneten Betrieben und den staatlichen Domänen; Aufteilung des größten Teils des Boden-
fonds als Privateigentum, wobei die neuen Bauernstellen bei guten und mittleren Böden 5 Hektar, bei schlechten oder sehr schlechten Böden 8 bis 10 Hektar groß sein sollten; Verteilung des Viehs und der einfachen Produktionsgeräte an Neubauern und Übergabe der Traktoren und großen Landmaschinen sowie von Werkstätten und von Betrieben zur Verarbeitung landwirtschaftlicher Erzeugnisse an zu schaffende Ausschüsse der gegenseitigen Bauernhilfe für eine gemeinsame Nutzung. Die werktätige Dorfbevölkerung sollte die Bodenreform selbst in die Hand nehmen. Dazu war die Wahl von Gemeindekommissionen vorgesehen. Wesentlichen Anteil an der Ausarbeitung der Bodenreformkonzeption hatten Rudolf Reutter, Leiter der Abteilung Land des Sekretariats der KPD, und Edwin Hoernle, dem von der SMAD das Amt des Präsidenten der Deutschen Verwaltung für Landund Forstwirtschaft übertragen worden war. Edwin Hoernle, Mitglied der Arbeiterpartei seit 1910 und Reichstagsabgeordneter der KPD seit 1924, hatte in Moskau als Agrarexperte und Führungskader der Thälmannschen Partei an der Ausarbeitung der programmatischen Dokumente für den antifaschistischdemokratischen Neuaufbau mitgewirkt.
Die mit der Volksfrontstrategie des VII. Kongresses der Kommunistischen Internationale eingeleitete neue Etappe-programmatischer Arbeit hatte die KPD wie andere kommunistische Parteien zu einem Konzept für die Lösung der Bodenbzw. der Bauernfrage geführt, das der strategischen Orientierung auf die antiimperialistische Volksrevolution unter Berücksichtigung des gesetzmäßigen Zusammenhangs zwischen dem Kampf um Demokratie und dem Kampf um Sozialismus entsprach. Der Kernpunkt der demokratischen Erneuerung des Dörfes war die Enteignung und Aufsiedlung des Großgrundbesitzes. Die KPD knüpfte damit an ihre programmatischen Dokumente von 1931 an, die in der Agrarfrage auf dem von Lenin für den II. Kongreß der Komintern konzipierten „Entwuıf der Thesen zur Agrarfrage“ beruhten, und nahm das Erbe der revolutionären deutschen Sozialdemokratie auf, Zugleich machte sie sich Erfahrungen zu eigen, die die KPdSU bei der Agrarumwälzung im Zuge der Oktoberrevolution gewonnen hatte. Sie berücksichtigte auch den Hinweis Lenins, die Arbeiterklasse müsse unter bestimmten Umständen bäuerliche Forderungen nach einer Bodenaufteilung unter Verzicht auf eine Nationalisierung von Grund und Boden unterstützen.
Solche Bedingungen waren 1945 gegeben. Besonders der Reifegrad des politischen Bewußtseins der werktätigen Landbevölkerung ließ es zweckvoll erscheinen, von der Überführung der Masse der enteigneten Güter in gesellschaftliches Eigentum Abstand zu nehmen. Die Beibehaltung der landwirtschaftli-
chen Großbetriebe hätte vor allem ein fortschrittliches, politisch geschultes Landproletariat vorausgesetzt. Die landarmen Bauern und auch viele Landarbeiter drängten nach eigenem Grund und Boden. Dieser Drang resultierte aus der bisherigen Unsicherheit ihrer Existenz und entsprach den tief verwurzelten Traditionen des bäuerlichen Eigentums in Deutschland. Auch die ungesicherte Existenz der Umsiedler mußte bedacht werden.
Der intensiv bewirtschaftete landwirtschaftliche Großbetrieb stellte zwar im Vergleich zur bäuerlichen Parzellenwirtschaft prinzipiell die ökonomisch höhere Wirtschaftsform dar, doch kam es 1945/46 vor allem darauf an, die Werktätigen auf dem Lande maximal am Wiederaufbau der Ernährungsgrundlagen zu interessieren. Außerdem waren als Folge des Krieges auf längere Zeit Hemmnisse für die Weiterführung der Gutswirtschaft entstanden, weil die Industrie nicht so bald in die Lage zu setzen war, die erforderlichen Produktionsmittel ausreichend herzustellen.
Mit der Konzeption der entschädigungslosen Enteignung der Großgrundbesitzer und der Naziund Kriegsverbrecher im Dorf lenke die KPD den politischen Hauptstoß auf die Abrechnung mit dem Faschismus und die Brechung der Macht des deutschen Imperialismus. Das ermöglichte ein breites antiimperialistisches Bündnis verschiedener Klassen und Schichten. Die Konzeption der KPD trug vor allem den Interessen der Parzellenund Kleinbauern und der Landarbeiter Rechnung, entsprach aber auch den spezifischen Interessen der Mittelbauern. Auch sie waren an der Beseitigung des ökonomischen Drucks der Industriemonopole und der Gutsbetriebe, an der Demokratisierung des gesamten dörflichen Lebens und an der Besserung der sozialen und kulturellen Zustände interessiert. Die KPD wollte auch die Großbauern für den antiimperialistischen Kampf gewinnen. Nachdem diese vom Druck des imperialistischen Machtapparates bzw. der faschistischen Zwangswiirtschaft befreit waren, sollten ihnen Entwicklungsmöglichkeiten im Interesse der Steigerung der Agrarproduktion geboten werden. In ihrem Aufruf vom 11. Juni 1945 hatte die KPD mit Sicht auf die geforderte Bodenreform erklärt: „Es ist selbstverständlich, daß diese Maßnahmen in keiner Weise den Grundbesitz und die Wirtschaft der Großbauern berühren werden.“* Im ganzen akkordierten im Bodenreformkonzept der KPD Erfordernisse des Bündnisses von Arbeitern und Bauern mit solchen der antiimperialistischen Friedenssicherung und der Überwindung der Hungersnot. Entsprechend dem Ineinandergreifen des Kampfes um Demokratie und des Kampfes um Sozialismus zielte dieses Konzept zugleich darauf, im agraren Bereich die spätere Weiterführung des revolutionären Prozesses in sozialistische Bahnen, das heißt die sozialistische Lösung der Agrarfrage, zu erleichtern.
Mit ihrer Bodenreformdirektive ergriff die KPD die Initiative für jene Besatzungszone, in der bereits Bedingungen gegeben waren, durch sozialökonomische Umgestaltungen materielle Grundlagen für die antiimperialistische Friedenssicherung und eine demokratische Entwicklung zu schaffen. Sie tat dies zugleich mit der Absicht, den Antifaschisten der anderen drei Zonen ein Beispiel zu geben. Wie die nachfolgende Entwicklung in den Westzonen bewies, mußte für den Umbruch die Chance genutzt werden, daß sich 1945 der deutsche Imperialismus in der tiefsten Krise seiner Geschichte befand. Die Initiative der KPD stand im Einklang mit den Zielsetzungen des Potsdamer Abkommens, auch wenn dieses Dokument die Agrarreform unter den Maßnahmen zur Demokratisierung Deutschlands und zur Friedenssicherung nicht ausdrücklich erwähnte. Zwischen den alliierten Mächten bestand gegen Kriegsende weitgehende Übereinstimmung, daß die gesellschaftlichen Veränderungen im Interesse einer Friedenssicherung auch die Beseitigung der großen Güter einschließen muß, wie das später 1947 von der Moskauer Konferenz des Rates der Außenminister nochmals bekräftigt wurde. Die Forderung nach der „Vernichtung der Herrschaftspositionen der Eigentümer der Junkergüter“’, nach „Maßnahmen zur Zerschlagung der großen Landgüter in Deutschland“, um die „Macht der Junker zu zerstören“® und Land für Bauern bereitzustellen, war rin fester Bestandteil der deutschlandpolitischen Ziele der USA und Großbritanniens. Doch der Wille zur Verwirklichung dieser Zielsetzung war in den herrschenden Kreisen der Westalliierten unterschiedlich ausgeprägt, und es gab von Anfang an starke Kräfte, die dem entgegenwirkten. Dabei erwies sich das Argument, eine Bodenreform angesichts der zugespitzten Ernährungssituation hinauszuschieben, am wirkungsvollsten. Es wurde auch von bürgerlichen Kreisen und den Interessenvertretern des Großgrundbesitzes in den Westzonen benutzt, um eine Bodenreform — deren Notwendigkeit verbal allgemein anerkannt werden mußte in der Praxis zu torpedieren.
Die UdSSR billigte als Besatzungsmacht die Initiative der KPD für eine demokratische Bodenreform. Es war Ausdruck des Charakters ihrer Besatzungspolitik, daß sie die deutsche Arbeiterklasse und ihre Verbündeten im Kampf um eine konsequente Demokratisierung umfassend unterstützte.
Die Bodenreformverordnungen
Am 30. August 1945 beantragte die KPD im zentralen Blockausschuß, die Inangriffnahme der Bodenreform zu beraten. Gleichzeitig trug sie ihre Vorstellungen an die Präsidien der Landesund Provinzialverwaltungen als oberste deutsche Organe heran und unterbreitete sie Vorschläge für gesetzliche Bestimmungen.
Bei der Einleitung der Bodenreform konzentrierte die KPD ihre Kräfte auf die Provinz Sachsen als Gebiet mit ausgeprägt intensiver kapitalistischer Landwirtschaft, starker Arbeiterbewegung und einem fortgeschrittenen Landproletariat sowie auf MecklenburgVorpommern als größtes Agrargebiet der Ostzone. Schon Ende August hatte die Provinzialleitung der KPD den Präsidenten der Provinzialverwaltung Sachsen, Erhard Hübener (LDPD), gedrängt, mit der Vorbereitung der Bodenreform zu beginnen. Am 30. August erläuterte Bernard Koenen dem Provinzialblockausschuß den Standpunkt der KPD und schlug eine gemeinsame Erklärung vor. An den Beratungen in Halle nahm Rudolf Reutter teil. In Schwerin übergaben am gleichen Tag Franz Dahlem und Gustav Sobottka, Sekretär der Landesleitung der KPD, dem Präsidenten der Landesverwaltung Mecklenburg-Vorpommern, Wilhelm Höcker (SPD), einen Verordnungsentwurf. Diesem lag die Bodenreformdirektive der KPD zugrunde. Der Präsident der Landesverwaltung lud sofort Vertreter der Parteien, des FDGB und des Oberkirchenrates zu einer Beratung ein.
Für die Durchsetzung einer konsequent demokratischen Agrarumwälzung war eine Verständigung von KPD und SPD über die Grundprinzipien unabdingbar. Der Gründungsaufruf der SPD hatte vom Agrarexperten des Zentralausschusses Gustav Klimpel, einem führenden Mann des Kleinsiedlerwesens, beeinflußt — die Frage nach der Bodenreform nur unter dem Blickwinkel der Beschaffung von Grund und Boden für „umsiedlungsbereite Großstädter“ gestellt. Weder das Erfordernis der Entmachtung der Großagrarier noch das der Herstellung des Bündnisses von Arbeitern und Bauern waren berücksichtigt worden. Am 29. August 1945 nahm das zentrale Presseorgan der SPD „Das Volk“ erstmals zur Bodenreform Stellung. In seinem Leitartikel „Agrarreform — das Gebot der Stunde“ sprach es sich für die Entmachtung der Großagrarier als Stützen der Reaktion und des Militarismus aus und trat es für die Aufteilung des Bodens an Bauernwirtschaften ein. Bei der Besprechung im zentralen Blockausschuß am 30. August plädierte der Zentralausschuß der SPD ebenfalls für die Enteignung des Großgrundbesitzes, doch erklärte er sich für eine befristete gemeinschaftliche Bewirtschaftung der Güter. Eine Waldaufteilung wurde abgelehnt. Eine ähnliche Haltung bezogen die Landesund Provinzialvorstände. In der Stellung zur Bodenreform traten in der SPD eine revolutionär-proletarische und eine opportunistisch-reformistische Linie hervor, die sich nun immer deutlicher voneinander schieden.
Nach intensiven Gesprächen, bei denen die Vertreter der KPD insbesondere auf den offenkundigen Wunsch vieler Landarbeiter und Kleinbauern nach eigenem Land verwiesen, wurde Übereinstimmung erreicht. An 4.September 1945 unterbreiteten KPD und SPD im Sonderausschuß für Bodenreform, den der zentrale Blockausschuß gebildet hatte, ein gemeinsames Konzept, das im wesentlichen auf dem der KPD fußte. Beide Parteien vereinbarten, zusammen Funktionärkonferenzen in allen Orten zum Thema „Die Bodenreform, die dringendste Aufgabe der demokratischen Kräfte“ durchzuführen. Bei der praktischen Durchführung der Bodenreform entwickelte sich dann ein Zusammenwirken von Kommunisten und Sozialdemokraten.
Heftige Auseinandersetzungen ergaben sich in den Blockausschüssen. CDU und LDPD hatten sich in den Gründungsaufrufen nur sehr unbestimmt zur Agrarfrage geäußert. Unter dem Eindruck der anwachsenden Massenbewegung nahmen in den letzten Augusttagen ihre Zentralorgane „Neue Zeit“ und „Der Morgen“ befürwortend zur Bodenreform Stellung. Die Position der Führungsgremien war damit allerdings noch nicht festgelegt. In den Blockberatungen stimmten die Repräsentanten beider Parteien der Enteignung notorischer Kriegsund Naziverbrecher im Dorf zu, sperrten sich aber gegen generelle Maßnahmen. Sie sahen im übrigen die Bodenreform im Rahmen einer bürgerlichen Siedlungspolitik, wie sie seinerzeit das Reichssiedlungsgesetz von 1919 programmiert hatte: büromäßige Bearbeitung statt Durchführung der Agrarumwälzung durch die werktätige Landbevölkerung, Zwischenbewirtschaftung der Güter durch Siedlergemeinschaften statt sofortiger Landübergabe, Zahlung von Entschädigungen statt entschädigungsloser Enteignung, Belassung von Restbetrieben bis zu 100 Hektar statt restloser Enteignung und Aufsiedlung der Güter.
In der Provinz Sachsen fiel am frühesten eine Entscheidung zur Bodenreform. Nach langwierigen Verhandlungen einigten sich die vier Parteien am 1. September im Provinzialblockausschuß auf eine gemeinsame Erklärung. Die Einigung kam vor allem deshalb zustande, weil CDU und LDPD angesichts der Massenbewegung auf dem Lande um ihren politischen Einfluß fürchten mußten. Zum positiven Ausgang trug aber auch die Beharrlichkeit der Repräsentanten der KPD bei, die ein Ausweichen vor den politischen Grundfragen der antifaschistischen Friedensund Demokratiesicherung nicht gestatteten. Prinzipielles Herangehen mit taktischer Elastizität verbindend, beharte die KPD nicht darauf, bereits in der Entschließung die Größe der Neubauernstellen, den Zeitpunkt der Bodenreform sowie die Art ihrer Durchführung festzulegen und die Entschädigungsfrage zu Unterzeichnung der Verordnung über die demokratische Bodenreform durch das Präsidium der Landesverwaltung MecklenburgVorpommern, 5. September 1945. Sitzend: Wilhelm Höcker (SPD); v. I.n. r.: Gottfried Grünberg (KPD), Otto Möller, Hans Warnke (KPD)
entscheiden. Selbstverständlich war es von erheblichem Gewicht, daß die Organe der sowjetischen Militärverwaltung die Inangriffnahme der Bodenreform befürworteten. Nach dem erfolgreichen Abschluß der Blockberatungen überreichte die Provinzialleitung der KPD dem Präsidenten der Provinzialverwaltung am 2. September den Entwurf der Bodenreformverordnung. Diese wurde nach intensiven Verhandlungen im Präsidium der Provinzialverwaltung am 3. September angenommen. Präsident Hübener stimmte bei der Abstimmung im Präsidium der Provinzialverwaltung zwar gegen den Gesetzentwurf, unterwarf sich aber der auch von seinem Parteifreund Willi Lohmann mitgetragenen Mehrheitsentscheidung und unterzeichnete die Verordnung. Noch im letzten Moment hatte der aus Berlin herbeigeeilte 2. Vorsitzende der CDU, Walther Schreiber, versucht, die Annahme des Gesetzes zu verhindern. Großen Anteil am Zustandekommen der gesetzlichen Regelung hatte Robert Siewert (KPD) als 1. Vizepräsident.
Vom Blockaufruf und von der Verordnung für die Provinz Sachsen ging eine Signalund Beispielwirkung aus. Als erstes Land folgte Mecklenburg-Vorpommern mit ähnlichen Dokumenten am 3. bzw. 5. September. Ebenfalls auf dem KPD-Entwurf zurückgehend und diesen nur in untergeordneten Details und Formulierungen variierend, kamen Verordnungen wenige Tage später auch in den übrigen Ländern und Provinzen zustande: in Mark Brandenburg am 6. September, in Sachsen und Thüringen am 10. September.
Die erste Beratung im Sonderausschuß für Bodenreform des zentralen Blockausschusses fand auf der Basis des gemeinsamen Konzepts von KPD und SPD statt. Diese Beratung am 4. September stand faktisch im Zeichen des in der Provinz Sachsen unverrückbar vollzogenen und sich in Mecklenburg-Vorpommern und auch in Mark Brandenburg ankündigenden Schrittes. Die Führer der bürgerlich-demokratischen Parteien versuchten Zeit zu gewinnen, sahen sich jedoch mehr und mehr durch die demokratische Massenbewegung in die Defensive gedrängt. Zunehmend mußten sie taktieren. Schließlich schien ihnen eine formale Billigung der Bodenreform ratsamer als die offene Ablehnung. Erstens spekulierten sie auf einen Einspruch der westlichen Besatzungsmächte im Alliierten Kontrollrat. Zweitens hofften sie, durch die Zustimmung ihren Einfluß in Stadt und Land wahren zu können und später dann Möglichkeiten zu finden, um die revolutionäre Entwicklung in der Ostzone zu bremsen.
In beiden Parteien waren Mitglieder und Funktionäre immer nachdrücklicher für eine demokratische Bodenreform eingetreten. Im Landesverband Mecklenburg-Vorpommern der CDU nahmen nicht nur die Ortsgruppenund Kreisvorstände, sondern auch die meisten Mitglieder des Landesvorstandes eine positive Haltung zur Bodenreform ein. Schon am 6. September 1945 forderte der Landesvorstand in einem Rundschreiben die Ortsgruppen auf, Vertreter für die Bodenreformkommissionen zu benennen. Darüber hinaus nahm er in einem gedruckten Flugblatt Stellung. Mit dem ausdrücklichen Hinweis auf die Not der Umsiedler erklärte der CDU-Landesvorstand unter anderem: „Die eiserne Notwendigkeit fordert Umwandlung des Großgrundbesitzes in Bauernland. Die jetzt von der Landesverwaltung verkündete Verordnung über die Bodenreform im Lande Mecklenburg-Vorpommern wird es uns ermöglichen, diesen Großbesitz planmäBig aufzuteilen. Wir halten es für unsere selbstverständliche Pflicht, bei der Ausführung des großen Werkes alle Kräfte einzusetzen. Die alte Sehnsucht unserer Väter Junkerland in Bauernhand muß Wirklichkeit werden. Die Bodenreform ist ein Werk von geschichtlicher Größe.“
Für die christlichen Menschen auf dem Lande hatte auch Gewicht, daß vier Pastoren in einer von der Schweriner „Volkszeitung“ am 7. September veröffentlichten Stellungnahme die Legitimität von Enteignungen im Sinne der christlichen Gebote bekräftigten. Die der SPD angehörenden Geistlichen erklärten, damit in der Traditionslinie des Bundes religiöser Sozialisten Deutschlands der Jahre vor 1933 stehend: „Es verstößt nicht gegen das Gebot ‚Du sollst nicht stehlen‘, wenn die Bauern und Landarbeiter, die durch den Hitlerkrieg so schwer betroffen wurden viele haben ihr alles verloren — eine solche Aufteilung und Aufsiedlung von der Landesverwaltung fordern, sondern es ist geradezu eine Forderung dieses Gebotes, das ja nach Luthers Erklärung von uns fordert, daß wir darin Gott fürchten und lieben sollen, ‚daß wir unserem Nächsten sein Gut und Nahrung bessern und behüten helfen‘. Dieses 7. Gebot, das, wie auch alle anderen Gebote, nur von der Liebe zu Gott und dem Nächsten richtig ausgelegt werden kann, wie uns Christus gelehrt hat, will nicht den tatsächlichen, wie auch immer zuständigen Besitz eines Menschen schützen, als ob es ein Paragraph aus dem Strafgesetzbuch wäre, sondern das Anrecht des Nächsten auf das für seinen Lebensunterhalt Notwendige.“
Am 13. September nahm der Bodenreformausschuß des Blocks schließlich eine Erklärung an, die im wesentlichen dem von der KPD und der SPD unter-
breiteten Konzept entsprach. Wegen der dissentierenden Haltung von CDU und LDPD fehlte darin die Aussage, daß die Enteignung ohne Entschädigung zu erfolgen habe. Da aber die inzwischen erlassenen Verordnungen übereinstimmend eine entschädigungslose Enteignung vorsahen, blieb dies schließlich ohne Wirkung.
Mit dem SMAD-Befehl Nr. 110 vom 22. Oktober 1945, der den Landesund Provinzialverwaltungen das von ihnen faktisch von Anfang an wahrgenommene Gesetzgebungstecht bekräftigte und die bereits erlassenen Verordnungen bestätigte, wurde den rechten Kräften in CDU und LDPD der Boden für das formale Argument entzogen, die Bodenreform in der sowjetischen Beatzungszone bedürfe eines Rechtsaktes von seiten des Alliierten Kontrollrates. Die Bodenreformverordnungen waren das erste Gesetzeswerk der neuen, antifaschistisch-demokratischen Verwaltungsorgane, das auf die Zerschlagung der Machtgrundlagen des deutschen Imperialismus gerichtet war.
Die Annahme der Blockerklärungen und der Erlaß der Verordnungen zur Bodenreform bewirkten eine Schwächung der politischen Reaktion und auch der konservativen Kräfte in CDU und LDPD. Die Formierung der antifaschistischen Kräfte in beiden bürgerlich-demokratischen Parteien schritt voran. Vor allem aber gaben die Aufrufe und die gesetzgeberischen Schritte der Massenbewegung in den Dörfern starken Auftrieb.
Junkerland in Bauernhand
Die KPD bestrebt, die Agrarumwälzung zur Sache des ganzen Volkes zu machen rief am 8. September 1945 die Werktätigen in Stadt und Land zum aktiven Handeln auf: „So demokratisch die Bodenreform in ihrem ganzen Wesen und von Grund aus ist, so demokratisch soll sie auch zur Durchführung gelangen.“? Mit diesem Aufruf unterbreiteten die Kommunisten zugleich ein konkretes Handlungsprogramm: sofortige Wahl von Bodenreformkommissionen in den Landgemeinden; Beratung und Beschlußfassung über die Enteignung und die Aufteilung der Güter in Versammlungen der Landarbeiter, Kleinbauern und Umsiedler; vorläufige Verwaltung der Güter durch gewählte Treuhänder und Schutz des toten und des lebenden Inventars; Übergabe des Bodens und Aushändigung der Besitzurkunden in einem feierlichen Akt unter Teilnahme der gesamten Dorfbevölkerung. Gleichzeitig war eine ordnungsgemäße Herbstbestellung sicherzustellen.
Die politisch-ideologische Arbeit der KPD auf dem Lande konzentrierte sich bis Ende September 1945 darauf, die Landaufteilung vorzubereiten. In Dorfversammlungen wurden aus den Reihen der Landbedürftigen Bodenreformkommissionen gewählt. Auf Kreisund Landesebene nahmen entsprechende Kommissionen ihre Tätigkeit auf. Die Gemeindekommissionen stellten Listen der landarmen und landlosen Bauern zusammen und nahmen Anträge auf Landzuteilung entgegen. Sie arbeiteten die Aufteilungspläne aus und verwirklichten sie unter Einbeziehung Zehntausender von Landbedürftigen. Diese Kommissionen waren faktisch revolutionär-demokratische Machtorgane. Ihnen gehörten 52292 Menschen an vorwiegend ortsansässige Landarbeiter (19700) und Kleinbauern (18 556). In Stadtnähe wirkten häufig Industriearbeiter mit. Auch 6352 Umsiedler waren in die Kommissionen gewählt worden. Den Vorsitz hatte vielfach der Bürgermeister. Parteipolitisch setzten sich die Kommissionen aus 12475 Kommunisten, 9164 Sozialdemokraten und 974 Mitgliedern von CDU und LDPD zusammen; etwa 30000 Kommissionsmitglieder waren parteilos. Aus den Reihen der Kommissionsmitglieder ging in der Folgezeit eine große Zahl bäuerlicher Funktionäre hervor. Die Durchführung der Bodenreform war eine Schule der Demokratie.
Die Repräsentanz der Parteien in den Kommissionen war Spiegelbild ihrer Haltung zur Bodenreform und drückte ziemlich adäquat den Grad ihrer organisatorischen Verankerung auf dem Lande aus. Die hohe Zahl von KPDund SPD-Mitgliedern dokumentierte die Aktionseinheit im Dorf. In vielen Städten schickten zudem beide Arbeiterparteien in wechselseitiger Abstimmung Parteiaktivisten für mehrere Wochen in die Dörfer. Vielfach waren das im Klassenkampf erfahrene, durch persönliche Lebensumstände eng mit dem Dorf verbundenene Industriearbeiter. Sie unterstützten die Landarbeiter und Kleinbauern mit ihren politischen Erfahrungen. Die Oelsnitzer Bergarbeiter beispielsweise halfen bei der Aufteilung der Güter des Schönburgschen Adelsgeschlechts. Durch das tatkräftige Handeln vieler Mitglieder von KPD und SPD wurde das überkommene Mißtrauen der Landbevölkerung gegen die revolutionäre Arbeiterbewegung weiter abgebaut. Kommunisten und Sozialdemokraten überzeugten sich ihrerseits davon, daß die werktätige Landbevölkerung und insbesondere auch die Bauern in ihrer Mehrheit für den gesellschaftlichen Fortschritt gewonnen werden können. Nach und nach trennten sie sich von reformistischen und sektiererischen Auffassungen in der Agrarfrage.
Die Agrarumwälzung begann mit der Beschlagnahme des Großgrundbesitzes und seiner Überführung in einen staatlichen Bodenfonds. Enteignet wurden unter anderem die Ländereien des Fürsten von Stollberg-Wernigerorde im Umfang von rund 22.000 Hektar, die Besitzungen solcher bekannter brandenburgisch-preußischer und mecklenburgischer
Adelsgeschlechter, die traditionell die Ranglisten der Heere ausgefüllt hatten, wie derer von Bülow, von Maltzahn und von Schwerin, die Betriebe des kapitalistischen Saatzuchtunternehmens Dippe in Quedlinburg, die Güter von Industriellen und Bankiers wie Krupp von Bohlen und Halbach, Oetker und von Stauß. In der relativ kurzen Zeit von drei Wochen war die Beschlagnahme des Großgrundbesitzes abgeschlossen. Die Enteignung der Höfe der Kriegsverbrecher und Naziaktivisten mit weniger als 100 Hektar Land zog sich länger hin, weil in jedem einzelnen Fall Beweismaterial erforderlich war.
Anschaulich schildert Hermann Wesemann, der als Parteiaktivist für die Durchführung der Bodenreform in Torisdorf im Kreis Schönberg verantwortlich war, die Auseinandersetzung um die Enteignung: „Torisdorf war ein Gut von etwa 400 Hektar. Es gehörte dem Junker Axel Bunger, einem eingefleischten Militaristen, der sich von ‚seinen Leuten‘ mit ‚Herr Hauptmann‘ anreden ließ. Im Dorf gab es einige klassenbewußte Landarbeiter, die uns halfen, durch individuelle Aussprachen eine Dorfversammlung vorzubereiten. Sie fand, soweit ich mich erinnere, am 3. oder 4. Oktober, morgens um 7.00 Uhr statt. Wir hatten diese Zeit gewählt, weil sich zu dieser Stunde, wie es auf den Gütern so üblich war, die Landarbeiter zum ‚Befehlsempfang‘ vor dem Gutshaus versammelten. Es waren alle da, auch die Umsiedler. Einige Landarbeiter waren bemüht, den Eindruck zu erwecken, als wären sie nur zufällig auf die Versammlung gestoßen. Sie hielten Wassereimer oder Milchkannen in den Händen und standen etwas abseits. Das war sicher wegen des ‚Herrn Hauptmanns‘, vor dessen Augen sich ja alles abspielte. Als Referent sprach ich über die Notwendigkeit und Bedeutung der Bodenreform und erklärte das Gesetz über die Bodenreform. In der anschließenden Diskussion zeigten sich unterschiedliche Standpunkte und Unklarheiten der Versammelten. Zuerst traten die klassenbewußten Landarbeiter, wie Genosse Bruns oder der alte Kröger, auf. Sie forderten, daß mit der Gutsherrschaft Schluß gemacht werden und die sofortige Enteignung des Gutsherrn und seine Entfernung aus dem Dorf erfolgen sollte. Einige Landarbeiter drehten und wendeten sich noch mit Meinungen: ‚Wer weiß, wie das noch kommt, der Herr ist ja noch da, und er kann ja auch wiederkommen, dann geht es uns an den Kragen.‘ Andere meinten: ‚Wie sollen wir denn mit dem Land fertigwerden, wenn jeder für sich wirtschaftet? Wir haben ja nichts dazu.‘ Die Umsiedler waren durch die Bank für die Bodenreform, gab sie ihnen doch eine neue Existenz. So gingen eine Zeitlang die Meinungen hin und her, bis schließlich alle ihre Zustimmung zur Aufteilung des Gutes gaben. Es wurde eine Bodenkommission gebildet, an deren Spitze der Landarbeiter Genosse Bruns stand. Der Weg zu einem neuen Bauernleben ohne Ausbeutung wurde beschritten. Jetzt mußte aber der Gutsherr von dem Beschluß der Versammlung offiziell unterrichtet werden. Das war Aufgabe der gewählten Bodenkommission, aber alle hatten Hemmungen, als Sprecher aufzutreten. So übernahm ich diese Rolle. Als wir zu ihm gingen, kam er uns schon schreiend und schimpfend entgegen. Ich teilte ihm in knappen Worten den Beschluß mit und forderte ihn auf, der Bodenkommission unverzüglich die Schlüssel und alle Gutsunterlagen auszuhändigen, sich bis auf weiteres in seinem Zimmer aufzuhalten und sich jeder Einmischung zu enthalten. Er versuchte uns zunächst einzuschüchtern, erklärte die Versammlung nicht für kompetent, und mündliche Beschlüsse könne er überhaupt nicht anerkennen. Auf die Frage der Kompetenz antwortend, fragte ich ihn, ob er es auf eine Machtfrage ankommen lassen wolle? Dazu käme er zu spät, sie sei bereits zugunsten des werktätigen Volkes entschieden, er und seinesgleichen hätten hier für immer ausgespielt. Wir haben ihn in der Zeit bis zur Aufteilung des Gutes, die bald darauf erfolgte, sicher bewacht und verhindert, daß er irgend etwas verschicken konnte.“
Zu den ersten Gütern, die aufgeteilt wurden, zählten Pobles, Kreis Merseburg (20. September), Kreischau, Kreis Weißenfels (21. September), Förderstedt, Kreis Calbe (23. September), und Hohen Niendorf, Kreis Wismar (25. September). Vielfach leiteten feierliche Musteraufteilungen, an denen Repräsentanten der Landesbzw. Provinzialverwaltungen, Vertreter der Parteien und der Gewerkschaften sowie vielfach auch der Kirchen teilnahmen, die Aufteilungsaktion für einen ganzen Kreis ein. Anfang Oktober nahmen die Gutsaufteilungen Massencharakter an. Ein begeisternder Schwung erfaßte die Dorfbevölkerung. Täglich erschienen Meldungen über vollzogene Aufteilungen in den Zeitungen. Die Inbesitznahme des Bodens und der Empfang der Besitzurkunden — meist von Repräsentanten der Arbeiterparteien und der demokratischen Verwaltungen übergeben — wurden von der Dorfbevölkerung vielfach mit Umzügen, mit Musik und Tanz gefeiert. Trotz der allgemeinen Not und der schwierigen wirtschaftlichen Ausgangslage gab es wenige Monate nach Kriegsende in den Dörfern Zeichen der Freude und der Zuversicht. Hans Warnke, der als Vorsitzender der Landesbodenkommission in Mecklenburg-Vorpommern an zahlreichen Versammlungen teilnahm, berichtete: „Nachdem der Bauer oder die Bäuerin das Landlos gezogen hatte, besichtigte die ganze Familie das neue Eigentum. Hierbei gab es mitunter ergreifende Szenen, Freudentränen flossen, man umarmte und küßte sich. Landarbeiter, die schon Jahrzehnte den Acker bearbeitet hatten, die ihn genau kannten, schritten nun mit ihrer ganzen Familie das Ackerstück von Grenzpfahl zu Grenzpfahl genau ab. Man konnte beobachten, daß sich die ganze Familie mitsamt dem kleinsten Baby mitten auf den Acker setzte. Immer wieder wurde eine Handvoll Boden genommen, um die Güte zu prüfen. Es war wirklich so: Für Zehntausende war ein jahrhundertealter Traum Wirklichkeit geworden.“
Eine Umsiedlerin zieht ihr Los bei der Vergabe des aufzuteilenden Bodens, Herbst 1945
Die gesellschaftliche Bewegung, die durch die Bodenreform in Gang gekommen war, erfaßte auch die Kirchen. Die Synode der Evangelischen Kirche in Berlin-Brandenburg und der Oberkirchenrat der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Mecklenburgs nahmen in der Öffentlichkeit zustimmend Stellung. Viele — Pastoren — eng mit dem Leben in ihren Dörfern verbunden verstanden die Berechtigung und die historische Bedeutung der Bodenreform und nahmen aktiv daran teil. Die Schweriner „Volkszeitung“ berichtete, daß die Aufteilung der 64 Güter im Kreis Malchin „überall in Anwesenheit von Vertretern der Kirche erfolgte“.!? Zeitungsmeldungen über Aufteilungsakte in der ersten Oktoberhälfte gaben oftmals die bewegenden Worte von Pastoren bei der Übergabe des Landes an die Neubauern wieder. Pastor Sibrand Siegert, der amtierende Landessuperintendent des Kirchenkreises Güstrow, sagte in Bredentin, Kreis Güstrow: „Die Kirche … sieht in der Aufteilung des Grund und Bodens eine geschichtliche Notwendigkeit … Der Boden soll denen zurückgegeben werden, denen er eigentlich gehört.“ Pastor Heinz Bork aus Zettemin, Kreis Malchin, erklärte in Duckow unter anderem: „Hart sind die Zeiten, in denen wir leben, und hart die Anforderungen, die die heutige Zeit von uns verlangt. Aber mit Gottes Hilfe werden wir alle Schwierigkeiten überwinden.“ Pastor Friedrich Caspari aus Klabe sagte bei der Durchführung der Bodenreform in Klein Roge, Kreis Güstrow: „Am eigenen Leibe habe ich erfahren müssen, was der Nationalsozialismus für das deutsche Volk bedeutet hat. Selbst ein Bauernsohn, verstehe ich die Freude, endlich Herr auf eigener Scholle zu sein.“ Ähnlich erklärte Pastor Hans-Joachim Mützke bei der Aufteilung in Quadenschönfeld, Kreis Neustrelitz, daß er es als Sohn eines Tagelöhners ermessen könne, was dieser Tag im Leben des mecklenburgischen Landarbeiters bedeute.‘?
Ende Oktober waren die meisten Güter aufgeteilt, die für den Bodenreformfonds zur Verfügung standen. Festliche Veranstaltungen auf Kreisund auch auf Landesebene schlossen die Landaufteilung ab.
Unter Führung der Arbeiterklasse wurde die demokratische Bodenreform zu einer bis dahin beispiellosen erfolgreichen revolutionären Massenaktion, zum ersten Höhepunkt des revolutionären Umwälzungsprozesses.
Die Bodenreform vollzog sich in einer scharfen Klassenauseinandersetzung. Der werktätigen Landbevölkerung, die zunächst nur geringe politische Erfahrungen besaß, stand ein erfahrener, einflußreicher Gegner gegenüber. Allerdings schränkten die militärische Besatzung und die Wahrnehmung der obersten Gewalt durch eine sozialistische Besatzungsmacht die Möglichkeiten konterrevolutionärer Aktionen wesentlich ein. Gewaltakte wie Überfälle auf Bodenreformbeauftragte blieben die Ausnahme. Die Hauptformen des Klassenwiderstandes waren Sabotagehandlungen und Einschüchterungsversuche. In den bis Sommer 1945 westalliiert besetzten Gebieten drohte man, die Amerikaner und Engländer würden wiederkehren und dann würde mit denen abgerechnet, die es gewagt hätten, den Großgrundbesitz anzutasten. Die Enteignungen wurden als Verstoß gegen die christlichen Gebote und als erster Schritt auf einem Wege denunziert, der zur Enteignung aller Bauern führen solle. Vielfach schreckte man Bewerber um Boden mit dem Argument, daß die Neubauernparzellen unrentabel und die Anstrengungen zum Aufbau eines eigenen Hofes angesichts der immensen wirtschaftlichen Schwierigkeiten kaum erfolgversprechend seien.
EIGENTUMSBEURKUNDUNG
Der politische Druck nahm Ende September solche Stärke an, daß vielerorts die Vorbereitungsarbeiten ins Stocken zu kommen drohten. Die Landesverwaltung Sachsen hatte schon am 17. September angeordnet, alle jene mit schweren Strafen zu belegen, die sich der Bodenreform widersetzten oder sie sabotierten. Ähnliche Maßnahmen hatten auch die anderen Länder und
Provinzen ergriffen. Aber das reichte nicht aus. Die
antifaschistisch-demokratischen Verwaltungsorgane sahen sich genötigt, Maßnahmen zu ergreifen, die die Bodenreformverordnungen nicht vorgesehen hatten. Als erste ordnete die Provinzialverwaltung Sachsen an, die enteigneten Familien aus den Dörfern und schließlich auch aus den Heimatkreisen auszuweisen. Gleiches geschah in den anderen Ländern und Provinzen. Die Aktion lag in der Hand der Volkspolizei, die damit bei der Bodenreform eine Bewährungsprobe bestand.
Die Härte der Klassenauseinandersetzungen zwang auch dazu, die Vergabe von Resthöfen aus dem Bestand enteigneter Güter rückgängig zu machen. Solche Resthöfe waren enteigneten Besitzern in Anerkennung ihres Antifaschismus insbesondere ihrer Haltung im Zusammenhang mit dem Umsturzversuch vom 20.Juli 1944 zugesprochen worden. Die Betroffenen durften allerdings im Nachbarort bleiben und eine Neubauernstelle erwerben.
Die Ausweisung der Gutsbesitzerfamilien verminderte nicht nur deren Möglichkeiten, die Dorfbevölkerung negativ zu beeinflussen. Vor allem hatte diese Aktion eine moralische Wirkung. Sie wurde von der werktätigen Landbevölkerung überall als Zeichen verstanden, daß die Herrenzeit endgültig zu Ende gegangen war. Die Aktivität der Werktätigen brach sich nun ungehemmter Bahn. Der Bürgermeister von Zöberitz im Saalkreis berichtete am 2. November 1945: „Man stürmte mir förmlich die Bude ein. Es meldeten sich noch mehrere Bewerber. Denn solange noch der Herr ‚Oberstleutnant Körner‘ hier anwesend war, traute sich dieser oder jener noch nicht so recht heran. Der sogenannte Respekt hemmte diese Leute; in dem Moment, als Herr Körner verschwand, kamen sie alle.“
Die Antifaschisten mußten die Landaufteilung gegen zahlreiche Sabotagehandlungen durchsetzen. Die politische Unerfahrenheit vieler Mitglieder der Bodenreformkommisssionen und die Unübersichtlichkeit der Verhältnisse infolge der immensen Bevölkerungsbewegung spielten dabei ebenso eine Rolle wie die Tatsache, daß in den neuen Verwaltungsorganen viele bürgerliche Fachleute wirkten, die sich apolitisch verhielten, und daß in den Vorständen von CDU und LDPD neben konservativen Politikern auch reaktionäre Kräfte Einfluß besaßen. Mancherorts waren Gegner der Bodenreform bzw. korrupte Elemente in die Bodenreformkommissionen gelangt. Man verheimlichte Gutsinventar und schaffte es beiseite. Aufsiedlungen wurden nur pro forma vollzogen, Güter als Saatzuchtgüter und Versuchseinrichtungen deklariert und so von der Aufteilung ausgenommen. Die SMA Thüringen sah sich Anfang November veranlaßt, den von der CDU benannten 2. Vizepräsidenten der Landesverwaltung, Max Kolter, aus dem Amte zu entfernen. Er hatte Bestrebungen unterstützt, möglichst viele Güter als „Musterbetriebe“ von der Aufteilung auszunehmen angeblich in Sorge um die Ernährung. Agrarexperten der Deutschen Verwaltung für Landund Forstwirtschaft versuchten bei der Landesverwaltung Mecklenburg-Vorpommern in Schwerin zu erreichen, daß 300000 Hektar Großflächen für die Kartoffelzüchtung und -vermehrung belassen werden. Das waren fast 60 Prozent der dann bis Februar 1946 aufgesiedelten Flächen und — gemessen am Endstand der Landaufteilung — immerhin noch 37 Prozent. Durch reaktionäre Kräfte im Lande publik gemacht, verunsicherten diese Bestrebungen viele Bodenreformkommissionen. Der Vizepräsident der Landesverwaltung und Vorsitzende der Landesbodenkommission Hans Warnke wies den Antrag zurück und sicherte den Fortgang der Aufteilungen.
Hatten die bestimmenden Kräfte in den zentralen Leitungen und auch in vielen regionalen Vorständen von CDU und LDPD Anfang September 1945 nicht vermocht, die Inangriffnahme der Bodenreform aufzuhalten, so richteten sie im Herbst ihr Tun darauf, die Agrarumwälzung zu verlangsamen und in andere Bahnen zu lenken. Die beiden Vorsitzenden der CDU, Andreas Hermes und Walther Schreiber, der LDPDVorsitzende Waldemar Koch und andere Politiker stemmten sich gegen die revolutionäre Aktion, weil durch sie Barrieren gegen die von ihnen erstrebte restaurative Neuordnung entstanden. Schreiber bemühte sich schon im September als Redner einer Versammlungskampagne in der Provinz Sachsen, die Bodenreform in Mißkredit zu bringen. Die Zonenleitung der CDU wies am 14. September die Kreisvorstände in einem Rundschreiben an, bei enteigneten Gutsbesitzern, die keine notorischen Kriegsverbrecher oder Naziaktivisten waren, auf einer Entschädigung zu bestehen. Mit einer solchen Forderung trat Hermes noch im Oktober in der Öffentlichkeit auf. Zugleich orientierte er nachdrücklich auf eine genossenschaftliche Bewirtschaftung der Güter, um deren endgültige Zerschlagung zu verhindern. Die SMAD wurde in Memoranden um eine Korrektur der Bodenreform ersucht.
Tatsächlich hatte die demokratische Tatkraft der Antifaschisten in dem riesenhaften Umwälzungsprozeß nicht ausgereicht, Verbiegungen und Verzerrungen zu verhindern. Es war nicht ausgeblieben, daß sich einige an der Bodenreform bereicherten, indem sie sich mehrere Stellen aneigneten, die sie pro forma auf den Namen von Familienmitgliedern schreiben ließen, und daß es korrupten Elementen gelang, Freunden und Verwandten Inventar, Gebäude und Wald zuzuschanzen. In einigen Fällen waren auch Überspitzungen aufgetreten und Bauern enteignet worden, die sich keiner faschistischen Verbrechen schuldig gemacht hatten. Derartige Enteignungen wurden korrigiert. Politiker in CDU und LDPD nahmen solche Fehler und Mängel jedoch zum Vorwand, um eine generelle Revision der Bodenreform zu fordern.
Es war vor allem das Verdienst der KPD, des einheitlichen konsequenten Handelns ihrer Funktionäre und Mitglieder, daß die Agrarumwälzung allen Hemmnissen und Widerständen zum Trotz als aufsteigender Prozeß vorankam, daß sich der Demokratismus und das Schöpfertum des werktätigen Volkes Bahn brachen. Während des gesamten Herbstes betrachtete die KPD die Bodenreform als einen vorrangigen Schwerpunkt ihrer Arbeit. Sie analysierte kontinuierlich den revolutionären Prozeß und leitete rechtzeitig weiterführende Schritte ein. Eine große Hilfe für die revolutionäre Arbeiterbewegung war, daß in den Besatzungsorganen Offiziere tätig waren, die als Funktionäre der KPdSU die sowjetischen Erfahrungen bei der Gestaltung der Bündnisbeziehungen zwischen Arbeiterklasse und Bauern vermittelten. Diese Offiziere teilten Informationen aus örtlichen Kontrollen mit und berieten die Leitungen der Parteien und die Verwaltungsorgane bei den erforderlichen Leitungshandlungen. Manchmal griffen Kommandanten selbst ein, um eine strikte Durchsetzung der Bodenreformverordnungen zu sichern und die Neubauernhilfe zu organisieren.
Noch während die Aufteilung im Gange war, orientierte die KPD am 24. Oktober 1945 in einem Rundschreiben auf sofortige Hilfsmaßnahmen für die Neubauern. Am 22. November unterbreiteten KPD und SPD gemeinsam im zentralen Blockausschuß einen Aufruf zur Hilfe für die Neubauern. Sie stießen damit aber auf Widerstand. Sowohl Kaiser — nach Rücksprache mit Hermes als auch Koch lehnten die Unterzeichnung ab. In CDU und LDPD entzündete sich eine heftige Auseinandersetzung. Am 29. November legte Waldemar Koch den Parteivorsitz nieder, und Wilhelm Külz trat an die Spitze der LDPD. In seiner Person verkörperten sich hervorragende Traditionen der bürgerlich-demokratischen Bewegung. Jurist von seiner Ausbildung her, war er 1922 am Zustandekommen des Rapollovertrages beteiligt gewesen. 1933 von den Nazis aus dem Amt des Dresdner Oberbürgermeisters geworfen, hatte er sich nach der Befreiung als Mitbegründer der LDPD für ein Zusammengehen aller antifaschistisch-demokratischen Kräfte eingesetzt.
Am 7. Dezember unterzeichneten die Vertreter beider Arbeiterparteien und der LDPD den Aufruf „Helft den Neubauern“. Gemeinsam erklärten sie in dem am nächsten Tage veröffentlichten Dokument: „Alle Organisationen der antifaschistisch-demokratischen Parteien, die Gewerkschaften, die Betriebsbelegschaften und auch die werktätigen Altbauern sind verpflichtet, mit ganzer Kraft den Neubauern zu helfen, ihren Bauernhof einzurichten. Das ganze deutsche Volk hat diese Verpflichtung im Interesse der Sicherung seiner Ernährung und seines Lebens.“!° Der Aufruf enthielt ein weitgefächertes Programm der Neubauernhilfe.
Auch in der CDU entwickelte sich der Widerstand gegen die bauernfeindliche Politik der beiden Vorsitzenden. Ganze Ortsgruppen, Kreisund sogar Landesvorstände wandten sich von ihnen ab. Der Landesvorstand Mecklenburg-Vorpommern gab schon am 11. Dezember seine Zustimmung zu dem Aufruf „Helft den Neubauern“. Nachdem die SMAD Hermes und Schreiber das Vertrauen entzogen hatte, couragierten sich die Landesund Provinzialvorstände und erzwangen den Rücktritt der beiden Politiker. Die „Neue Zeit“ berichtete am 21. Dezember über diese Vorgänge in Berlin: „Schon die erste Versammlung der Provinzdelegierten … zeigte die Empörung der Teilnehmer und ihre Entschlossenheit, die Union auf den geraden Weg des ehrlichen antifaschistischen Kampfes und des unzweideutigen Christentums zurückzuführen. Dr. Lobedanz (Schwerin), der Vertreter des Landesverbandes Mecklenburg-Vorpommern, der als erster sprach, forderte bereits im Anfang seiner Darlegung die völlige Umbildung der Reichsparteileitung … ‚Die Führung der Union durch Dr. Hermes und Dr. Schreiber‘, erklärte Dr. Lobedanz, ‚ist für die Mitgliedschaft untragbar geworden. Die beiden Herren haben insbesondere durch ihre Einstellung zur Bodenreform … in der Anhängerschaft der Union stärkste Mißstimmung hervorgerufen. Es darf nicht sein‘, schloß Dr. Lobedanz, ‚daß diese Maßnahme, die zu den großartigsten und wichtigsten des demokratischen Deutschland gehört, durch die Führung der Union durchkreuzt wird.‘“16 Die Vertreter aus den anderen Ländern und Provinzen äußerten sich ähnlich. Auf einstimmigen Beschluß des Hauptausschusses schieden Hermes und Schreiber am 19. Dezember aus ihren Ämtern aus. An ihre Stelle traten Jakob Kaiser und Ernst Lemmer. Aus der christlichen Gewerkschaftsbewegung kommend, hatte Kaiser durch seinen Anteil am christlichen Widerstand und insbesondere am Umsturzversuch vom 20. Juli 1944 zunächst eine große Anhängerschaft in der CDU. Nicht zuletzt verschaffte ihm auch sein Rednertalent breite Resonanz. Unter Kaisers Leitung stellte der Hauptausschuß der CDU die offenen Angriffe gegen die Bodenreform ein.
Die Ablösung der bisherigen Parteiführer in der CDU und in der LDPD ließ neue Bedingungen für die Zusammenarbeit im antifaschistisch-demokratischen Block entstehen. Die Aktivität und das Gewicht der konsequent antiimperialistisch-demokratischen Kräfte erhöhten sich in beiden Parteien.
Die Frühjahrsaussaat 1946 und das Entstehen einer demokratischen Bauernorganisation
Am 7.Februar 1946 erließ der zentrale Blockausschuß einen Aufruf zur Frühjahrsbestellung und folgte damit einem Vorschlag der KPD. Die Werktätigen in Stadt und Land wurden zur Mithilfe aufgefordert, um trotz der immensen materiellen Schwierigkeiten die Felder planmäßig zu bestellen und die Anbauflächen zu erweitern. „Die Frühjahrsbestellung 1946 muß zur Sache unseres ganzen Volkes werden“, erklärten die Parteien.!7 Die nahende Frühjahrsaussaat verlangte, noch vorhandene Restflächen aufzuteilen. Das waren fast 500000 Hektar Land, rund 15 Prozent des Bodenreformfonds. Auch mußten Voraussetzungen geschaffen werden, damit die Neubauern ihre Stellen selbständig bewirtschaften konnten.
Kartoffelhackerinnen. Gemälde von Paul Kuhfuss, 1947. Staatliche Museen zu Berlin, Nationalgalerie/DDR
In den meisten Neubauerndörfern der agrarischen Gebiete hatten die Neubauern nicht sogleich mit der eigenen Wirtschaftsführung begonnen. Vielmehr war die gutsartige Bewirtschaftung ihrer Flächen im Rahmen sogenannter neubäuerlicher Gemeinschaften fortgeführt worden. Diese Erscheinung hatte komplexe Ursachen und war von widersprüchlicher Natur. Vielfach war die Herbstbestellung noch vor der Bodenaufteilung erfolgt, also im Rahmen der großen Gutsschläge. Ein selbständiges Wirtschaften wurde durch den Mangel an Zugkräften und einfachen Geräten sowie wegen des Fehlens von Wirtschaftsgebäuden sehr erschwert. Vor allem ehemalige Landarbeiter sahen im gemeinsamen Wirtschaften den besten Weg, um fürs erste über die Schwierigkeiten hinwegzukommen. Ähnlich dachten viele Bürgermeister, und auch bürgerliche Fachkräfte in den Verwaltungen drängten unter Berufung auf Erfahrungen der früheren Siedlungsgesellschaften auf eine Zwischenbewirtschaftung. Oftmals kam mangelndes Selbstvertrauen der Neubauern hinzu, bei ehemaligen Landarbeitern auch die Furcht vor einer Rückkehr des ehemaligen Gutsbesitzers. Mancherorts gelang es deshalb dem Klüngel der enteigneten Besitzer, die Bodenreform zu sabotieren und den Boden nur zum Schein aufzuteilen, also alles beim alten zu belassen. Auch spielte in einigen Dörfern eine Rolle, daß Funktionäre der Arbeiterparteien nicht mit aller Konsequenz auf den sofortigen Übergang zur Parzellenwirtschaft drängten, weil sie sich noch nicht gänzlich von der Vorstellung gelöst hatten, genossenschaftliche Großbetriebe zu organisieren.
In einer Zeit sich zuspitzender Klassenauseinandersetzungen, in der die Bodenreformgegner einen enormen politisch-ideologischen Druck auf die Bodenbewerber und Neubauern ausübten und die in die Westzonen geflüchteten Gutsbesitzer die Bodenreformkommissionen mit Eingaben überschütteten, entstand durch die neubäuerliche Gemeinwirtschaft eine Gefahr für die Bodenreform insgesamt — ganz abgesehen davon, daß sie mehr und mehr die Initiative der Neubauern hemmte und deren Tatkraft lähmte. Als umfassende Überprüfungen nicht zuletzt von seiten der SMAD mit Nachdruck betrieben — Ende 1945 und Anfang 1946 diese Situation signalisierten, lenkte die KPD die Kraft aller Antifaschisten auf den strikten Kampf gegen alle gemeinwirtschaftlichen Erscheinungen und Bestrebungen. Das war zu diesem Zeitpunkt um so dringlicher geboten, als die neue Führung der CDU unter Jakob Kaiser gerade mit solchen Konzepten — unter dem Deckmantel der Neubauernhilfe und unter Berufung auf angeblich bewährte Erfahrungen der Bodenreform entgegenzuwirken suchte. Gerade deshalb war es ein bemerkenswerter Erfolg der revolutionären Kräfte, daß im Blockaufruf zur Frühjahrsbestellung vom 7. Februar 1946 im Falle der Neubauerndörfer die „selbständige Bewirtschaftung des Bodens durch die Neubauern“!? an die Spitze gerückt und mit Orientierungen zur umfassenden Neubauernhilfe verbunden wurde.
Mitte Februar bzw. in der zweiten Februarhälfte führten die Verwaltungsorgane gemeinsam mit den antifaschistisch-demokratischen Parteien in allen Dörfern „Tage der Bereitschaft“ — damals oft „Bauernschautage“ genannt — durch. Diese neue Form operativer Kontrolle und Hilfe beruhte auf sowjetischen Erfahrungen. Seitens der beiden Arbeiterparteien waren die inzwischen gebildeten gemeinsamen Organisationsausschüsse für die Einheitspartei Träger der Aktion. Tausende von Funktionären fuhren in die Dörfer, um mit den Bauern den Stand der Vorbereitungen für die Frühjahrsbestellung zu prüfen und Hilfe in die Wege zu leiten, wo es not tat. In den Neubauerndörfern konzentrierten sich die Anstrengungen darauf, die selbständige Wirtchaftsführung bzw., wo die materiellen Voraussetzungen besonders ungünstig waren, ein gruppenweises Zusammenarbeiten von Neubauern zu organisieren. Auch wurden jetzt die noch nicht verteilten Flächen aufgeteilt.
Teilweise schon Ende 1945, verstärkt aber nach dem Blockaufruf zur Frühjahrsbestellung erhielten viele Neubauern materielle Unterstützung. Besonders unter den Gewerkschaftern fand der Aufruf ein Echo. So produzierten beispielsweise Leuna-Arbeiter nach Erfüllung der Produktionsauflagen zusätzlich Stickstoffdünger für das Dorf. Betriebsbelegschaften übernahmen Patenschaften für Neubauerndörfer, fuhren an Wochenenden zum Arbeitseinsatz aufs Land und reparierten landwirtschaftliche Maschinen und Geräte. Es gab Initiativen zur Neuproduktion der von den Neubauern dringend benötigten Grundgeräte. Auch wurden in Dorfschmieden und kleinen Werkstätten einfache landwirtschaftliche Geräte hergestellt und Maschinen instand gesetzt. Im Vergleich zum Bedarf blieb die Produktion freilich außerordentlich gering. Die meisten Zentren des Landmaschinenbaus lagen in den Westzonen. Die vorhandenen Kapazitäten in der Ostzone konnten wegen des Rohstoffmangels nur teilweise ausgelastet werden. Man mußte sich also vor allem mit dem Vorhandenen behelfen. Die Maschinen der früheren Gutsbetriebe wurden von den Neubauern gemeinsam genutzt. Die Verwaltungsorgane organisierten die Zugkrafthilfe der Altbauern für die Neubauern über die Gemeindeund selbst über die Kreisgrenzen hinweg. So halfen beispielsweise Bauern des Kreises Bitterfeld nach Beendigung der eigenen Arbeiten mit 600 Pferden den Neubauern der Kreise Jerichow I und II. Im Kreis Jerichow II entwickelte die Jugend eine hervorragende Initiative. Als Echo auf die Kreiskonferenz der Jugendausschüsse zur Vorbereitung der Gründung der FDJ bildeten Jugendliche eine Jugendtraktoristenbrigade und nahmen noch im März 1946 — inzwischen Mitglieder der demokratischen Jugendorganisation — die Arbeit auf den Feldern auf. Kommandos der Roten Armee übergaben aus dem Bestand der von ihnen bewirtschafteten Güter Pferde und Zugmaschinen. Zeitweilig wurden auch Pferde aus Armeebeständen konzentriert eingesetzt. Aus Fonds der sowjetischen Militärverwaltung erhielten Bauern in Notlage leihweise Saatund Pflanzgut, das nach der Ernte mit geringem Aufschlag zurückzuerstatten war. Insgesamt wurden über 90000 Tonnen Getreide und 280000 Tonnen Kartoffeln bereitgestellt. Ein gezielter Viehaufkauf im Land und in der Provinz Sachsen sowie in Thüringen, den die SMAD im November 1945 gestattet hatte, ermöglichte einer Reihe von Neubauern in Mark Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern, ein Stück Großvieh zu erwerben und mit dem Aufbau der eigenen Wirtschaft zu beginnen. Auf der Basis des SMAD-Befehls Nr. 62 vom 25. Februar 1946 konnten Neubauern einen Kredit in Höhe von 3000 Mark in Anspruch nehmen. Neubauernfamilien, die über keinerlei Produkte aus der Ernte 1945 verfügten, erhielten Lebensmittelkarten. Es wurde begonnen, die bäuerliche Wirtschaftsberatung zu organisieren. Die großen Anstrengungen der Bauern und Landarbeiter und die vielfältige Hilfe sicherten, daß die erste Frühjahrsbestellung nach dem Krieg auf der Grundlage tiefgreifend veränderter Agrarverhältnisse erfolgreich bewältigt werden konnte. Die Anbaufläche wurde gegenüber 1945 um 12 Prozent erweitert und vor allem der Anbau von Kartoffeln, Zuckerrüben und Ölfrüchten ausgedehnt. Nicht zuletzt auf Grund strikter Forderungen der örtlichen Kommandanturen der sowjetischen Militärverwaltung konnten diese progressiven Veränderungen durchgesetzt werden. Die neuen gesellschaftlichen Verhältnisse im Dorf stabilisierten sich. Viele Neubauern nahmen nun die eigene Wirtschaftsführung auf, wobei sie sich auf die gegenseitige Hilfe stützten. Die Frühjahrsbestellung „konnte nur deshalb hundertprozentig beendet werden, weil die Neubauern sich restlos einsetzten und das persönliche Interesse an ihrem Eigentum alle Schwierigkeiten überstieg“, betonte der Vizepräsident der Landesverwaltung von MecklenburgVorpommern, Otto Möller, auf einer Beratung bei der Deutschen Verwaltung für Landund Forstwirtschaft im Juni 1946.“
Im Februar und März 1946 entstand die Vereinigung der gegenseitigen Bauernhilfe (VdgB). Auf der gesetzlichen Grundlage der Bodenreformverordnungen waren im Herbst 1945 Ausschüsse der gegenseitigen Bauernhilfe gebildet worden, die die Traktoren und großen Landmaschinen sowie die handwerklichen Betriebe und Werkstätten der enteigneten Gutsbesitzer in ihre Regie nahmen und die gegenseitige Hilfe organisierten. Auch in Altbauerndörfern waren solche Ausschüsse entstanden. Im Februar 1946 fanden Vorstandswahlen für die Ausschüsse statt, die es nunmehr in zwei Dritteln aller Landgemeinden gab. Durch die Wahl von Kreisund Landesausschüssen erfolgte die Konstituierung der neuen Organisation bis zur Landesebene hinauf. Den Ausschüssen gehörten 43076 Mitglieder an, darunter 15002 Mitglieder von KPD und SPD sowie 690 Mitglieder von CDU und LDPD. Mit der Bildung des Zentralen Bauernsekretariats im Mai 1946 fand der organisatorische Aufbau der VdgB einen vorläufigen Abschluß.
Die VdgB sollte Beziehungen der gegenseitigen Hilfe und Solidarität unter den Bauern fördern. Ein Eintritt war allen Bauern, auch Großbauern, möglich. Über die wirtschaftliche Zusammenarbeit und Hilfe sollte die politische Aktivität der Bauern entwickelt werden. Eine solche Verflechtung von ökonomischen und politischen Aufgaben trug der Mentalität kleiner privater Warenproduzenten Rechnung.
Der Aufbau einer demokratischen Bauernorganisation konnte nur aus neuer Wurzel erfolgen. Unter den Bedingungen des staatsmonopolistischen Herrschaftssystems und der Vorherrschaft von Gutsbesitzern und Großbauern im Dorf hatten sich keine stabilen Organisationsformen einer progressiven Bauernbewegung entwickeln können. Die Tätigkeit der ländlichen Kredit-, Warenbezugs-, Warenabsatzund Produktivgenossenschaften war vom kapitalistischen Profitstreben geprägt gewesen. 1933 in das faschistische Reichsnährstandssystem eingegliedert und politisch gleichgeschaltet, hatten sie der staatsmonopolistischen Regulierung der Produktion und des Absatzes von Agrarerzeugnissen gedient.
Ausstellung der Raiffeisengenossenschaft in Schwerin, 1947
Mit dem Befehl Nr. 146 der SMAD vom 20. November 1945 wurde den Genossenschaften die Wiederaufnahme ihrer Tätigkeit gestattet. Die bedeutenden materiellen und finanziellen Mittel der Genossenschaften sollten für die Förderung des Wiederaufbaus der landwirtschaftlichen Produktionsgrundlagen genutzt werden. Nach der Entfernung ehemaliger NSDAPMitglieder aus Leitungsfunktionen wurden die Vorstände auf der Basis neuer Musterstatuten neu gewählt. Unter den veränderten gesellschaftlichen Verhältnissen nach 1945 konnten die ländlichen Genossenschaften in neuer Weise für den Warenverkehr zwischen Stadt und Land wirksam werden. Ebenso weitverzweigt wie der privatkapitalistische Landhandel, ermöglichten die Genossenschaften dank ihrer zentralisierten Organisationsformen eine Lenkung und Kontrolle des Warenaustausches durch die neuen, demokratischen Verwaltungsorgane.
Die Ergebnisse der Bodenreform
In den durch die Bodenreform gebildeten Bodenfonds wurden etwa ein Drittel der landund forstwirtschaftlich genutzten Flächen der Ostzone einbezogen: 3,3 Millionen Hektar Land. 76 Prozent davon stammten von 7160 privaten Gutsbesitzern und 4 Prozent von 4537 Höfen aktiver Faschisten und Kriegsverbrecher mit weniger als 100 Hektar Landbesitz. Bei den restlichen 20 Prozent handelte es sich fast ausschließlich um staatlichen Besitz. Die Betriebe agrarwissenschaftlicher Forschungseinrichtungen und der kirchliche Bodenbesitz blieben von der Bodenreform unberührt.
Im Land Mecklenburg-Vorpommern betrug der Anteil der in den Bodenfonds einbezogenen Flächen an der Gesamtfläche 54 Prozent, in der Provinz Mark Brandenburg 41 Prozent, in der Provinz Sachsen 33 Prozent, im Land Sachsen 24 Prozent, im Land Thüringen 15 Prozent. Die Hälfte allen Bodenreformlandes konzentrierte sich in den Agrarländern Mecklenburg-Vorpommern und Mark Brandenburg.
Zwei Drittel des Bodenfonds wurden als privates Eigentum an individuelle Bodenempfänger verteilt, ein Drittel ging in Landeseigentum sowie in die Hand kommunaler und gesellschaftlicher Organe über. Große Forstflächen wurden Landeseigentum. Es entstanden etwa 500 Landesgüter.
Die Bodenreform wirkte sich in schätzungsweise zwei Dritteln aller Gemeinden unmittelbar aus. Die Zahl der individuellen Bodenempfänger betrug etwas mehr als eine halbe Million. Es entstanden 210276 Neubauernstellen mit bis zu 10 Hektar Land. 82483 landwirtschaftliche Kleinbetriebe wurden durch Landzuteilungen wirtschaftlich gestärkt. Kleinpächter erhielten bisher gepachtete Flächen als Eigentum. Außerdem wurden 39838 Waldparzellen an Altbauern gegeben. Fast 200 000 nichtlandwirtschaftliche Arbeiter und Angestellte — überwiegend Städter — sowie Handwerker und Gewerbetreibende auf dem Dorf kamen in den Besitz einer Bodenparzelle. Die Familienangehörigen mitgerechnet, veränderten sich in der Ostzone durch die Bodenreform die Existenzbedingungen von schätzungsweise 1,3 Millionen Menschen. Unter den Neubauern befanden sich 91155 Umsiedlerfamilien.
Die Bodenreform bedeutete eine grundlegende Umwälzung der Eigentums-, Klassenund Machtverhältnisse auf dem Lande. Der private Großgrundbesitz war beseitigt. Kleinund Mittelbauern als zahlenmäßig stärkste Schichten im Dorf bewirtschafteten nunmehr etwa zwei Drittel der landwirtschaftlichen Nutzfläche. Insgesamt existierten 770000 bäuerliche Betriebe mit mehr als 0,5 Hektar Land. Unter ihnen befanden sich 220000 Nebenerwerbsbetriebe, meist bis zu 2 Hektar groß.
Die Veränderungen in der Anzahl und in der Größe der landund forstwirtschaftlichen Betriebe mit landwirtschaftlicher Nutzfläche 1949 gegenüber 1939
Mit der Beseitigung des Großgrundbesitzes verlor die imperialistische Reaktion ihre Hauptstütze auf dem Lande und zerbrach der durch die kapitalistische Gutswirtschaft repräsentierte Kern der kapitalistischen Landwirtschaft. Das private Bodenmonopol und die mit ihm verbundene absolute Grundrente wurden beseitigt. Damit entfiel ein Hemmnis in der Entwicklung der agraren Produktivkräfte. Die Übergabe des Bodens an Kleinbauern, Landarbeiter und Umsiedler als Privateigentum setzte Triebkräfte für einen raschen Wiederaufbau der durch die faschistische Kriegspolitik schwer geschädigten Landwirtschaft frei. Die Bodenreform machte ein jahrhundertealtes historisches Unrecht an den Bauern wieder gut: Die Landlosigkeit und Landarmut der bäuerlichen Bevölkerung wurden beseitigt. Es entstand ein auf festen sozialen Grundlagen ruhendes Bündnis zwischen der Arbeiterklasse und den werktätigen Bauern. Das war für die weitere Demokratisierung des Dorfes entscheidend und zugleich eine notwendige Bedingung der antifaschistisch-demokratischen Umwälzung insgesamt. Im Ergebnis der Bodenreform wurde die KPD bzw. nachfolgend die SED zur politisch bestimmenden Kraft auf dem Lande.
Die erfolgreiche revolutionäre Aktion und als ihre Folge die veränderten Lebensbedingungen zogen tiefe Umbrüche im gesellschaftlichen Bewußtsein und in der sozialen Psyche breiter Teile.der Landbevölkerung nach sich. Zehntausende Menschen wurden erstmals in progressive politische Bewegungen einbezogen. Auf der Grundlage der antifaschistisch-demokratischen Verhältnisse begann sich ein neuer Typ des werktätigen Bauern zu entwickeln — ein Bauer, der sich als Werktätiger mit dem Arbeiter verbunden sah, sich für das Fortkommen seines Dorfes verantwortlich fühlte und politisch für den antifaschistisch-demokratischen Entwicklungsweg engagierte. Es entstanden materiell wie ideell Bedingungen für erste Schritte zur Überwindung der traditionellen Rückständigkeit des Dorfes.
Die demokratische Bodenreform die erste siegreiche revolutionäre Massenaktion in der deutschen Geschichte — trug den Charakter einer antiimperialistisch-demokratischen Agrarrevolution unter Führung der Arbeiterklasse. Sie reichte in ihrer gesellschaftlichen Wirkung beträchtlich über die Spezifik der antifaschistisch-demokratischen Aufgabenstellung hinaus. Als Prozeß mit Eigengewicht vollzog sie sich zugleich im gesellschaftlichen Gesamtzusammenhang eines revolutionären Prozesses, dessen ständige Höherentwicklung die antifaschistisch-demokratische Umwälzung zur einleitenden Phase des Übergangs vom Kapitalismus zum Sozialismus werden ließ. Folgende Elemente der antifaschistisch-demokratischen Agrar-. umwälzung brachten diesen Entwicklungszusammenhang zum Ausdruck: die Fundierung des Bündnisses der Arbeiterklasse mit der werktätigen Bauernschaft als des für die sozialistische Revolution entscheidenden Klassenbündnisses und die Festigung der Hegemonie der Arbeiterklasse; die im ganzen gesehen zunehmende Dominanz der werktätigen Bauern im Dorf bei Zurückdrängung des großbäuerlichen Einflusses; die Begrenzung des mit der kleinen Warenproduktion verbundenen sozialökonomischen Differenzierungsprozesses; die mit der VdgB als demokratischer Organisation der Bauern verbundene Entwicklung gegenseitiger Hilfeleistung zwischen den Bauern im Dorf; die Entwicklung der Landesgüter — vielfach Basen der Saatgutproduktion und der Tierzucht — als Keimformen sozialistischer Produktionsverhältnisse.
Von vornherein hatte die KPD ihre Konzeption für die demokratische Lösung der Agrarfrage so angelegt, daß sie dem Zusammenhang zwischen dem Kampf um Demokratie und dem um den Sozialismus Rechnung trug. Nicht zuletzt deshalb zielte die Bodenreform auf einen solchen Neubauern, dessen gesellschaftliche Stellung vor allem durch seine soziale Qualität als Werktätiger geprägt war. Das Maß der Landzuteilung war auf Familienbetriebe abgestellt, die bei intensiver Feldund Viehwirtschaft ohne Beschäftigung von Lohnarbeitskräften ein gesichertes Arbeitseinkommen zu erreichen vermochten. Die rechtliche Bestimmung, daß die Neubauernstelle weder verkauft noch verpachtet, noch hypothekarisch belastet werden durfte, sollte den sozialökonomischen Differenzierungsprozeß auf dem Lande begrenzen. Zugleich sollte in dieser neuen Eigentumskategorie die soziale Qualität des Neubauernhofes als Arbeitseigentum werktätiger Bauern hervortreten. Unvermeidbar war aber, daß sich auf der Basis der bäuerlichen Warenproduktion und des Privateigentums an Produktionsmitteln ein bäuerliches Besitzdenken entwikkelte, das mit der Illusion verbunden war, auf Dauer als kleiner Warenproduzent am gesellschaftlichen Fortschritt teilhaben zu können.
Die demokratische Bodenreform in der sowjetischen Besatzungszone vollzog sich in grundsätzlicher Übereinstimmung mit der Agrarumwälzung in den volksdemokratischen Ländern. Es bestanden Unterschiede im Etappenverlauf, in der Enteignungsgrenze und in anderen Modalitäten. Gemeinsam war aber den Agrarreformen die antiimperialistische Zielrichtung und der revolutionär-demokratische Charakter.
Die Auswirkungen der demokratischen Bodenreform in der ehemaligen Rittergutsgemarkung Mittenwalde/Uckermark 1945/46
Wirtschaftsaufbau, Einschränkung der Macht des Monopolkapitals und Entnazifizierung
Inhaltsverzeichnis
1 Wirtschaftsaufbau, Einschränkung der Macht des Monopolkapitals und Entnazifizierung
-
- 1.1 Umstellung auf Friedensproduktion, Entnazifizierung der Wirtschaft und Ringen der Gewerkschaften um Mitbestimmung
- 1.2 Der Aufbau eines demokratischen Wirtschaftsapparates und Finanzsystems
- 1.3 Die Zerschlagung der Konzerne und die Demokratisierung der Industrieund Handelskammern
- 1.4 Die Sequestrierung des Eigentums der Naziund Kriegsverbrecher
- 1.5 Die Wirtschaftskonferenz der KPD
- 1.6 Der tagtägliche Kampf gegen Hunger und Not. Die Entstehung der Volkssolidarität
- 1.7 Entnazifizierung, Demokratisierung und Ausbau der Verwaltungsorgane
- 1.8 Der Aufbau einer demokratischen Polizei und der Beginn der Justizreform
Umstellung auf Friedensproduktion, Entnazifizierung der Wirtschaft und Ringen der Gewerkschaften um Mitbestimmung
Die Initiativen der Belegschaften und der aufbauwilligen kleinen und mittleren Unternehmer zur Wiederaufnahme der Produktion, die sich in einer improvisierten Erzeugung von Produkten für den elementaren Bedarf der Bevölkerung und der Landwirtschaft, im Beheben von Kriegsschäden am Produktionsapparat und an Gebäuden und in der Vorbereitung eines neuen Fertigungsprogrammes äußerten, erhielten im Spätsommer 1945 durch eine Reihe von Befehlen der SMAD eine neue Grundlage.
Im August und September 1945 konkretisierte der Oberste Chef der SMAD seinen grundlegenden Befehl Nr. 9 zur Wiederingangsetzung der Produktion durch gesonderte Befehle. Sie verfügten, welche Produktion von den einzelnen Industriezweigen und Erzeugnisgruppen bis Dezember 1945 zu erbringen war, und legten die Maßnahmen fest, die von den demokratischen Verwaltungen, von den Betriebsdirektoren und von den sowjetischen Dienststellen zur Festlegung der Produktionsziele und zur Versorgung der Betriebe mit Rohund Hilfsstoffen sowie Arbeitskräften zu treffen waren. Die Autorität dieser Produktionsbefehle, die helfende Kontrolle über ihre Ausführung und die weitgehende Realitätsnähe der gesetzten Produktionsziele erleichterten es den Arbeitern und Ingenieuren in den jeweiligen Industriezweigen, die Produktion durchgängig aufzunehmen. Die dabei in der Brennstoffindustrie, in der Energieerzeugung und in einigen Zweigen der chemischen Industrie bis Ende 1945 erreichten Produktionsergebnisse ermöglichten es, den Kreis der produzierenden Industriebetriebe stetig zu erweitern und das Verkehrswesen in einem gewissen Umfang wieder mit Brennund Treibstoffen zu versorgen. Im Herbst 1945 hatten in der Ostzone insgesamt 13 685 Industriebetriebe die Arbeit aufgenommen. In Thüringen produzierten am Jahresende bereits 90 Prozent der Betriebe. In der überwiegenden Mehrzahl der Betriebe lag die Produktion allerdings weit unter der verfügbaren Kapazität. Nur in der Kohlenförderung, in der Brikettierung und in der Energieerzeugung gelang es, die gegebenen Produktionsbedingungen in einem größeren Umfang auszunutzen.
Der Übergang zu einer durchgängigen Wiederaufnahme der Industrieproduktion stellte die demokratischen Verwaltungsorgane in den Ländern und Provin-
zen vor neuartige Aufgaben. Die kommunistischen und sozialdemokratischen Wirtschaftsfunktionäre setzten gemeinsam und im engen Zusammenwirken mit den zuständigen sowjetischen Offizieren alles daran, aktiv in den sich vollziehenden Ingangsetzungsprozeß der Industrie einzugreifen. Beispielgebend dafür waren die Wirtschaftsämter im Land Sachsen und in der Provinz Mark Brandenburg. Anders verhielt es sich bei einer Vielzahl bürgerlicher Fachleute, die in führenden Positionen des Wirtschaftsapparates tätig waren. Sie standen dieser Aufgabe reserviert oder ablehnend gegenüber. Oftmals resultierte eine solche Haltung auch einfach aus der Unfähigkeit, mit den ungeheuren Schwierigkeiten, die zu überwinden waren, fertig zu werden.
Am 19. Oktober 1945 wies der Oberste Chef der SMAD mit Befehl Nr. 103 die Ausarbeitung eines Wirtschaftsplanes der Länder und Provinzen für 1946 mit dem Ziel an, den Übergang zur Friedenswirtschaft planmäßig zu gestalten.
Die SMAD stellte, unterstützt von den deutschen Zentralverwaltungen, aus den Ausarbeitungen der Landesund Provinzialverwaltungen einen Wirtschaftsplan für das Jahr 1946 für die gesamte sowjetische Besatzungszone zusammen und gab die Produktionsziele für das I. Quartal 1946 in einem Befehl vor.
Die koordinierte Umstellung der Wirtschaft auf die Bedürfnisse der Bevölkerung und die Erfordernisse der Wiedergutmachung führte, gemessen an der Ausgangslage im Frühjahr 1945, zu beachtlichen Ergebnissen. In der Provinz Sachsen stieg zwischen Mai 1945 und Mai 1946 die Elektroenergieerzeugung um 342 Prozent, die Rohbraunkohlenförderung um
Beginn der Produktion von PKW im Audi-Werk in Zwickau, 1946
Eine Notbrücke auf der Eisenbahnstrecke Güstrow — Plau wird auf Belastbarkeit getestet, 26. Februar 1946
und die Briketterzeugung um 200 Prozent. Zwischen August 1945 und Mai 1946 wuchs die Produktion von Vergaserkraftstoffen um 500 Prozent und die von Diesel um 967 Prozent an. Die Förderung des Kalibergbaus stieg von Juni 1945 bis Mai 1946 um 746 Prozent, die des Kupferschieferbergbaus um 181 Prozent. Bemerkenswert war der Produktionsanstieg in der Baumaterialienindustrie. Im Mai 1946 lag die Mauersteinund Zementerzeugung um 112 und die Fensterglasfertigung um 46 Prozent höher als im Oktober 1945. Ähnliche Ergebnisse verzeichneten auch die anderen Länder und Provinzen der Ostzone.
Aus der vorläufigen Volkszählung vom Dezember 1945 ging hervor, daß in Industrie und Handwerk 1800000 Arbeiter und Angestellte beschäftigt waren. Die befürchtete Massenarbeitslosigkeit war vorerst gebannt. Im Dezember 1945 betrug in der sowjetischen Besatzungszone der Anteil der voll arbeitsfähigen männlichen Arbeitslosen 6,7 und der der weiblichen Arbeitslosen 14,9 Prozent aller Erwerbsfähigen. In Thüringen belief sich zum gleichen Zeitpunkt die Arbeitslosenzahl auf lediglich 4,2 Prozent der Vollerwerbsfähigen. Die Zahl der Arbeitslosen ging bis zum Frühjahr 1946 weiter zurück.
Die durchgängige Wiederaufnahme der Produktion in der Industrie und die beginnende Normalisierung des Verkehrswesens sicherten die elementare Existenz der Arbeiterklasse und schufen zugleich Voraussetzungen dafür, daß Arbeiterparteien und Gewerkschaften die Arbeiterklasse organisieren und zum Kampf um die Säuberung der Wirtschaft von faschistischen Elementen mobilisieren konnten. Es waren vor allem die Betriebsgruppen der KPD und sozialdemokratische Funktionäre sowie die von ihnen politisch geführten Betriebsräte und Gewerkschaftsorganisationen, die mit tatkräftiger Unterstützung der Belegschaften dafür sorgten, daß sich in den Direktionen, vor allem in denen der Großbetriebe, keine Faschisten und Reaktionäre mehr halten konnten. In Sachsen und der Mark Brandenburg gelang es den eng zusammenarbeitenden Repräsentanten der beiden Arbeiterparteien, den Wirtschaftsapparat weitgehend von faschistischen Elementen zu säubern. In den Landesämtern für Wirtschaft und in anderen einschlägigen Dienststellen der Provinz Sachsen sowie der Länder Mecklenburg-Vorpommern und Thüringen war die Säuberung von ehemaligen Mitgliedern der NSDAP zunächst weniger durchgreifend. Bürgerliche Fachleute, die führende Ämter im Wirtschaftsapparat einnahmen, weigerten sich häufig mit Erfolg, ihnen unterstellte Parteigänger des Faschismus zu entlassen, weil sie meinten, auf deren Sachkompetenz nicht verzichten zu können.
Um die Entnazifizierung entschiedener durchzusetzen, bedurfte es im Herbst 1945 des Eingreifens der SMA. In Thüringen sah sie sich am 31. Oktober 1945 veranlaßt, dem Präsidenten der Landesverwaltung eine Liste mit 214 Namen von ehemaligen NSDAP-Mitgliedern zu übergeben, die noch in verschiedenen Landesämtern führend tätig waren. Mitte November 1945 ordnete schließlich der Präsident der Landesverwaltung die Entlassung aller ehemaligen NSDAP-Mitglieder aus den Ämtern seiner Verwaltung an. Zwischen dem 15. Mai 1945 und dem 31. Mai 1946 reduzierte sich die Anzahl der im wirtschaftslenkenden Apparat des Landes Thüringen tätigen ehemaligen Nazis von 6379 auf 2194, von denen 75 Prozent im Finanzapparat des Landes tätig waren. Das war der Tatsache geschuldet, daß es für diesen speziellen Arbeitsbereich in besonderem Maße an sachkundigen antifaschistisch-demokratischen Kräften mangelte.
Die seit dem Sommer 1945 bei der Entnazifizierung der Wirtschaft, bei der Wiederaufnahme der Industrieproduktion und bei der Normalisierung des Verkehrswesens erreichten Fortschritte waren vornehmlich der Einsatzbereitschaft, der politischen Umsicht und den organisatorischen Fähigkeiten der betrieblichen Gewerkschaftsausschüsse und der Betriebsräte zu danken. Diese Interessenvertretungen der Arbeiterklasse ermöglichten es zugleich, daß zwischen Ende Juli und Ende September 1945 der Aufbau der freien Gewerkschaften in den Ländern und Provinzen der Ostzone abgeschlossen werden konnte. Die Delegierten der in den Betrieben, den Industrieorten sowie den Kreisen bzw. Bezirken gebildeten Gewerkschaftsausschüsse fanden sich zu ersten Landesbzw. Provinzialkonferenzen der Gewerkschaften zusammen, um den vorläufigen Landesbzw. Provinzialausschüssen der Gewerkschaften die Legitimation zu geben und die Aufgabe der Gewerkschaftsorganisationen und der Betriebsräte auf den verschiedenen Gebieten der antifaschistisch-demokratischen Umwälzung zu beraten und zu beschließen. Die erste dieser Konferenzen auf Landesbzw. Provinzialebene fand am 27. und 28. Juli im Land Sachsen statt. Im Land Thüringen kamen die Gewerkschafter am 20. August, in der Provinz Mark Brandenburg am 26. August, in der Provinz Sachsen am 15. September und im Land Mecklenburg-Vorpommern am 22. und 23. September 1945 zusammen. Im Mittelpunkt der Referate und Diskussionen auf den Konferenzen stand die Frage, was von den Gewerkschaftsorganisationen und von den Betriebsräten zur Vernichtung des Faschismus zu tun war bzw. welche Stellung die Gewerkschaften im antifaschistischdemokratischen Umwälzungsprozeß einnehmen mußten. Alle fünf Konferenzen orientierten ihre Mitglieder übereinstimmend auf die konsequente Überwindung des Faschismus und seiner Ideologie, auf den Wiederaufbau der Wirtschaft nach demokratischen Grundsätzen, auf die Wahrung der sozialen Interessen der Arbeiterklasse und forderten, daß „das Recht der Mitwirkung der gesamten Belegschaft ausgebaut und gesichert“ wird.?!
Die praktische Durchsetzung des Mitbestimmungsrechts in den Betrieben stieß — auch nach dem Erlaß des Betriebsrätegesetzes vom 10.Oktober 1945 in Thüringen — auf erheblichen Widerstand der noch von Interessenwahrern des Monopolkapitals beherrschten Betriebsdirektionen und auf die Ablehnung durch mittlere und kleine Unternehmer, die noch kein Verständnis für die sich verändernde Stellung der Betriebsvertretungen aufzubringen vermochten.
Der Aufbau eines demokratischen Wirtschaftsapparates und Finanzsystems
Mit der Konstituierung der Landesund Provinzialverwaltungen begann der Aufbau des demokratischen Wirtschaftsapparates und Finanzsystems in den Ländern und Provinzen. In den Ländern Sachsen und Mecklenburg-Vorpommern sowie in der Provinz Mark Brandenburg wurden die Landwirtschaftsämter von Antifaschisten aufgebaut, die seit der Befreiung vom Faschismus in den Wirtschaftsabteilungen der Städte und Kreise erste Erfahrungen in der Organisierung des Wirtschaftslebens gesammelt hatten. Sie zogen dazu bürgerliche Wirtschaftsund Verwaltungsfachleute, die sich unter dem Naziregime nicht kompromittiert hatten, heran. Im Land Thrüringen und in der Provinz Sachsen hatten die amerikanischen Besatzungsbehörden die Wirtschaftsverwaltungen im wesentlichen unverändert belassen. Lediglich in den Spitzenpositionen waren aktive Faschisten durch unoder weniger belastete bürgerliche Verwaltungsfachleute ersetzt worden. Nach dem Einrücken der Sowjetarmee in diese Gebiete war darum eine demokratische Umgestaltung des Verwaltungsapparates, die personelle Veränderungen ebenso wie einen Wandel in der Amtsführung beinhaltete, dringend geboten. Mit Hilfe der sowjetischen Wirtschaftsoffiziere, der Wirtschaftsabteilung des ZK der KPD und der Bezirksleitungen der KPD gelang es bis zum Herbst 1945 in allen Ländern und Provinzen der Ostzone, den demokratischen Wirtschaftsapparat weitgehend nach einheitlichen inhaltlichen und organisatorischen Grundsätzen einzurichten. Allerdings bedurfte es noch eines längeren Zeitraums, um im Land Thüringen und in der Provinz Sachsen den starken Einfluß von Anhängern einer bourgeoisen Wirtschaftsauffassung vollends zurückzudrängen. Das gelang im thüringischen Landesamt für Wirtschaft erst im Frühjahr 1946.
Im Zusammenhang mit der Aufstellung der Haushaltspläne für das IV. Quartal 1945 und für das Rechnungsjahr 1946 begann die Deutsche Zentralfinanzverwaltung, einen einheitlich organisierten Finanzapparat von der Zentrale bis in die Gemeinden hinein aufzubauen. Die Deutsche Zentralfinanzverwaltung
konzentrierte bei sich den größten Teil der in den Ländern und Provinzen erzielten Einnahmen. So sah beispielsweise der Haushaltsplan der Provinz Mark Brandenburg für das Jahr 1946 die Abgabe von 67 Prozent der Einnahmen an diese Zentralverwaltung vor. Von diesen Mitteln wurden der Unterhalt der Zentralverwaltungen bestritten, Maßnahmen zur antifaschistisch-demokratischen Umgestaltung finanziert sowie die Besatzungskosten und Reparationsverpflichtungen beglichen.
Die Haushaltspläne lenkten die Aufmerksamkeit der Landesund Provinzialverwaltungen darauf, die ihnen zustehenden Einnahmen sorgfältig zu erheben und ihre steuerpolitischen Rechte durchzusetzen. Dazu mußten einerseits die von verschiedenen Kommunen aus finanzieller Not veranlaßten Steuererhöhungen und neu eingeführten Steuerarten wieder aufgehoben und andererseits nachdrücklich die steuerliche Pflichteinstufung auf Landesbzw. Provinzebene durchgesetzt werden. Mitarbeiter des Finanzapparates — zunächst ausschließlich bürgerliche Fachleute und zumeist ehemalige NSDAP-Mitglieder — zogen — vorwiegend aus politischen Gründen die 1945 fälligen Steuern nur widerwillig oder überhaupt nicht ein. Zu den daraus resultierenden zeitweiligen Einnahmeverlusten traten auch solche, die sich aus den überkommenen steuerpolitischen Regelungen und aus der im Jahre 1945 geringen Wirtschaftstätigkeit ergaben. Darum blieben die erzielten Einnahmen der Ländesund Provinzialverwaltungen bis Ende 1945 unter den dringendsten Ausgaben, so daß sich die Präsidien gezwungen sahen, bei der SMAD um Kredite nachzusuchen. Mit Beginn des Jahres 1946 jedoch erhöhten sich die aus dem Steueraufkommen resultierenden Einnahmen nennenswert. Das hatte verschiedene Gründe. Antifaschisten und loyale bürgerliche Experten übernahmen führende Positionen im Finanzapparat und sorgten für dessen diszipliniertes Arbeiten. Die ökonomische Situation der meisten wirtschaftlichen Unternehmen verbesserte sich, und es begannen sich die steuerpolitischen Gesetze des Alliierten Kontrollrates, die auf das Anheben ‚der Einkommens-, Körperschafts-, Vermögensund Verbrauchssteuern abzielten, auszuwirken.
Die im August 1945 von den Landesund Provinzialverwaltungen gegründeten Landesund Provinzialbanken, die ihrem Wesen nach Staatsbanken waren, begründeten das Bankmonopol der antifaschistischdemokratischen Verwaltungsorgane in der Ostzone. Am 6. August 1945 öffneten die Brandenburger Provinzialbank in Potsdam und die ihr angeschlossenen 26 selbständigen Kreisund Stadtbanken ihre Schalter. Im ersten Monat ihrer Tätigkeit richteten in dieser Bank 350000 Kunden ihre Konten ein und vertrauten ihr ca. 3,3 Milliarden Reichsmark an Guthaben an.
Die 51 Sparkassen mit 250 Zweigund Annahmsestellen der Provinz Mark Brandenburg registrierten Ende August 1945 Einlagen in Höhe von rund 300 Millionen Mark. Ähnliche Entwicklungen waren auch in den anderen Ländern und in der Provinz Sachsen zu verzeichnen. Ende 1945/Anfang 1946 gesellten sich zu diesen staatlichen Finanzinstituten noch landwirtschaftliche und gewerbliche Kreditgenossenschaften. Bis Mitte 1946 hatten allein in der Provinz Mark Brandenburg 450 landwirtschaftliche und 50 gewerbliche Kreditgenossenschaften ihre Geschäfte aufgenommen. Neben diesen landeseigenen und genossenschaftlichen Bankinstituten existierten in der sowjetischen Besatzungszone noch eine Reihe kleiner Privatbanken. In Groß-Berlin hatte schon im Juni 1945 das Berliner Stadtkontor als Finanzinstitut des Magistrats seine Tätigkeit aufgenommen.
Der demokratische Wirtschaftsapparat und das Finanzsystem bildeten sich in den Grundzügen bis zum Frühjahr 1946 aus und bestanden dabei zugleich — im Kontext der antifaschistisch-demokratischen Umgestaltung — die erste Bewährungsprobe.
Die Zerschlagung der Konzerne und die Demokratisierung der Industrieund Handelskammern
Auf Initiative örtlicher Organisationen der Arbeiterparteien hatten im Juni und Juli 1945 Stadtund Kreisverwaltungen das Vermögen führender Faschisten und Rüstungsindustrieller beschlagnahmt. Im August 1945 gingen die Präsidien der Landesbzw. Provinzialverwaltungen dazu über, das in ihren Ländern und Provinzen befindliche Eigentum von Naziaktivisten und Kriegverbrechern zu beschlagnahmen. Ende August 1945 traf der Präsident der Landesverwaltung Mecklenburg-Vorpommern entsprechende Anordnungen. In Thüringen verfügte am 7. September 1945 der Präsident der Landesverwaltung die Beschlagnahme des Werkes Eisenach der Bayrische Motoren-Werke AG. Um der Wirtschaftssabotage wirksam zu begegnen, gründete die sächsische Landesverwaltung staatliche Unternehmen, in denen die Steinund Braunkohlenwerke — ungeachtet ihrer Eigentumsverhältnisse — unter einer einheitlichen Leitung zusammgefaßt wurden. Ende Oktober 1945 nahmen in den Kreisen des Landes Sachsen Ämter für Betriebsneuordnung, denen die Führung der unter Treuhand stehenden Betriebe übertragen wurde, ihre Tätigkeit auf. Am 29. Oktober 1945 beschloß das Präsidium der Landesverwaltung Sachsen, „die dem Kriegsverbrecher Flick gehörigen und im Bundesland Sachsen gelegenen Unternehmungen mit allen ihren Beteiligungen und Rechten sowie alle sonstigen im Besitz des Kriegsverbrechers Flick befindlichen Vermögenswerte im Bundesland Sachsen zu enteignen und in das Eigentum des Bundeslandes Sachsen zu überführen“?. Damit ging das Präsidium der Landesverwaltung Sachsen über die bisher von den demokratischen Verwaltungen getroffenen Entscheidungen hinaus und entsprach damit den in Versammlungen der Arbeiterparteien, von Betriebsbelegschaften, auf gewerkschaftlichen Konferenzen und in anderen Gremien demokratischer Kräfte immer stärker erhobenen Forderungen nach Bestrafung und Enteignung aller, vor allem aber der monopolkapitalistischen Naziund Kriegsverbrecher. Auf Initiative der KPD gingen im Herbst 1945 die Belegschaften der Monopolbetriebe dazu über, ihre Produktionsstätten aus dem Konzernverband herauszulösen und den Landesbzw. Provinzialverwaltungen zu unterstellen.
Demgegenüber versuchte die Monopolbourgeoisie, ihren Einfluß auf das politische und wirtschaftliche Leben zurückzugewinnen. Seit den Sommermonaten 1945 knüpften die Konzernzentralen, die fortschreitenden Normalisierungen nutzend, die seit den letzten Kriegswochen unterbrochenen Verbindungen zu ihren in der Ostzone angesiedelten Betrieben und erteilten ihren Beauftragten in den Betriebsleitungen Anweisungen, das Niveau der Produktion möglichst niedrig zu halten, um den Wirtschaftsaufbau zu hemmen. Dabei wurden die vielfältigsten Methoden angewandt, nicht zuletzt die eines gezielten Mißmanagements. So führten die Direktoren der Tagebaue der Deutschen Erdöl AG den Betrieb seit dem Winter 1944/45 so, daß durch Vernachlässigung der Abraumarbeiten zu gegebener Zeit die Kohlengewinnung zum Erliegen kommen mußte. Es war der Wachsamkeit der Betriebsräte zu danken, daß diese Absicht rechtzeitig aufgedeckt und durchkreuzt werden konnte. Eine wachsende Rolle spielten auch Bemühungen, kommerzielle und technische Unterlagen, wichtige Produktionsanlagen sowie seltene Rohstoffe und Materialien in die Westzonen zu bringen. Hinzu kam die Abwerbung von Fachpersonal.
Zur gleichen Zeit etablierten sich Interessenwahrer der Monopolbourgeoisie in führenden Positionen der CDU und der LDPD. Sie übten, da sie formell nicht faschistisch belastet waren, wichtige Funktionen in den demokratischen Verwaltungen aus, wie beispielsweise der CDU-Politiker Ferdinand Friedensburg, Mitglied des Hauptvorstandes seiner Partei, als Präsident der DZV der Brennstoffindustrie. Er wählte für diese Zentralverwaltung einen seinen Intentionen folgenden Mitarbeiterstab aus und unternahm mit dessen Hilfe alles, um den demokratischen Umgestaltungsprozeß in der Kohlenindustrie zu vereiteln oder zu behindern. Beauftragte der Siemens-Schuckert AG, deren Zweigwerke in Thüringen beschlagnahmt und der Thüringer Verwaltungs-Gesellschaft GmbH,
einem Landesunternehmen, zur treuhänderischen Verwaltung übergeben worden waren, erreichten Ende Oktober 1945, daß in der Verwaltungs-Gesellschaft ein sogenannter Siemens-Ausschuß gebildet wurde. Seine Aufgabe sollte es sein, die kommerziellen Verbindungen zwischen der Konzernzentrale und den von Treuhändern geleiteten Produktionsstätten in Thüringen zu knüpfen und zu pflegen. Die SiemensSchuckert AG bediente sich demokratischer Einrichtungen, um trotz veränderter Besitzverhältnisse den Konzern zusammenzuhalten.
Zu dem Versuch der Monopolbourgeoisie, die politische und ökonomische Initiative zurückzuerlangen, gehörte auch die Reaktivierung der Unternehmerorganisationen. Dabei war sie sowohl Initiator der Wiederbelebung von Unternehmerverbänden als auch Förderer solcher Organisationen. Vielfach entstanden diese durch Aktivitäten kleiner und mittlerer Unternehmen. Aber auch unternehmerische Fachverbände, in denen die Konzerne die Führung innehatten, wie der in Halle ansässige Stahlbauverein, knüpften wieder Verbindungen zu ihren Mitgliedsfirmen.
Die verschiedenen mehr oder weniger erfolgreichen Versuche der Unternehmer, sich zu organisieren, stieBen im August und September 1945 auf einen immer entschiedeneren Widerstand der Gewerkschaften und der demokratischen Verwaltungsorgane. Mitte September 1945 sah sich die SMAD erneut veranlaßt, nachdrücklich auf das Verbot sämtlicher Reichsvereinigungen, Reichsgesellschaften, Reichskammern und anderer Unternehmerorganisationen hinzuweisen.
Das Bestreben, Unternehmerund Arbeitgeberorganisationen zu schaffen, ging mit dem Wiederaufbau von Industrieund Handelskammern einher. Diese waren in den ersten Wochen nach der Befreiung vom Faschismus vor allem in dem von britischen und amerikanischen Truppen besetzten Teil der sowjetischen Besatzungszone wiederentstanden. Es waren vornehmlich mittlere und kleine, nicht mit dem Faschismus liierte Unternehmer, die dazu beigetragen hatten, daß die faschistischen Gauwirtschaftskammern so in Thüringen am 25.Juli 1945 durch den Präsidenten der Landesverwaltung — aufgelöst und die Exponenten des Faschismus aus den Leitungsgremien der Industrieund Handelskammern entfernt wurden. Diese Unternehmer reorganisierten im Sommer und Herbst 1945 die Industrieund Handelskammern mit der erklärten Absicht, ihnen die bis 1933 vorherrschende Stellung unter den unternehmerischen Interessenvertretungen wiederzugeben.
Demgegenüber hatte die KPD den Industrieund Handelskammern in ihrer Konzeption für den demokratischen Wirtschaftsaufbau eine wichtige Funktion zugedacht. Diese konnten die Industrieund Handelskammern aber nur ausüben, wenn sie nicht ausschließliche Interessenvertreter der Unternehmer blieben. Darum empfahl die KPD, daß in den Leitungsgremien der Kammern und in deren verschiedenen Ausschüssen neben den Unternehmern gleichermaßen Gewerkschaftsvertreter und Mitarbeiter der demokratischen Verwaltungen Sitz und Stimme haben sollten.
Im Spätsommer 1945 begannen in den Landesund Provinzialverwaltungen die Arbeiten an den gesetzlichen Grundlagen für die demokratische Umgestaltung der Industrieund Handelskammern. Die erste Verordnung über die Bildung von Industrieund Handelskammern, die dem neuen Charakter dieser Institution gerecht wurde, erließ das Präsidium der Provinzialverwaltung Mark Brandenburg am 24. Oktober 1945. Sie verfügte, daß jeweils drei Unternehmer, drei Gewerkschafter und drei Vertreter der demokratischen Verwaltungsorgane die Kammern leiten sollten, und legte die Gültigkeit dieses Prinzips der Gemeinsamkeit auch für die anderen Kammergremien fest. Gleichartige Verordnungen wurden bis Anfang 1946 von den Präsidenten aller anderen Landesbzw. Provinzialverwaltungen erlassen.
Die Annahme der Verordnungen und die Konstituierung der Industrieund Handelskammern in den Ländern und Provinzen nach demokratischen Grundsätzen bedeutete keineswegs, daß in der Unternehmerschaft, die sich in den Kammern zusammenfand, der Gedanke an eine unabhängige unternehmerische Interessenvertretung aufgegeben worden war. Immer wieder nutzten Unternehmer ihre Verbindungen und Erfahrungen, um vornehmlich die Gewerkschaftsvertreter von einer Mitentscheidung der Kammerangelegenheiten fernzuhalten. In Thüringen reichten die Versuche, im Schoße der umgestalteten Industrieund Handelskammern unternehmerische Fachverbände aufzubauen, bis in das Frühjahr 1946 hinein.
Ab Anfang 1946 wurden in den Ländern und Provinzen der Ostzone einheitliche, demokratische Sozialversicherungen gebildet. In Sachsen und Thüringen schufen die Landesverwaltungen im Juni 1946 dafür die gesetzlichen Grundlagen. Damit wurde eine wichtige ökonomisch-soziale Einrichtung von den antifaschistisch-demokratischen Verwaltungen übernommen und der Großbourgeoisie ein besonders einträglicher Zweig kapitalistischer Profiterwirtschaftung entzogen.
Die Sequestrierung des Eigentums der Naziund Kriegsverbrecher
Am 30. Oktober 1945 erließ der Oberste Chef der SMAD den Befehl Nr. 124, in dem er bestimmte, daß das Eigentum des deutschen Staates, der Amtsleiter der NSDAP, der führenden Mitglieder und einflußreichen Anhänger dieser Partei, der militärischen Behörden und Organisationen, der vom sowjetischen Kommando verbotenen und aufgelösten Gesellschaften, Klubs und Vereinigungen und besonders bezeichneter Personen zu beschlagnahmen und ebenso wie das in der sowjetischen Besatzungszone befindliche herrenlose Gut in provisorische Verwaltung der SMAD zu nehmen ist. Dieser Befehl wurde am folgenden Tag durch den Befehl Nr. 126, der die Konfiskation und Sequestrierung des in der Ostzone befindlichen Eigentums der NSDAP und ihrer Organisation verfügte, ergänzt. In beiden Befehlen wurde der Leiter der ökonomischen Abteilung der SMAD beauftragt, bis zum 25. Dezember 1945 dem Obersten Chef der SMAD Vorschläge über die weitere Nutzung des beschlagnahmten oder unter provisorische Verwaltung der SMAD gestellten Eigentums zu unterbreiten. Die demokratischen Verwaltungsorgane wurden angewiesen, die in den Befehlen festgelegten Eigentumskategorien zu erfassen, die jeweiligen Eigentumsverhältnisse zu klären, Standort und Zustand des Eigentums festzuhalten und das Ergebnis ihrer Ermittlungen den zuständigen Militärbehörden zu melden. Die derzeitigen Verfügungsberechtigten über das Eigentum waren voll verantwortlich für die Erhaltung und Nutzung der Vermögenswerte.
Im Laufe des November 1945 suchten die Präsidien der Landesund Provinzialverwaltungen nach einem Weg, um einen großen Kreis von Antifaschisten in die Lösung dieser entscheidenden Aufgabe einzubeziehen. Nach Konsultationen mit der SMAD entstand der Vorschlag, durch Kommissionen aus Mitarbeitern der demokratischen Verwaltungsorgane, Vertretern der politischen Parteien und demokratischen Massenorganisationen sowie Arbeitern aus den Betrieben prüfen zu lassen, welche Vermögensobjekte auf Grund der Rolle, die ihre Eigentümer im Faschismus gespielt hatten, zu konfiszieren und zu sequestrieren waren.
Anfang Dezember 1945 konstituierten sich zunächst in den Ländern Sachsen und Thüringen und bis zum Januar 1946 auch im Land Mecklenburg-Vorpommern und den beiden Provinzen solche Sequesterkommissionen. Sie wurden jeweils vom 1. Vizepräsidenten geleitet und unterstanden direkt dem Präsidenten der Landesbzw. Provinzialverwaltung, der dem jeweiligen Chef der SMA verantwortlich war. Im Ergebnis einer intensiven Tätigkeit schlugen diese Sequesterkommissionen der SMAD vor, ca. 19000 Vermögensobjekte zu beschlagnahmen. Davon befanden sich in Thüringen 43 Prozent, im Land und in der Provinz Sachsen jeweils 21 Prozent, in Mark Brandenburg 10 Prozent und in Mecklenburg-Vorpommern 5 Prozent. Die Liste dieser Objekte verzeichnete unter den erfaßten Betrieben von Naziund Kriegsverbrechern alle in der Ostzone angesiedelten Betriebe von staatskapitalistischen und privatmonopolistischen Unternehmungen.
Dem konsequenten und umsichtigen, auf die Arbeiterklasse und die anderen antifaschistisch-demokratischen Kräfte gestützten Wirken der Sequesterkommissionen war es zu danken, daß bis zum Frühjahr 1946 die in den SMAD-Befehlen Nr. 124 und Nr. 126 gestellten Aufgaben im wesentlichen erfüllt wurden. Die Sequesterkommissionen entwickelten sich zu wichtigen Organen revolutionärer und demokratischer Machtausübung.
Die SMAD übertrug den Landesund Provinzialverwaltungen das Recht, die sequestrierten Betriebe
zu verwalten. Diese wurden im Auftrag der SMAD von Treuhändern geleitet, die durch die Landesbzw. Provinzialverwaltungen berufen worden waren. Unter der veränderten Rechtsträgerschaft begann sich der sozialökonomische Charakter der sequestrierten Betriebe zu wandeln. Dem Kapital war die juristische und ökonomische Verfügung über sie entzogen. Es bestimmte nicht mehr das Ziel der Produktion und konnte sich die Produktionsergebnisse nicht mehr aneignen. Die antifaschistisch-demokratischen Verwaltungen und die ihr Mitbestimmungsrecht wahrnehmenden Belegschaften legten im Rahmen der SMADBefehle das Produktionsprogramm, das der Befriedigung der materiellen Bedürfnisse der Werktätigen und der Wiedergutmachung diente, fest. Die von den Landesund Provinzialverwaltungen mit der Leitung der sequestrierten Betriebe beauftragten Treuhänder waren zumeist Kommunisten, Sozialdemokraten und Gewerkschafter, verschiedentlich der Demokratisierung loyal gegenüberstehende Ingenieure oder Kaufleute, die vielfach aus den Belegschaften kamen. Sie vertraten die demokratische Wirtschaftspolitik und arbeiteten eng mit den betrieblichen Interessenvertretungen zusammen. In den Monaten, in denen die Betriebe unter einer treuhänderischen Verwaltung standen, bereiteten sich die fortgeschrittenen Teile der Belegschaften darauf vor, die Betriebe in gesellschaftliches Eigentum zu übernehmen.
Die Wirtschaftskonferenz der KPD
Am 29. Dezember 1945 und am 7.Januar 1946 fand in Berlin eine zentrale Wirtschaftskonferenz der KPD statt. An ihr nahmen Wirtschaftsfunktionäre des Zentralkomitees und der Landesbzw. Provinzialleitungen der KPD, Mitglieder des wirtschaftspolitischen Ausschusses der SPD, Betriebsleiter und Betriebsräte, Vertreter der Gewerkschaften, der deutschen Zentralverwaltungen, der Landesbzw. Provinzialverwaltungen sowie auch der KPD aus den Westzonen teil. Das Referat hielt Bruno Leuschner, Leiter der Wirtschaftsabteilung des ZK der KPD. Die Konferenz analysierte den bis Ende 1945 erreichten Stand bei der Umsetzung der Wirtschaftskonzeption der KPD und legte den Entwurf der Richtlinien für die weitere Wirtschaftspolitik vor.
Die KPD betonte darin, daß die antifaschistisch-demokratische Umgestaltung nur dann erfolgreich verlaufen werde, „wenn die einige Arbeiterschaft ihr Hauptträger ist und sich gegenüber den bourgeoisen Kräften den gebührenden Einfluß sichert. Der weitere Aufbau der Wirtschaft wird nur dann rasch vonstatten gehen, wenn die geeinte Arbeiterschaft alle reaktionären Sabotageversuche bricht … Der Frieden wird nur dann gesichert sein, wenn die konsequenteste Friedenskraft, nämlich die Arbeiterklasse im Bunde mit allen Schaffenden, das Schicksal der Nation meistert.“?
Der Leitgedanke der Richtlinien war, die Hegemonie der Arbeiterklasse auf allen Gebieten der Wiitschaftspolitik — auf denen der Organisation der Produktion, der Wirtschaftslenkung, der Sozialpolitik und des Arbeitsrechts, des Einsatzes von Werktätigen in Leitungsfunktionen sowie der restlosen Säuberung der Wirtschaftsleitungen von Faschisten und Kriegsverbrechern — durchzusetzen und auszubauen. Die Mitbestimmung und die Kontrolle durch die Gewerkschaften und Betriebsräte galt es zu erweitern.
Die KPD ging davon aus, daß den Kriegsund Naziverbrechern bzw. dem Monopolkapital die Verfügungsgewalt über die entscheidenden Produktionsmittel bereits weitgehend entzogen war. Zur Grundaufgabe wurde die entschädigungslose Enteignung der Naziund Kriegsverbrecher, des Monopolkapitals und der Großbanken.
Die KPD sprach sich dafür aus, schrittweise mit einer demokratischen Wirtschaftsplanung zu beginnen, um den Wiederaufbau der Wirtschaft und die Entwicklung der Produktivkräfte zu beschleunigen. Dazu umriß sie die nächsten Ziele und Schritte sowie die politischen und organisatorischen Voraussetzungen.
Walter Ulbricht bekräftigte zugleich in seinem Schlußwort, daß die generelle Abschaffung des Privateigentums an Produktionsmitteln nicht auf der Tagesordnung stand, und betonte: „Den privaten Unternehmern bleiben noch große Möglichkeiten. Erstens deshalb, weil sich die Wirtschaftsplanung nicht auf alle Betriebe erstrecken wird und gegenwärtig erstrekken kann; zweitens, weil der Privatunternehmer, auch der, der Produktionsaufträge bekommt, darüber hinaus noch die Möglichkeit hat, für den freien Markt zu produzieren.“?* Allerdings sollten die privaten Unternehmer durch Produktionsauflagen, steuerliche Belastungen, Begrenzung der Gewinne, Kontrolle der Preise sowie Produktionskontrolle und Mitbestimmung durch die Gewerkschaften und Betriebsräte Beschränkungen unterliegen.
Die von der KPD unterbreiteten Vorschläge orientierten auf die Wiederherstellung der wirtschaftlichen und politischen Einheit Deutschlands und die Demokratisierung der Wirtschaft auch in den Westzonen. Sie waren ein wichtiger Beitrag der KPD zur Verständigung mit der SPD über ein gemeinsames Wirtschaftsprogramm.
Der tagtägliche Kampf gegen Hunger und Not. Die Entstehung der Volkssolidarität
Seit Frühherbst 1945 trieben die antifaschistisch-demokratischen Kräfte die Enttrümmerungsund Wiederaufbauarbeiten in den Städten und Gemeinden auch unter dem Aspekt voran, für den kommenden Winter gerüstet zu sein. So fand in Chemnitz schon am 4. August auf Initiative der KPD ein erster freiwilliger Arbeitseinsatz statt, an dem sich unter der Losung „Heraus aus den Trümmern!“ 11000 Einwohner beteiligten. Ende Oktober nahmen an solchen Aktionen schon an die 46000 Menschen teil. Auf einer Mitte September abgehaltenen Konferenz beschloß der Berliner Bauarbeiterverband ein Notprogramm, in dem sich die Bauleute das Ziel setzten, vor allem Dächer zu reparieren und Wohnungen für den Winter herzurichten. Die KPD-Bezirksleitung Berlin forderte am 22. September die Bevölkerung der Hauptstadt zu freiwilligen Arbeitseinsätzen dafür auf.
Ende September erweiterte sich das Aktionsfeld. Verwaltungen und Massenorganisationen setzten ihre gesamten organisatorischen und sozialpolitischen Fähigkeiten ein, um während der kalten Jahreszeit durch eine differenzierte Versorgungspolitik und geeignete Spezialmaßnahmen die Entbehrungen der Bevölkerung in erträglichen Grenzen halten zu können. In Thüringen einigten sich am 27. September die im antifaschistisch-demokratischen Block zusammenwirkenden Parteien, über ihre Ortsorganisationen zur freiwilligen Hilfe für die vom Krieg besondes betroffenen Bevölkerungsgruppen aufzurufen. Wenige Tage später orientierte ein offener Brief der KPD-Bezirksleitung die Werktätigen aller Wirtschaftsbereiche darauf, mit einem eigenständigen Fürsorgeprogramm gegen die bevorstehende Wintersnot anzugehen. Im Oktober schlossen sich die Landesverwaltung sowie die evangelische und die katholische Kirche Thüringens dieser Kampagne der politischen Parteien an. Auf einer gemeinsamen Beratung riefen sie die „Thüringen-Aktion gegen die Not“ ins Leben. Auch in den anderen Ländern und den beiden Provinzen vereinigten sich die unterschiedlichsten Kreise der Bevölkerung unter der Losung „Volkssolidarität gegen Wintersnot“ zu entsprechenden Aktivitäten, in der Provinz Sachsen nach der Devise „Einheit und Aufbau für Volk und Heimat“ und in Mecklenburg-Vorpommern unter dem Motto „Heimat und Arbeit“.
Diese vorbeugende Fürsorge erwies sich als bitter notwendig, waren doch Ende 1945/Anfang 1946 die durch den Krieg ausgelösten Binnenwanderungen noch in vollem Gange. Evakuierte und Flüchtlinge strebten in ihre Heimatorte zurück. Hunderttausende sogenannte „displaced persons“ — ehemalige von den Nazis Zwangsverschleppte aus allen Ländern Europas — wollten nach Hause. Heimkehrer befanden sich auf dem Weg zu ihren Familien oder suchten nach überlebenden Angehörigen. Die Umsiedlungen hatten begonnen. Im Juli 1945 war zwar der erste offizielle Fahrplan der Deutschen Reichsbahn in Kraft getreten, doch verzeichnete dieser wegen zerstörter Brücken und Viadukte noch manche Fußmarschstrecke. Das Fehlen von Waggons und Lokomotiven bewirkte, daß die umherziehenden Männer, Frauen und Kinder oft zu Fuß oder mit ländlichen Gespannen aller Art unterwegs waren. Hatten 1939 etwa 15 Millionen Menschen auf dem Territorium der Länder und Provinzen der sowjetischen Besatzungszone gelebt, so waren es Ende 1945 schon mehr als 16 Millionen. Sie alle wollten ernährt und untergebracht werden. Doch die Ernte des Jahres 1945 war eine der schlechtesten der letzten Jahrzehnte.
Menschentrauben auf der Eisenbahn
Eine kontinuierliche Versorgung der Bevölkerung konnte nur über ein differenziert ausgearbeitetes System der rationierten Zuteilung von Lebensmitteln und Industriewaren geregelt werden, das in den Jahren von 1945 bis 1948 den Charakter der Vollrationierung trug und erst danach schrittweise abgebaut wurde. Bis zum 1. November 1945 erfolgte die Versorgung auf Karten nach Versorgungsplänen der Länder und Provinzen. Danach wurde eine einheitliche Lebensmittelkarte mit monatlicher Geltungsdauer für die gesamte Ostzone eingeführt. Diese umfaßte Brot-, Fett-, Nährmittelund Fleischmarken. Daneben wurden bald noch Kartoffelund Gemüsekarten, Raucherkarten, Seifenmarken, Kohlenkarten sowie Sonderkarten
„Kartoffelnstoppeln“
eingeführt, auf die Kinder und werdende Mütter Milch erhielten. Oft standen aber nur Austauschprodukte zur Verfügung. Statt Fleisch beispielsweise mußten dann andere eiweißhaltige Lebensmittel, wie Eier, Eipulver, Käse oder Quark, abgenommen werden, anstelle von Zucker Marmelade. Brot konnte durch Zwieback oder Mehl ersetzt werden, 1 Kilogramm Kartoffeln oder Gemüse durch 150 Gramm Trockenkartoffeln oder Trockengemüse. Besonders verhaßt als Ersatzlebensmittel war Salzgemüse, das in manchen Orten sogar eingesalzene Rübenblätter einschloß. Auf sogenannten „freien Märkten“ wurden in geringen Mengen und keineswegs regelmäßig Obst und Gemüse verkauft.
Die Lebensmittelkarten galten nur im jeweiligen Ausgabekreis. Für Dienstreisende und im Transport Tätige gab es Reisemarken mit längerer Laufzeit und Gültigkeit für die gesamte Ostzone sowie Transportlebensmittelkarten, die wiederum nur auf Grund einer von der Heimatkartenstelle alle zwei Monate zu verlängernden besonderen Bescheinigung ausgegeben wurden. Reisemarken gab es nur für Reisen, die länger als 48 Stunden dauerten, was vom Betrieb oder der Gemeinde bescheinigt werden mußte. Teilnehmer an einer Gemeinschaftsverpflegung mußten dies der Kartenstelle mitteilen und erhielten einen besonderen Verpflegungsschein.
Ab Oktober 1945 wurden die Rationen nach folgenden Gruppen festgelegt: Gruppe eins — Schwerstarbeiter, Gruppe zwei — Schwerarbeiter, Gruppe drei — Arbeiter, Gruppe vier — Angestellte, Gruppe fünf — Jugendliche bis zu 15 Jahren, Gruppe sechs sonstige Bevölkerung einschließlich der Hausfrauen und Arbeitslosen. Gleichzeitig erfolgte eine regionale Differenzierung. Bewohner von Großstädten erhielten etwas höhere Rationen als die Bewohner der übrigen Gemeinden, die größere Möglichkeiten einer Eigenversorgung besaßen. Besitzer bäuerlicher Betriebe galten als Selbstoder Teilselbstversorger und erhielten entweder gar keine oder nur bestimmte Lebensmittelkarten. Daß die Angehörigen der Gruppe sechs, vor allem jene schwer arbeitenden Hausfrauen, die für Kinder und andere hilfsbedürftige Angehörige zu sorgen hatten, zunächst weder Fett noch Fleisch bekamen, wurde als große Härte empfunden. Lediglich die arbeitsuchenden Arbeitslosen in den Großstädten waren von dieser Regelung ausgenommen. Ab 1. Dezember 1945 empfingen dann alle Angehörigen der Gruppe sechs geringe Fleischund Fettmengen, die aber weit unter den Normen der oberen Gruppen blieben.
Gemüseanbau auf Trümmern, 1946
Die Lebensmittelrationierung bedeutete in den ersten Nachkriegsjahren auch Bindung an bestimmte Verkaufsstellen und Einzelhändler, bei denen man sich zumindest für die Dauer eines Monats anmelden mußte. Dadurch entstanden vor allem in kleineren Orten — gewisse Abhängigkeiten. Dem wurde mit dem Wiederaufbau der Konsumgenossenschaften entgegengewirkt, die Mitte 1946 in der Ostzone und im sowjetischen Sektor von Berlin über 4574 Verkaufsstellen verfügten. Sie und die Einzelhändler waren angewiesen, erhaltene Lebensmittelkartenabschnitte genau abzurechnen, um Unterschleife und Schiebungen zu vermeiden.
Bei Verlust der Lebensmittelkarten erfolgte kein Ersatz, lediglich für davon betroffene Kinder gab es gewisse Ausnahmeregelungen. Die immer wieder vorkommenden Lebenmittelkartendiebstähle konnten daher ganze Familien ins Unglück stürzen und dem Hungertod nahe bringen. Lebensmittelkartenfälschungen gehörten zur Alltagskriminalität.
Aus Zusammenstellungen über die Ernährungssituation in den einzelnen Zonen ging hervor, daß 1945/46 die Kartenempfänger Zuteilungen erhielten, die pro Kopf und Tag in den einzelnen Monaten zwischen 800 und 1300 Kalorien schwankten. So erhielten die Einwohner Sachsens 1946 im Durchschnitt 1214 Kalorien pro Tag und kamen damit auf etwa 39 Prozent des Vorkriegsverbrauchs.
Die Belieferung erfolgte im ersten Nachkriegswinter sehr häufig unregelmäßig und mit Austauschprodukten. Die Qualität der Lebensmittel war vielfach schlecht. Die antifaschistischen Verwaltungen bemühten sich, die verfügbaren Produkte gerecht und leistungsstimulierend zu verteilen. Daher bildeten die Schwere und eventuelle gesundheitsschädigende Wirkungen der Arbeit, aber auch deren Bedeutung für den antifaschistisch-demokratischen Neuaufbau die wesentlichen Kriterien für die Höhe der Zuteilung.
Indes reichten die ausgegebenen Lebensmittelmengen nicht, um die verausgabten Kräfte zu substituieren. Damit war ständig gesellschaftlicher Konfliktstoff gegeben. Die meisten griffen in der einen oder anderen Weise zur individuellen Selbsthilfe. Scharen ausgemergelter Städter durchstreiften Wälder und Wiesen, um Beeren, Pilze, Bucheckern, Eicheln oder wenigstens Wildgemüse zu sammeln, oder verbrachten Tage und Nächte in oder sogar auf hoffnungslos überfüllten Zügen, um auf dem Lande zu hamstern, zu tauschen, die abgeernteten Felder nach Kartoffeln und Rüben zu durchwühlen oder Ähren zu lesen. Felddiebstähle waren an der Tagesordnung, so daß die Dörfler Wachen aufstellten und mit Hunden und Knüppeln dagegen vorgingen.
Wer es irgendwie vermochte, hegte und pflegte Gemüse, Salat, Tomaten und Tabak auf dem Balkon, in Vorgärten oder auf brachliegenden Flecken inmitten der Ruinen. Kaninchenund Hühnerhaltung nicht nur in Gärten und Lauben, sondern auch in Kellern und auf Balkonen war keine Seltenheit. Die Verwaltungen förderten solche Aktivitäten, indem sie Brachland, Grünanlagen und Plätze zum Gemüseund Kartoffelanbau freigaben. Im Berliner Tiergarten und auf dem Alexanderplatz gediehen Kohl und andere Gemüsearten, vor der Universität weideten Kühe. Betriebe versuchten, durch Tauschund Kompensationsgeschäfte eine zusätzliche Versorgung ihrer Belegschaften zu sichern. Geschäftstüchtige Bauern nutzten die Zwangslage der Städter und tauschten Lebensmittel gegen Industriewaren oder Wertgegenstände aus dem Besitz der Stadtbewohner. Die zeitgenössische Redensart, daß einer bestimmten Kategorie von Bauern nur noch der Teppich im Kuhstall fehle, hatte einen durchaus rationellen Kern.
In der Hauptsache war die Ernährung nach dem Kriege vegetarisch. Das wohl wichtigste Gericht bildete in Familie und Gemeinschaftsverpflegung die Suppe, die oft eine Vielzahl unterschiedlichster Lebensmittel zu einer einigermaßen schmackhaften Mahlzeit vereinte. Eintöpfe ließen sich außerdem bei Strommangel in der Kochkiste oder im Federbett am besten warmhalten. Vielen ging es in erster Linie auch gar nicht um den Nährwert der Suppe, sondern um deren Menge, die den hungrigen Magen beruhigen sollte. Neben den schwachen, ausgemergelten Nachkriegsgestalten waren es daher vor allem die aufgedunsenen und aufgeschwemmten Menschen mit geringer Leistungsfähigkeit, die den Angehörigen des Gesundheitswesens Sorge bereiteten. In manchen Gegenden der Ostzone wurden für sie sogar spezielle Ödemberatungsstellen eingerichtet. Oft genug trugen Werktätige als Frühstück nur trockenes Brot bei sich, das vor dem Essen nach Möglichkeit geröstet wurde. In den Familien kamen Ersatzlebensmittel aller Art auf den Tisch — in Wasser oder Milch aufgelöste Bierhefe mit Majoran als falsche Leberwurst, Kakao aus getrockneten roten Rüben, Mehl aus getrockneten Eicheln oder Kartoffelschalen, Marmelade aus Tomaten und Mohrrüben. Die Leuna-Werke produzierten monatlich 10000 Kilogramm Leunawurst, eine Mischung aus Melasse und Nährhefe. Wer sich vom Lande Zuckerrüben besorgen konnte, kochte im Waschkessel oder in großen Pfannen Rübensirup. Aus Malz-Kaffee-Ersatz wurde Kuchen gebacken. In vielen Zeitungen und Zeitschriften gaben Ernährungswissenschaftler Hinweise über die Zubereitung von Notund Spargerichten. Diese reichten bis zu Rezepten für das Zubereiten von Mahlzeiten aus erfrorenen Kartoffeln.
Betreuung alter und kranker Frauen durch Mitglieder von antifaschistischen Frauenausschüssen, 1945
Alle besonderen Genüsse blieben dem „Normalverbraucher“ verwehrt, es sei denn, er konnte sich hin und wieder Alkolat, ein alkoholähnliches Getränk, Schlagcreme eine Art Schaumspeise —, aus Punscharoma hergestellte Heißgetränke oder Dünnbier leisten. Zu den erreichbaren, aber gesundheitlich problematischen Freuden gehörte die Zigarette. Es wurde allgemein üblich, eigene und fremde Zigarettenkippen zu sammeln, um aus den Tabakresten neue Zigaretten zu drehen. Auch um den Pfeifentabak „Marke Eigenbau“ kreiste das Denken so mancher Raucher.
Am meisten gefährdet waren unter diesen Bedingungen Kinder, alte Menschen und Kranke in den kälteren Monaten ganz besonders. 1945 überlebten von 1000 Neugeborenen 163, 1946 noch immer 131 nicht die ersten Lebenswochen. Allein in Berlin starben im Herbst 1945 68 Prozent aller Säuglinge. Als Todesursachen wurden zumeist Frühgeburt bzw. angeborene Lebensschwäche genannt. Doch fehlte es auch an Windeln und vor allem an geeigneten Nährmitteln, im ersten Nachkriegsjahr sogar an Milch. Im November 1945 wurde beispielsweise aus Mark Brandenburg berichtet, daß in Eberswalde 8 Milchkühe auf 36000 Einwohner und in Frankfurt an der Oder 15 Milchkühe auf 45000 Einwohner kämen. Maxim Zetkin, seit November 1945 erster Vizepräsident der DZV für das Gesundheitswesen, sah im Milchmangel sogar die Hauptursache für die hohe Kindersterblichkeit. In einzelnen Gemeinden wurden Mütterberatungsstellen eingerichtet. Sie konnten die Situation zwar nicht grundsätzlich ändern, trugen aber doch zur Senkung der Sterblichkeitsziffern bei und wurden allmählich zu wichtigen Stützpunkten der Säuglingsfürsorge.
Nicht weniger litten die oft unterernährten Schulkinder unter den Nöten der Zeit. Sie waren in die schwierige Alltagsbewältigung einbezogen und hatten vielerlei Aufgaben für die Familie zu erledigen, die sie so manches Mal vom Unterricht fernhielten. Auch sie mußten aufs Land gehen und Nahrungsmittel beschaffen, hatten nach Bezugsscheinen oder Lebensmitteln anzustehen oder auf ihre Geschwister aufzupassen, während sich die Mütter auf Hamsterfahrten befanden. Aber auch unzureichende Bekleidung und körperliche Schwäche hinderten viele am Schulbesuch. Aus den verschiedensten Gründen waren Minderjährige während dieser Jahre in einem solchen Umfang mit Erwerbstätigkeit befaßt, daß sich die Deutsche Verwaltung für Arbeit und Sozialfürsorge veranlaßt sah, Kontrollen durchzuführen. Meist arbeiteten Halbwüchsige in Kleinbetrieben für ein zusätzliches Mittagessen, das als Entlohnung verabreicht wurde. Als geradezu selbstverständlich galt Kinderarbeit noch immer in der Landwirtschaft, zumal viele Betriebe von alleinstehenden Frauen geführt wurden, die auf jede helfende Hand angewiesen waren.
Besonders gefährdet waren die vielen Kriegswaisen. Kinder von zwei oder drei Jahren ließen sich relativ einfach bei Pflegeeltern unterbringen. Dagegen wurden Kinder im Alter von 6 bis 14 Jahren von diesen oftmals zurückgebracht, weil sie vor allem dann Erziehungsschwierigkeiten bereiteten, wenn sie schon lange Zeit allein und verwahrlost gewesen waren. Bürgermeister und Landräte sorgten vielerorts für die Einrichtung von Waisenhäusern. Ein Kindersuchdienst bemühte sich, in den Wirren des Krieges getrennte Familien wieder zusammenzuführen. Es waren die Teilnehmer einer Arbeitsberatung des im Juni gegründeten Berliner Hauptausschusses „Opfer des Faschismus“, die am 7. Oktober 1945 in ihrem Winterprogramm die Forderung erhoben: „Rettet die Kinder!“ Im Laufe des Oktobers 1945 gewann der Ausschuß einen größeren Kreis von maßgeblichen Persönlichkeiten des politischen, kulturellen und kirchlichen Lebens sowie den Berliner Magistrat für diese zutiefst humanistische Aufgabe. Ein Ehrenpräsidium, welchem neben Repräsentanten des antifaschistisch-demokratischen Blocks auch Johannes R. Becher, Bernhard Kellermann, Ernst Legal, Paul Wegener und der Pfarrer Peter Buchholz angehörten, richtete am 24.Oktober 1945 einen Aufruf zu Hilfsmaßnahmen für Kinder an die Öffentlichkeit, der in Berlin und in der gesamten Ostzone eine große Resonanz fand. Am gleichen Tag unterbreiteten die Deutsche Verwaltung für Arbeit und Sozialfürsorge, die Deutsche Zentralverwaltung für das Gesundheitswesen, die Deutsche Verwaltung für Volksbildung und die Zentralverwaltung für deutsche Umsiedler in einer Verlautbarung konkrete Vorschläge zum Schutz von Kindern vor der Nachkriegsnot. In allen Ländern und Provinzen der sowjetischen Besatzungszone wurden Hilfsaktionen realisiert. Antifaschistische Frauenund Jugendausschüsse sammelten Kleidungsstücke und Spielsachen, sorgten für zusätzliche Kinderspeisung und Wärmestuben oder bastelten Geschenke für die erste Friedensweihnacht. Diese von breiten Kreisen der Bevölkerung getragene und von der SMAD unterstützte Aktion half zahllosen Kindern zu überleben, nicht zuletzt weil sie auch Freude und menschliche Wärme vermittelte. Manches Umsiedlerkind konnte in den Weihnachtstagen ein Spielzeug, ein paar Süßigkeiten oder ein Kleidungsstück aus Spendengütern erhalten und erlebte festliche Stunden. Schon im März 1946 wurden Städte und Gemeinden im Ergebnis dieser Erfahrungen aufgefordert, für den kommenden Feriensommer eine örtliche Erholungsfürsorge für Kinder ins Leben zu rufen.
Suchdienstpavillon in Leipzig
Weihnachtsfeier für elternund heimatlose Kinder, 1945
Beim Anstehen nach Wurstbrühe
Neben den Kindern beanspruchte die Gruppe der hochbetagten Menschen, der Kranken und der Schwerbeschädigten besondere Aufmerksamkeit und Hilfe. Doch die Altersheime reichten nicht aus und waren überbesetzt. Die Mittel der Sozialversicherungskassen waren. von den Nazis im zweiten Weltkrieg restlos verpulvert worden. Die antifaschistisch-demokratischen Sozialverwaltungen standen aber vor der Aufgabe, die relativ hohe Zahl alter und invalider Menschen finanziell und materiell zu versorgen. Sie unternahmen in allen Ländern und Provinzen größte Anstrengungen, um wenigstens das existentielle Minimum zu sichern. Da dies aber in der Anfangszeit nicht zu bewältigen war, mußten neben den Angehörigen auch gesellschaftliche Kräfte Fürsorgeleistungen übernehmen. Im Sommer 1945 hatte die SMAD zunächst angeordnet, die Auszahlung aller Arten von Unterstützungen und Pensionen mit Ausnahme der Unterstützungen für nicht mehr arbeitsfähige Personen, die keine anderen Existenzquellen hatten, einstweilen einzustellen. Eine Überprüfung und Neuregelung der Rentenzahlungen wurde angestrebt. In Berlin begann die erste Rentenausgabe an arbeitsunfähige, mittellose Personen, die nicht Mitglieder der NSDAP oder ihrer Gliederungen gewesen waren, am 1.November 1945. Die Rente wurde zunächst — das heißt mit Sicht auf eine Verbesserung der Situation in der bisherigen Höhe gewährt, bis auf weiteres jedoch durfte der ausgezahlte Betrag für alleinstehende Personen nicht höher als 5S0ORM monatlich, für Hilflose nicht höher als 75RM monatlich liegen. Die Länder und Provinzen regelten ihre Rentenzahlungen entsprechend ihren regionalen Bedingungen — wobei die Höchstgrenze bei 90 RM lag. Dadurch gab es längere Zeit Unterschiede in den Rentenzahlungen.
Während der Wintermonate boten Wärmehallen Greisen und Versehrten einen gewissen Schutz vor der Kälte. Volksküchen verabreichten warme Mahlzeiten. Der Brennstoffmangel machte den älteren Bürgern schwer zu schaffen. Während sich die arbeitsfähige Bevölkerung mit legalen und illegalen Mitteln zu helfen wußte, die vom Holzsammeln und Stubbenroden über das Fällen von Bäumen bis zum Kohlendiebstahl auf den Verladebahnhöfen reichten, waren sie auf Hilfe angewiesen. Vor allem die Jugendausschüsse nahmen sich dieser Aufgabe an. In Dessau etwa besorgten sie zur Unterstützung der älteren Bürger 1800 Festmeter Holz. Ähnliche Aktivitäten gab es auch in anderen Städten. Viele ältere Bürger trugen unter den schweren Nachkriegsbedingungen durch produktive Tätigkeiten und Hilfsleistungen aber auch selbst zur Sicherung ihrer Existenz bei. Die ältere Frauengeneration leistete beträchtliches bei der Betreuung ihrer Enkel. Durch den zweiten Weltkrieg wurde die historische Entwicklung zur Zweigenerationenfamilie, die sich in Deutschland weitgehend durchgesetzt hatte, zeitweise unterbrochen. Die Not zwang viele Familien — manchmal reine Frauenfamilien — einstweilen wieder in drei Generationen zusammen zu leben. Infolge der Wohnungsnot blieb dieser Zustand in vielen Familien lange erhalten. Allerdings behielt dabei die ältere Generation meist ihren Status als selbständiger Haushalt, und zwar vor allem deshalb, weil bestimmte Warenarten, wie vor allem Kohle, nicht an Personen, sondern an Haushalte geliefert wurden.
Aus den Hilfsaktionen des Winters 1945/46 entstand die große Bewegung der Gemeinschaft „Volkssolidarität“ zur Unterstützung der Armen, Alten, Kranken und der Kinder. Die Früchte dieser Bewegung zeigten sich schon damals überall. In der „ThüringenAktion gegen die Not“ wurden bis Februar 1946 5042000 Mark, 130729 Haushaltsgegenstände und Möbelstücke sowie 265115 Kleidungsstücke gesammelt und an Bedürftige übergeben. Des weiteren waren 235 Nähund 22 Handwerksstuben entstanden und 22 Kindergärten neu eingerichtet worden. Zu den bedeutendsten Leistungen zählte, daß täglich 80000 Kindern eine warme Mahlzeit gereicht werden konnte.
Die Hilfeleistungen der Volkssolidarität dienten in der Nachkriegszeit vorrangig dem Ziel, das Leben und Überleben von Hilfsbedürftigen zu sichern. Daneben versuchte sie schon in diesen Jahren, auch kulturelle Bedürfnisse zu befriedigen, Geselligkeiten zu organisieren, zur Unterhaltung beizutragen und Kunstgenüsse zu vermitteln, um den durch Faschismus und Krieg verstörten Menschen ein Gefühl von Geborgenheit und Hoffnung zu geben.
Entnazifizierung, Demokratisierung und Ausbau der Verwaltungsorgane
Eine der wichtigsten Aufgaben bestand im Herbst 1945 darin, den weiteren Aufsowie Ausbau der Verwaltungsorgane mit deren Säuberung von belasteten Nazis bzw. Demokratisierung zu verbinden und insgesamt die Entnazifizierung konsequent fortzusetzen.
Die weitere Säuberung der Verwaltungen erfolgte gemäß den vom Block der antifaschistisch-demokratischen Parteien beschlossenen „Richtlinien für die Bestrafung der Naziverbrecher und die Sühnemaßnahmen gegen die aktivistischen Nazis“ bzw. entsprechend dem Gesetz Nr.10 und der Direktive Nr.24 des Alliierten Kontrollrates vom 20. Dezember 1945 bzw. vom 12. Januar 1946.
Zunächst konnte der Verwaltungsapparat nur in seinen entscheidenden Teilen und in der Mehrzahl der leitenden Stellungen mit Antifaschisten besetzt werden. Von den insgesamt 228317 Anfang 1946 im Verwaltungsapparat des Landes Sachsen Beschäftigten hatten 131829 bereits vor dem 8.Mai 1945 im öffentlichen Dienst gestanden; von den 1650 direkt bei der Landesverwaltung Sachsen Beschäftigten waren das jedoch nur 387. Ähnlich lagen die Dinge auch in den anderen Ländern bzw. Provinzen. Von den 191 leitenden Angestellten der Provinzialverwaltung Mark Brandenburg gehörten Ende 1945 33 der KPD, 26 der SPD, 19 der CDU und 2 der LDPD an; 92 waren parteilos. Die Mitarbeiter der Landesverwaltung MecklenburgVorpommern waren parteipolitisch wie folgt organisiert: zu 7,8 Prozent in der KPD, zu 23,0 Prozent in der SPD, zu 5,6 Prozent in der CDU; 63,6 Prozent waren parteilos.
Bei der Entnazifizierung und Demokratisierung handelte es sich um einen komplizierten Prozeß, in dem nicht nur die antifaschistisch-demokratischen Parteien mit den fortschrittlichen Kräften in den Verwaltungen unterstützt und kontrolliert von der SMAD eng zusammenwirkten, sondern in den die Bevölkerung auch direkt einbezogen wurde. So erfolgte die Überprüfung aller Bürgermeister in Mark Brandenburg Anfang 1946 durch deren Rechenschaftslegung vor den öffentlichen Gemeindeversammlungen. Allein im Verwaltungbezirk Cottbus wurden danach 37 Bürgermeister abgesetzt — 12 aus politischen Gründen, 6 wegen krimineller Vergehen und 19 wegen fachlicher Unfähigkeit.
In Mark Brandenburg, in Mecklenburg-Vorpommern und im Land Sachsen war die Entnazifizierung der Verwaltungen bis März 1946 weitgehend durchgeführt. In den Verwaltungsorganen verblieben im wesentlichen nur noch solche ehemaligen nichtaktivistischen NSDAP-Mitglieder, die als Spezialisten, wie Ärzte, Apotheker, Techniker, Finanzfachleute, Statistiker usw., unbedingt weiterbeschäftigt werden mußten, wenn andere Fachleute nicht vorhanden waren. In der Provinz Sachsen und vor allem in Thüringen verlief die Entnazifizierung mit einer gewissen Verzögerung. Anfang 1946 war hier noch ein relativ hoher Anteil von Mitgliedern der NSDAP in den Verwaltungen tätig. In Thüringen, wo während der amerikanischen Besetzung in größerem Maße bisherige Beamte als Angestellte übernommen worden waren, machten die ehemaligen NSDAP-Mitglieder im März 1946 noch 17,8 Prozent aller in den Verwaltungsorganen Beschäftigten aus. Bis zum Herbst 1946 gelang es jedoch auch hier, die Aufgabe, den Verwaltungsapparat von belasteten Nazis zu säubern, im wesentlichen zu bewältigen.
Die Säuberung der deutschen Zentralverwaltungen gestaltete sich teilweise noch komplizierter. Den DZV-Präsidenten standen anfangs nur wenige Mitarbeiter zur Verfügung, die Antifaschisten waren. Die Mehrzahl der Mitarbeiter kamen aus den alten Reichsbehörden und aus der kapitalistischen Wirtschaft. Diese Kräfte waren aus den verschiedensten Motiven bereit, in den Zentralverwaltungen zu arbeiten. Die soziale und parteipolitische Zusammensetzung der einzelnen DZV wies Ende 1945/ Anfang 1946 beträchtliche Unterschiede auf. So wurden zum Beispiel in der zahlenmäßig starken Deutschen Verwaltung für Handel und Versorgung im Oktober 1945 nur 11 Mitglieder der KPD beschäftigt. Von den 208 Mitarbeitern der DZV der Brennstoffindustrie waren Ende 1945 nur 5 Mitglieder der KPD und 10 der SPD. Zugleich waren die 10 Direktoren der Hauptabteilungen dieser Zentralverwaltung Beamte mit „altem reaktionärem preußischen Geist“”, wie Fritz Selbmann einschätzte.
Bis zum Herbst 1946 vollzogen sich — vor allem mit der zunehmenden parteipolitischen und gewerkschaftlichen Organisation — auch grundlegende personalpolitische Veränderungen in der Zusammensetzung der meisten Zentralverwaltungen zugunsten der Arbeiterklasse. Zugleich konnte festgestellt werden, daß sich viele der übernommenen bürgerlich-demokratisch orientierten Fachleute bewährt hatten, daß sie loyal und zuverlässig in den Verwaltungsorganen mitarbeiteten. In der Zusammenarbeit mit Spezialisten der SMAD wurden ihr Wissen und ihre Verwaltungserfahrungen in den Dienst des demokratischen Neuaufbaus gestellt.
Um die mit der Entnazifizierung und Demokratisierung der Verwaltungsorgane verbundene Abschaffung des Berufsbeamtentums vollzog sich eine harte Auseinandersetzung. Politiker in CDU und LDPD erhoben die Forderung, den „neutralen Staatsbeamten“ zu erhalten bzw. das Berufsbeamtentum wieder einzuführen. Doch sie konnten die Beseitigung des Berufsbeamtentums, das sich als Instrument und Stütze der politischen Reaktion erwiesen hatte, in der Ostzone nicht verhindern.
Im März 1946 unterbreitete die Parteiführung der KPD Vorschläge für eine einheitliche Struktur der Wirtschaftsabteilungen auf den verschiedenen Ebenen. Danach wurden bei den Landesbzw. Provinzialverwaltungen wie auch in den Verwaltungen der Kreise und kreisfreien Städte die folgenden sieben Abteilungen geschaffen: Allgemeine Planung und Statistik als Koordinierungsabteilung; Industrie; Handel und Versorgung; Landund Forstwirtschaft; Finanzen und Steuern; Verkehr; Arbeitsund Sozialfürsorge. Die Anzahl der Abteilungen und deren Unterstellung wandelten sich jedoch mehrfach. Es war eine Zeit des Suchens nach der günstigsten administrativ-territoriälen Struktur, das zugleich von den schnell wachsenden Anforderungen tangiert wurde.
Insgesamt erwiesen sich die Verwaltungsorgane der antifaschistischen Demokratie bis zum Frühjahr 1946 immer wirkungsvoller als bedeutsames Feld der Zusammenarbeit der ihre Hegemonie durchsetzenden Arbeiterklasse mit ihren Verbündeten und als Hauptinstrumente der Umgestaltung.
Ab Herbst 1945 entstanden bei den Verwaltungen Beiräte, Ausschüsse und Kommissionen der verschiedensten Art, wie Gemeindebzw. Kommunalausschüsse bei den Gemeindevorstehern, Bürgermeistern und Landräten, Ernährungs-, Wirtschafts-, Wohnungs-, Preis-, Haushalts-, Frauenund Jugendausschüsse bzw. -kommissionen sowie Beiräte für Finanzfragen, für das Bauwesen, für den Fürsorgeund Gesundheitsschutz, für kulturelle Fragen, für die Umsiedler und für die Opfer des Faschismus bei den Verwaltungsorganen der Gemeinden, Städte und Kreise.
All diese Ausschüsse waren beratende Organe. Sie setzten sich aus ehrenamtlich tätigen Vertretern der antifaschistisch-demokratischen Parteien und Massenorganisationen, Mitarbeitern der Verwaltungsorgane und anderen Fachleuten und Persönlichkeiten zusammen. Damit verbreiterte sich die demokratische Basis der neuen Selbstverwaltungsorgane, verstärkten sich die Möglichkeiten der Einflußnahme und Kontrolle durch die Bevölkerung.
Die antifaschistisch-demokratischen Blockausschüsse entwickelten und bewährten sich bei der Entnazifizierung, Demokratisierung und beim Ausbau der Verwaltungsorgane.
Der Aufbau einer demokratischen Polizei und der Beginn der Justizreform
In den im Frühjahr und Sommer 1945 in den Kreisen und kreisfreien Städten aller Länder und Provinzen der Ostzone m
it Hilfe der SMAD geschaffenen neuen, demokratischen Polizeiorganen hatten klassenkampferfahrene, bewährte Mitglieder der Arbeiterparteien und aktive Antifaschisten die Mehrheit der polizeilichen Kommandofunktionen inne. Bereits im Herbst 1945 waren etwa 80 Prozent der Angehörigen der Polizei ihrer sozialen Herkunft nach Arbeiter und werktätige Bauern. Ebenso viele waren Ende 1945/Anfang 1946 in der KPD oder der SPD organisiert. Die.neuen Polizeiangehörigen mußten ihre schwierige, mit groBer Verantwortung verbundene Tätigkeit ungenügend ausgerüstet und vorbereitet aufnehmen und waren schwersten Belastungen ausgesetzt. Der Mehrzahl gelang es mit hohem Einsatz, den Anforderungen gerecht zu werden; nicht wenige versagten oder resignierten. Es fehlte an Uniformen, Kraftfahrzeugen und anderen wichtigen Ausrüstungen. Nach dem Erlaß der Direktive Nr. 16 des Alliierten Kontrollrates vom 6. November 1945 konnte die deutsche Polizei zur „Aufrechterhaltung von Recht und Ordnung“ mit Waffen ausgestattet werden.
Abteilungen wurden im Widerstandskampf erprobte Antifaschisten, wie im Land Mecklenburg-Vorpommern Hans Kahle, der im Befreiungskampf des spanischen Volkes die XI. Internationale Brigade befehligt hatte, in der Provinz Mark Brandenburg Artur Dorf, in der Provinz Sachsen Georg König, im Land Sachsen Arthur Hofmann und im Land Thüringen Erich Reschke.
Anfang 1946 entstanden in den Landesund Provinzialverwaltungen Abteilungen Polizei. Leiter dieser Angehörige der Sowjetarmee und Volkspolizisten bei der Ermiittlung von Verbrechen gegen die Menschlichkeit im faschistischen Kriegsgefangenenlager Zeithain, 1946
Durch die Polizeiabteilungen wurden die örtlichen Organe der Schutz-, Verkehrs-, Kriminalund Bahn-. polizei sowie die Verwaltungspolizei und die Berufsfeuerwehr neu gegliedert und einheitlich den Landesbzw. Provinzialpolizeiorganen unterstellt. Mit vielfältiger Hilfe der SMAD konnten in allen Ländern und Provinzen der Ostzone bis Anfang 1946 auch Polizeischulen eröffnet werden.
Trotz aller Schwierigkeiten und Entwicklungsprobleme bewährten sich die Organe der Volkspolizei 1945/46 beim Schutz der Bodenreform, im Kampf gegen das Unwesen krimineller Banden, bei der Aufklärung von Morden und vielfältigen Eigentumsdelikten, beim Zurückdrängen von Schwarzhandel und Spekulation, bei der Entlarvung und Festnahme von Naziund Kriegsverbrechern. Sie setzten sich für eine solche öffentliche Ordnung und Sicherheit ein, die dem Schutz der antifaschistisch-demokratischen Verhältnisse diente. Im Jahr 1946 wurden von den Polizeiorganen des Landes Sachsen 539 Morde, 714 Raubüberfälle, 9592 schwere und 17097 einfache Diebstähle bearbeitet.
Ein so umfassender, sofortiger Neuaufbau, wie er bei der Polizei erfolgte, war hinsichtlich der Justizorgane nicht möglich. Schon die ersten Schritte zur Umgestaltung der Justiz erwiesen sich als eine außerordentlich komplizierte Aufgabe. Die deutsche Justiz hatte jahrzehntelang der imperialistischen Bourgeoisie als ein reaktionäres Klasseninstrument gegen Frieden, Demokratie und sozialen Fortschritt gedient und hatte vor allem während des Faschismus eine ungeheure Schuld auf sich geladen. Kadermäßig war sie ein Hort der Reaktion. Auf dem Territorium der Ostzone hatten vor dem 8. Mai 1945 von den etwa 2500 Richtern und Staatsanwälten 80 Prozent der NSDAP angehört.
Die Arbeiterparteien und die fortschrittlichsten Kräfte in CDU und LDPD hatten sich von Anfang an für eine grundlegende Demokratisierung der Rechtspflegeund Justizorgane eingesetzt. Viele Juristen, die der NSDAP angehört hatten, wurden nicht wieder eingestellt bzw. entfernt. In den ab Sommer 1945 existierenden wiederbzw. neueröffneten Stadtund Kreisgerichten arbeiteten jedoch noch viele nur nominelle NSDAP-Mitglieder oder auch solche bisherigen Richter, Staatsanwälte und andere Mitarbeiter der alten Justiz, die nicht direkt faschistisch belastet waren. Daneben wirkten schon eine geringe Anzahl fortschrittliche, antifaschistische Kräfte. Einzelne Antifaschisten und Demokraten ohne juristische Bildung waren von der SMAD für den Soforteinsatz als Richter und Staatsanwälte berufen worden. Wie das erfolgte, schilderte Luise Kroll: „Am 2. August 1945 wurde ich mit meinem Ehemann und zwei leitenden Genossen der KPD Genthin zum Kreiskommandanten Chernow bestellt, der mir eröffnete: ‚Ab morgen sind Sie Richterin!“ … Meinen Einwand, daß ich nicht die Gesetze und Verordnungen kenne, hörte er sich geduldig an und sagte: ‚Sie sind nicht dumm und werden es lernen‘ … So war ich denn, die bisher nur Hausfrau und ohne erlernten Beruf war, Richterin am Amtsgericht Genthin. Ich lernte bis in die Nacht hinein und bemühte mich, in der Arbeit nicht von den alten Justizinspektoren hereingelegt zu werden.“?’ Doch die Zahl der zum Soforteinsatz Berufenen blieb begrenzt.
Am gründlichsten waren die alten Justizorgane in Mecklenburg-Vorpommern und in der Mark Brandenburg zerschlagen worden. Im Rechenschaftsbericht der Justizabteilung der Provinzialverwaltung Mark Brandenburg vom Juli 1946 hieß es dazu: „Im Verlauf der ersten Monate seit dem Juli 1945 wurden sämtliche Mitglieder der NSDAP und ihrer Gliederungen und sämtliche als reaktionär erkannten Beamten aus der früheren Zeit aus der Rechtspflege ausgeschieden. Erst nachdem dies geschehen war, sind einige wenige frühere Mitglieder oder Anwärter der NSDAP oder ihrer Gliederungen, die nur nominelle Mitläufer waren und insgebeim den Kampf gegen den Nationalsozialismus aufgenommen hatten, nach sorgfältiger politischer Prüfung und mit Genehmigung der SMAD, wieder in den Justizdienst aufgenommen worden. Es handelt sich insgesamt um 12 Personen.“ ?® In der Provinz Sachsen waren etwa die Hälfte und im Land Sachsen noch ein Drittel der Richter und Staatsanwälte ehemalige NSDAP-Mitglieder.
Im Land Thüringen prägten im Herbst 1945 reaktionäre oder zumindest konservative bürgerliche Beamte mit oder ohne Mitgliedsbuch der NSDAP den Charakter der Justiz.
Mit ihrem Befehl Nr. 49 über die Reorganisation des Gerichtswesens in der sowjetischen Besatzungszone vom 4.September 1945 hatte die SMAD, gestützt auf das Potsdamer Abkommen, festgelegt, den faschistischen und reaktionären Einfluß auf die Justiz zu überwinden; aus den Gerichten, der Staatsanwaltschaft und dem Strafvollzug alle Beamten und Mitarbeiter zu entfernen, die in der NSDAP gewesen und für die verbrecherische Strafpolitik des Hitlerregimes mitverantwortlich waren; in allen Ländern und Provinzen aufrechte Demokraten als Richter und Staatsanwälte zu gewinnen; eine antifaschistisch-demokratische Rechtsprechung durchzusetzen und eine einheitliche Struktur des Gerichtswesens zu schaffen. Weitere gesetzliche Grundlagen dafür schufen die Proklamation Nr.3 und das Gesetz Nr.4 des Alliierten Kontrollrates über „Grundsätze für die Umgestaltung der Rechtspflege“ vom 20.Oktober bzw. über die „Umgestaltung des deutschen Gerichtswesens“ vom 30. Oktober 1945.
In der Ostzone wurde unter Leitung der Deutschen Justizverwaltung, an deren Spitze der bekannte bürgerlich-liberale Jurist und Politiker Eugen Schiffer stand, und unter Kontrolle der SMAD die Entnazifizierung der Justiz konsequent und mit Erfolg weitergeführt.
Mit der Entnazifizierung, der Aufhebung der faschistischen Gesetze und der Schaffung neuer Gerichte und Staatsanwaltschaften war die Demokratisierung der Justiz jedoch nicht abgeschlossen. In hartnäckigen Auseinandersetzungen mit Angehörigen der reaktionären und konservativen Justizbürokratie sowie mit Politikern der CDU und der LDPD, die sich dem Einsatz fortschrittlicher Kräfte aus den werktätigen Klassen und Schichten entgegenstemmten, wurde mit der systematischen Ausbildung von Volksrichtern begonnen. Im I. Quartal 1946 nahmen in allen Ländern und Provinzen der sowjetischen Besatzungszone die jeweils 30 bis 40 Teilnehmer des ersten Lehrgangs das Studium auf. Für die kurzfristige Ausbildung von Richtern und Staatsanwälten waren vor allem Antifaschisten gewonnen worden. Sie kamen aus der Arbeiterklasse und anderen werktätigen Klassen und Schichten und verfügten zumeist nur über Volksschulbildung.
Grundlage des Wirkens der neuen Justizorgane war die sich nach 1945 herausbildende antifaschistisch-demokratische Rechtsordnung. Sie beruhte auf verschiedenen Bestandteilen: auf den Rechtsakten der SMAD und des Alliierten Kontrollrates und auf denen der antifaschistisch-demokratischen Verwaltungsorgane sowie auf dem überkommenen, von faschistischen Bestandteilen gereinigten bürgerlichen Recht, wie es insbesondere in Gestalt des Bürgerlichen Gesetzbuches, des Strafgesetzbuches und der Strafund Zivilprozeßordnung vorlag. Die sinngemäße Anwendung des überkommenen bürgerlichen Rechts bzw. seine Weiterentwicklung gemäß den Erfordernissen der antifaschistisch-demokratischen Verhältnisse erwies sich als ein komplizierter, widerspruchsvoller Prozeß, in dem sich immer wieder Auseinandersetzungen mit den Traditionen bürgerlich-formaler Rechtsgleichheit und mit der bürgerlichen Justizpraxis erforderlich machten. Nicht selten kam es zu Urteilen, die sich gegen antifaschistisch-demokratische Maßnahmen richteten.
Zur Herausbildung einer demokratischen Rechtspflege gehörte die auf Befehl Nr. 24 der SMAD vom 25. Januar 1946 bis Mitte dieses Jahres erfolgende Installierung von 110 Arbeitsgerichten. Diese stellten eine Errungenschaft der revolutionären Arbeiterbewegung dar und knüpften an eine in der Weimarer Republik begründete Tradition an. Sie wirkten von den Justizorganen getrennt und waren den Abteilungen für Arbeit und Sozialfürsorge der Landesbzw. Provinzialverwaltungen und den Kreisverwaltungen unterstellt. Der Vorsitzende, dessen Stellvertreter und die Beisitzer wurden jeweils von den Gewerkschaften und den Betrieben des Zuständigkeitsbereiches berufen. Die Vertreter der Arbeiterklasse waren in den Arbeitsgerichten dominierend. Diese klärten Streitigkeiten in bezug auf Tarife, Arbeitsverhältnisse, betriebliche Vereinbarungen, Arbeitsbedingungen und den Gesundheitsschutz. Allein 1946 behandelten sie in der Ostzone etwa 10200 Streitfälle.
Erste entscheidende Schritte zur antifaschistisch-demokratischen Erneuerung der deutschen Kultur
- 1 Erste entscheidende Schritte zur antifaschistisch-demokratischen Erneuerung der deutschen Kultur
- 1.1 Wege der geistigen Faschismusbewältigung
- 1.2 Der Beginn der antifaschistisch-demokratischen Schulreform
- 1.3 Der Beginn der demokratischen Hochschulreform
- 1.4 Die Künste am Beginn der antifaschistisch-demokratischen Umgestaltung
- 1.5 Freizeitgestaltung nach dem Krieg
Wege der geistigen Faschismusbewältigung

Unter dem Trauergeläut der Berliner Kirchenglocken und den Klängen des Trauermarsches von Frédéric Chopin versammelten sich am 9. September 1945 Tausende Antifaschisten der Hauptstadt gemeinsam mit Abordnungen aus allen Stadtbezirken und Betrieben sowie der gesamten Ostzone zu einer imposanten Manifestation im Sportstadion von Neukölln, um der Millionen Menschen zu gedenken, die in den Konzentiationslagern und Zuchthäusern der faschistischen Diktatur den Tod gefunden hatten. Nach den blutigen Jahren des Naziregimes trugen nun überlebende Widerstandskämpfer ihre blau-weiße Häftlingskleidung mit dem roten Winkel als ein Ehrenkleid und zeugten so von der Kühnheit und dem Opfermut der deutschen und internationalen Widerstandsbewegung. Oberbürgermeister Arthur Werner, Verfolgte des Naziregimes wie Ottomar Geschke und Maria Wiedmair sowie Kulturschaffende Berlins sprachen eindringliche Worte des Gedenkens. Diese erste Berliner Massenkundgebung sowie gleichartige Veranstaltungen in anderen Städten, die eine antifaschistische Tradition begründeten, gestalteten sich zu aufrüttelnden Aktionen für Antifaschismus und Demokratie und förderten die geistige Auseinandersetzung mit dem Faschismus.
Dennoch erwiesen sich die Klärungsprozesse als langwierig und kompliziert. Nach den ersten Monaten gesellschaftlichen Neuaufbaus zeichnete sich ab, daß zur antifaschistisch-demokratischen Erneuerung der Kultur schwierige und vielgestaltige Aufgaben gehörten. Diese beinhalteten tiefgreifende Veränderungen und Umwälzungen sowohl in den kulturellen Herrschaftsverhältnissen als auch in den klassischen Bereichen der Geisteskultur wie Bildung, Wissenschaft und Künste, betrafen aber letztlich die gesamten Bedingungen des menschlichen Zusammenlebens und der Persönlichkeitsentwicklung, somit auch den künftigen Stellenwert von Kultur und Lebensweise der arbeitenden Klassen und Schichten.
Im Zentrum der Bemühungen um einen neuen, demokratischen Lebensstil des deutschen Volkes mußte zunächst die Auseinandersetzung mit der faschistischen Ideologie und den von ihr geprägten Denkund Verhaltensmustern stehen. Dies entsprach auch den Direktiven der Alliierten. Obwohl deutsche Antifaschisten diesen Kampf mit großer Beharrlichkeit führten, steckten Antikommunismus, nationaler Dünkel, Rassismus — insbesondere Antisemitismus -, extremer Militarismus und andere Überreste der Naziideologie noch lange in vielen Köpfen. Zur Hinterlassenschaft von Krieg und Faschismus gehörte auch, daß in der unmittelbaren Nachkriegszeit ein Menschenleben nur wenig galt. Allein in Mark Brandenburg wurden von Juli bis Dezember 1945 nach unvollständigen Statistiken 299 Morde begangen. Roheit, Rücksichtslosigkeit und Gewalt stellten im Leben der Nachkriegsgesellschaft alltägliche Erscheinungen dar. Eine Tendenz zur Verwilderung breiter Bevölkerungskreise war nicht zu übersehen.
Straßenanschlag anläßlich einer Großkundgebung zu Ehren der Opfer des Faschismus in Leipzig, September 1945
Die KPD trug dem ideologischen Gebot der Stunde Rechnung. Eine Erweiterte Tagung ihres Sekretariats im September 1945 befaßte sich eingehend mit den inhaltlichen Aufgaben der Bereiche Agitation und Propaganda. In ihren Referaten begründeten Fred Oelßner und Paul Wandel die Notwendigkeit einer systematischen Aufklärung über den barbarischen Charakter der faschistischen Rassenlehre und der Lebensraumtheorien. Die Tagung bekräftigte, daß chauvinistischen und militaristischen Denkhaltungen sowie antikommunistischen und antisowjetischen Ressentiments mit aller Konsequenz begegnet werden sollte und daß im Bewußtsein der Massen kämpferischer Antifaschismus und die Bereitschaft zum demokratischen Handeln zu entwickeln waren. Arbeiten ausländischer Marxisten unterstützten die Auseinandersetzung mit der faschistischen Weltanschauung. Noch 1945 erschien in der Zeitschrift „Aufbau“ ein Artikel des ungarischen Philosophen Georg Lukäcs „Der Rassenwahnsinn — ein Feind des menschlichen Fortschritts“, der sich mit den ideologischen Grundlagen des Faschismus auseinandersetzte. Auch die SPD betonte auf einer Kulturkonferenz im Herbst 1945 die Notwendigkeit eines geistig-kulturellen Umbruchs, der die Ausmerzung der faschistischen Irrlehren zum Inhalt haben sollte. Zugleich wirkten die revolutionäre Arbeiterbewegung und andere bewußte antifaschistische Kräfte für progressive gesellschaftliche Wertsetzungen, für kämpferischen Humanismus und soziale Gerechtigkeit, Völkerverständigung und Frieden. Durch diese engagierten ideologischen Bemühungen im Verein mit praktischer Lebenshilfe konnte der allgemeinen geistigen Verwirrung, der Richtungslosigkeit sowie der Demoralisierung breiter Bevölkerungsschichten entgegengearbeitet und die vielerorts zutage tretende Gefahr der Anarchie sowie zunehmender Kriminalität zurückgedrängt werden. Immer mehr Menschen verstanden, daß gesellschaftliche Umwälzungen notwendig waren.
Vor allem kam es darauf an, die Arbeiterklasse politisch handlungsfähig zu machen. Es galt, an die progressiven Traditionen und den Antifaschismus der Arbeiterbewegung anzuknüpfen, das weitgehend verschüttete Klassenbewußtsein der Arbeiter freizulegen, zu stärken und die Arbeiterklasse wieder mit wissenschaftlichen Kenntnissen über ihre historische Mission auszurüsten. Der Verlag Neuer Weg, der Parteiverlag der KPD, stellte dafür wichtige Werke des Marxismus-Leninismus bereit, darunter das „Manifest der Kommunistischen Partei“, das auch im sozialdemokratischen Parteiverlag erschien, W. I. Lenins Schriften „Was tun?“, „Der Imperialismus als höchstes Stadium des Kapitalismus“ und „Der ‚linke Radikalismus‘, die Kinderkrankheit im Kommunismus“ sowie Friedrich Engels’ Arbeit „Die Entwicklung des Sozialismus von der Utopie zur Wissenschaft“. Endlich konnten die Arbeiten der Klassiker des wissenschaftlichen Sozialismus im Ursprungsland des Marxismus wieder ohne Lebensgefahr verbreitet, gelesen und in den Dienst der antifaschistischen Aufklärung gestellt werden.
Ab Herbst 1945 rückten immer stärker die theoretische Analyse des Faschismus, die Frage nach den gesellschaftlichen Ursachen für die faschistische Katastrophe und damit nach den Schuldigen und der besonderen Verantwortung des deutschen Volkes in das Zentrum geistiger Klärungsprozesse. So lag der inhaltliche Schwerpunkt der 30 Themen, die die KPD vom Sommer 1945 bis zum Frühjahr 1946 während ihrer wöchentlichen Schulungsabende behandelte, auf der Auseinandersetzung mit dem Wesen bzw. den Klassenwurzeln des Faschismus sowie mit seiner Ideologie, deren geistige Quellen zum Teil schon seit Ende des 19. Jahrhunderts als Bestandteile der Ideologie der reaktionärsten und aggressivsten Klassenkräfte in Deutschland wirksam waren. Die historische Notwendigkeit der Beseitigung des deutschen Imperialismus auf dem Wege einer antifaschistisch-demokratischen Umwälzung wurde wissenschaftlich begründet. Dazu leistete auch Walter Ulbrichts 1946 publizierte Schrift „Die Legende vom ‚deutschen Sozialismus‘. Ein Lehrbuch für das schaffende Volk über das Wesen des deutschen Faschismus“ einen wichtigen Beitrag.
Die SPD setzte sich in ihrer Schulungsarbeit ebenfalls mit der Problematik „Zwölf Jahre Naziherrschaft und ihre Folgen“ auseinander, untersuchte die Entwicklung der Nazibewegung und enthüllte den betrügerischen Charakter ihrer sozialen Demagogie. Die sozialökonomische Bestimmung des Faschismus fiel Mitgliedern der SPD aber oft schwer. Von um so gröBerer Bedeutung waren daher Otto Grotewohls Versuche einer „klassenpolitischen Deutung“ in seiner Rede vor Funktionären der SPD im September 1945, in welcher er feststellte, daß die klassenpolitische Wirkung der Machtergreifung von 1933 „in der Beseitigung der Demokratie als der Voraussetzung der Existenz einer organisierten Arbeiterklasse und in der Errichtung einer Diktatur der hochkapitalistischen Bourgeoisie in den Formen des hitlerischen Cäsarismus und des sogenannten deutschen Sozialismus“ bestanden habe, die er als „Masken hochkapitalistischer Diktaturmethoden“ kennzeichnete.® Zu klassenmäßigen Faschismusauffassungen gelangte auch Max Fechner in seiner an einen breiten Leserkreis gerichteten Schrift „Wie konnte es geschehen?“.
Gefördert wurden materialistisches Geschichtsdenken und Auseinandersetzungen mit dem Faschismus auch durch die Arbeit mit den von der KPD im Frühjahr 1945 entwickelten „Richtlinien für den Unterricht in deutscher Geschichte“, die, als Grundlage der Parteischulung der KPD genutzt, ein wissenschaftliches Bild vom reaktionären Preußentum, von der Novemberrevolution und von anderen Erscheinungen und Ereignissen der deutschen Geschichte sowie auch Erfahrungen der Großen Sozialistischen Oktoberrevolution vermittelten. Die freien Gewerkschaften brachten seit August 1945 Schulungsund Referentenmaterialien heraus, die die Potsdamer Beschlüsse erläuterten und Grundfragen gewerkschaftlicher Arbeit in der neuen, revolutionären Demokratie erörterten. Bildungskurse setzten sich auf wissenschaftlicher Grundlage mit dem Wesen des Nazismus auseinander. Ähnliche ideologische Aktivitäten entwickelten alle antifaschistisch-demokratischen Parteien im Rahmen ihrer Programme, aber auch andere gesellschaftliche Organisationen und kulturverbreitende Institutionen. So diskutierten Jugendliche auf Initiative der Jugendausschüsse unter anderem über das Thema „Warum sind wir Antifaschisten?“, über Heinrich Heine und über den Reichstagsbrand von 1933.
Die SMAD sah es als ihre politisch-ideologische Hauptaufgabe an, „die faschistische und imperialistische Ideologie im Bewußtsein der Menschen zu überwinden“, wobei sie anstrebte, daß diese Aufgabe „zur Angelegenheit der Deutschen selbst“ werde, „und zwar im Zusammenwirken mit den Organen der SMAD“.?! Daher unterstützte sie die ideologische Tätigkeit deutscher Antifaschisten nach Kräften. In der Auseinandersetzung mit faschistischen Relikten im politischen, geistigen und kulturellen Leben der Ostzone nahm die von dem Leningrader Politökonomen Oberst S.I. Tjulpanow klug und verantwortungsbewußt geleitete Informationsverwaltung der SMAD eine Schlüsselfunktion ein. Zu ihren Mitarbeitern zählten erfahrene Vertreter gesellschaftswissenschaftlicher Disziplinen sowie Spezialisten für künstlerische, wissenschaftliche oder andere kulturelle Bereiche. So lag die Leitung der Abteilung Volksbildung in den Händen von P. W. Solotuchin, ehemals Rektor der Leningrader Universität und stellvertretender Minister für Volksbildung der RSFSR. Kulturund Bildungsoffiziere wie A.L.Dymschitz, erst Presseoffizier, dann Leiter der Abteilung Kultur, A.W.Federow, I.N.Fradkin, B.F.Ludschuweit und P.I.Nikitin waren Wissenschaftler bzw. gebildete Spezialisten und Marxisten-Leninisten, die sich in der deutschen Geistesgeschichte und in wesentlichen Fragen deutscher Kulturentwicklung auskannten. Sie alle entwickelten eine engagierte Publikationsund Vortragstätigkeit, mit der sie zur geistigen Faschismusbewältigung und zur Verbreitung marxistisch-leninistischen Gedankenguts beitrugen. Ihr Anteil am Umschwung auf vielen Gebieten des kulturellen Lebens war außerordentlich hoch. Eine bedeutende Rolle spielte bald auch der 1946 in Leipzig von der SMAD gegründete Verlag der Sowjetischen Militärverwaltung in Deutschland (SWA-Verlag), der im Dienste der Wiedergutmachung Bücher und Noten für die Sowjetunion, daneben aber in großer Zahl Werke russischer und sowjetischer Schriftsteller in deutscher Sprache herausbrachte.
Deutschsprachige Veröffentlichungen sowjetischer Verlage aus den ersten Nachkriegsjahren
Angesichts der faschistischen Verbrechen, wie sie seit November 1945 nun auch der Nürnberger Prozeß mit aller Schonungslosigkeit vor Augen führte, fand die konsequente Abrechnung mit nazistischem Gedankengut bei einer wachsenden Zahl von Menschen aller sozialen Klassen und Schichten Zustimmung und Unterstützung. Die antifaschistische Presse förderte die Abrechnung mit dem Faschismus durch eine Vielzahl journalistischer Aktivitäten, veröffentlichte Erlebnisberichte von Widerstandskämpfern und Opfern des Faschismus, würdigte deren Leistungen, führte aber ebenso eindringlich die faschistischen Untaten vor Augen. Weiter greifender Analysen bedurfte es, die Schuldfrage zu klären und die Mitverantwortung des deutschen Volkes herauszuarbeiten, ohne aber dabei einer pauschalen Kollektivschuld das Wort zu reden. Es kam im Gegenteil darauf an, die besondere Schuld der faschistischen Machthaber und ihrer Hintermänner in der deutschen Monopolbourgeoisie sowie unter den militaristischen Großagrariern offenkundig zu machen und die historischen Wurzeln des Faschismus bloßzulegen.
Für das kritische Aufdecken der reaktionären Entwicklungslinien in der deutschen Geschichte und das Herausarbeiten und deutliche Abheben ihrer progressiven Traditionen leistete auch Alexander Abuschs Buch „Der Irrweg einer Nation“ einen Beitrag, wenngleich es der Gefahr der Vereinfachung nicht immer entging. Im mexikanischen Exil entstanden und 1946 in der sowjetischen Besatzungszone erschienen, setzte sich die Darstellung mit dem Faschismus, seiner Vorgeschichte und seinen historischen Wurzeln vor allem mit dem reaktionären Preußentum auseinander und forderte zum kritischen Überdenken bisheriger deutscher Geschichte auf. Franz Mehrings „Historische Aufsätze zur preußisch-deutschen Geschichte“ sowie seine „Lessing-Legende“, die 1946 herausgegeben wurden, förderten die damit verbundenen Lernprozesse ebenfalls. Eine leidenschaftliche Kritik am preußischen Militarismus und seinen sozialen Trägern übte Ernst Niekisch in der Schrift „Deutsche Daseinsverfehlung“.
Die „ungeheuerlichen Erlebnisse“ (Friedrich Meinecke) mit Faschismus und Krieg führten indes auch bürgerliche Ideologen — Karl Jaspers, Meinecke, Alfred Weber und andere — zur Suche nach den Ursachen für diese verhängnisvolle Entwicklung. Insbesondere Meineckes Buch „Die deutsche Katastrophe“ spielte in den damaligen Auseinandersetzungen eine Rolle. Alexander Abusch und Johannes R. Becher suchten daher mit Meinecke in einen Disput zu treten. Wenn sich auch Meineckes Grundposition, die Geschichte als ständigen Widerstreit ewiger Ideen zu deuten, als unzulänglich erwies, den realen historischen Prozeß seit der Jahrhundertwende wirklich zu erklären, so gelangte dieser liberale Historiker des deutschen Bürgertums doch zu der Einsicht, daß die Entartung eben dieses Bürgertums seit Bismarcks Sturz, die „Zukunftskoalition der Scharfmacher, Hakatisten und Alldeutschen“ eine Vorstufe zum späteren Nationalismus Hitlers dargestellt habe.?? Die sozialökonomischen Strukturen des ehemaligen Deutschen Reiches wollte Meinecke nicht antasten. Sein anzustrebendes Ideal blieb die „weltbürgerliche Kulturgemeinschaft des christlichen Abendlandes“ unter Einschluß des deutschen Volkes. Damit lieferte er eine Leitidee, die auch antikommunistisch zu interpretieren war. Karl Jaspers, der in Heidelberg wieder als Professor der Philosophie wirkte, dort sein sogenanntes Schuldkolleg hielt und 1946 seine Schrift „Die Schuldfrage“ herausgab, hatte das Naziregime als verbrecherisch abgelehnt. Er forderte nun die Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus, die Verurteilung und Bestrafung der Kriegsverbrecher und verteidigte die Nürnberger Kriegsverbrecherprozesse. Er anerkannte die Pflicht zur Wiedergutmachung. Außerhalb seiner Überlegungen blieb, wie die sich verantwortlich fühlenden Individuen zu gemeinsamer praktischer, politischer Tätigkeit gelangen sollten. Neben Werner Krauss und Alfred Weber beteiligte sich Jaspers an der von Dolf Sternberger herausgegebenen Zeitschrift „Die Wandlung“.
Während eines Empfangs der SMAD für den Präsidialrat des Kulturbundes und weitere Vertreter von Wissenschaft und Kunst, Januar 1946. V.r.n.l.: Ernst Busch, Hans Fallada, Erich Weinert (verdeckt), Otto Dilschneider (stehend), Johannes R. Becher, Heinz Willmann
Subjektivismus und humanistischen Liberalismus betrachteten viele Intellektuelle im nachfaschistischen Deutschland als echte Alternativhaltungen zur faschistischen Diktatur und zum faschistischen Kadavergehorsam. Andere bürgerliche auf den Faschismus bezogene Deutungsversuche, wie etwa klerikale, sahen eine Ursache für sein Entstehen in den Säkularisierungsprozessen der neuesten Zeit und forderten eine Rückkehr zu christlichen Lebenswerten als verbindliche Normen für die deutsche Gesellschaft und für Europa. Ein bemerkenswertes Ereignis in den Bemühungen antifaschistischer christlicher Kreise stellte indes Martin Niemöllers in der Neustädter Kirche von Erlangen zu Beginn des Jahres 1946 gehaltene Ansprache dar, in welcher er betonte, daß eine wesentliche Voraussetzung zur geistigen Erneuerung Deutschlands das Bekenntnis der Schuld an den faschistischen Verbrechen sei. Linkskatholische Kreise um Eugen Kogon, den Begründer der „Frankfurter Hefte“, prangerten engagiert die faschistischen Verbrechen an und sprachen sich für gesellschaftliche Reformen aus. Kogon, ehemaliger Buchenwald-Häftling, schrieb das Buch „Der SS-Staat. Das System der deutschen Konzentrationslager“, eine der ersten die Verbrechen des Faschismus enthüllenden Darstellungen nach dem 8. Mai 1945.
Die klassenund weltanschauungsspezifischen Unterschiede in der geistigen Faschismusbewältigung erforderten Diskussion wie Auseinandersetzung über viele grundsätzliche politische und ideologische Fragen der unmittelbaren Vergangenheit, aber auch die Suche nach einem Konsens, nach revolutionär-demokratischen, bündnisfördernden Handlungsmotivationen für die Bewältigung der aktuellen Situation.
Bei der Zusammenführung fortschrittlicher Kulturschaffender erwarb sich der Kulturbund zur demokratischen Erneuerung Deutschlands große Verdienste. Sein Hauptanliegen sah er in der unmittelbaren Nachkriegszeit darin, breiteste Schichten der Intelligenz auf antifaschistischer und demokratischer Grundlage zu sammeln und für einen kulturellen Neubeginn zu gewinnen. Viele Angehörige der Intelligenz beteiligten sich aus ethischen und ökonomischen Motiven an der Normalisierung des Lebens, hielten sich aber von politischen Aktivitäten fern. Der Kulturbund besaß für eine initiativreiche Intelligenzpolitik die günstigsten organisatorischen Rahmenbedingungen und stand unter dem dominierenden Einfluß marxistischer Kulturpolitiker wie Johannes R. Becher. Er führte seine Mitglieder behutsam an die Politik der deutschen Antifaschisten heran, bezog Abseitsstehende in den kulturellen Neuaufbau ein, schuf Diskussionsmöglichkeiten und inspirierte viele Kulturschaffende politisch wie kulturell-künstlerisch zu großen antifaschistischen Leistungen. Kontinuierlich entwickelte er sich mit Unterstützung der sowjetischen Kulturoffiziere zu einer bedeutsamen und einzigartigen Kulturorganisation, der mit ihrer Zeitschrift „Aufbau“ unter der Chefredaktion von Klaus Gysi auch ein glänzendes Publikationsorgan zur Verfügung stand.
KPD und SPD sowie die übrigen antifaschistischdemokratischen Parteien beteiligten sich aktiv an der Arbeit des Kulturbundes und waren wie Anton Ackermann (KPD), Gustav Dahrendorf (SPD), Ferdinand Friedensburg (CDU) und’ Ernst Lemmer (CDU) in seinem Präsidialrat vertreten. An die Spitze seiner Landesbzw. Provinzialvorstände traten Künstler und Intellektuelle wie Willi Bredel und Karl Kleinschmidt in Mecklenburg-Vorpommern, Otto Nagel in Mark Brandenburg, Ricarda Huch, Theodor Plievier und Max Valentin in Thüringen. Zwar vermochten nicht alle der hier Genannten den Weg einer antifaschistischdemokratischen Umwälzung unter der Hegemonie der revolutionären Arbeiterklasse bis zum Ende zu gehen, da sie anderen Gesellschaftskonzeptionen folgten und ihre Bindungen an die bürgerliche Klasse sich als stärker erwiesen, doch in allen Ländern und Provinzen gehörte der Kulturbund von seiner Gründung an zu den politischen Kräften, die mit großer Konsequenz für die Schaffung antifaschistisch-demokratischer Verhältnisse eintraten.
Die geistige Abkehr vom Faschismus erfolgte in der Ostzone unter Führung der revolutionären Arbeiterbewegung mit wissenschaftlicher Gründlichkeit und groBem moralischem Verantwortungsgefühl. Von Dauer war diese geistige Reinigung aber vor allem deshalb, weil es den Antifaschisten gelang, das gesamte Bildungsund Erziehungswesen revolutionär umzugestalten und zu einem integrierenden Bestandteil der neuen, antifaschistischen Demokratie zu machen.
Der Beginn der antifaschistisch-demokratischen Schulreform
Ende August 1945 übermittelte die Deutsche Verwaltung für Volksbildung den Schulbehörden den Auftrag, „alle Maßnahmen zu treffen, um in diesem Herbst und Winter einen geregelten Unterricht durchführen zu können“. In Zusammenarbeit mit den Besatzungsbehörden und mit den demokratischen Organisationen sollten sie „die Bereitstellung von Schulräumen, Heizung, Beleuchtung und des notwendigsten Lehrmaterials (Tafeln, Hefte, Federn, Kreide usw.)“ sichern. Es wurde ihnen mitgeteilt, daß hierzu „eine weitgehende Selbsthilfe der Schulen notwendig“ sei.
Als hochindustrialisiertes Land hatte das kapitalistische Deutschland über ein zwar entwickeltes, jedoch durch eine starre Trennung von Volksschule und höherer Schule geprägtes Schulsystem verfügt. Klassenspezifische Lebensbedingungen mit all ihren individuellen Konsequenzen hinderten die erdrückende Mehrheit von Kindern der arbeitenden Klassen, eine höhere Schulbildung zu erwerben. Hieran hatten weder in Ausnahmefällen gewährte Schuldgeldfreiheit noch Stipendien — von bürgerlichen Instanzen durchaus interessenbewußt vergeben — etwas geändert. Auffällig war auch das Bildungsgefälle zwischen Stadt und Land. So existierten im Schuljahr 1945/46 im Gebiet der Ostzone noch 4114 einklassige Landschulen, in denen Kinder aller Altersstufen von einem Lehrer gleichzeitig unterrichtet wurden. Insgesamt war jedoch auch den Volksschülern im kapitalistischen Industriestaat Deutschland, der stets qualifizierte Facharbeiter brauchte, eine relativ hohe Allgemeinbildung vermittelt worden. Doch hatten seit dem Übergang zum Imperialismus reaktionäre Bildungsund Erziehungsinhalte den öffentlichen Unterricht in immer stärkerem Maße geprägt. Ihren Höhepunkt erreichte diese Entwicklung in der Zeit des Faschismus, dessen Bildungswesen unverhohlen verbohrten Chauvinismus, blinden Rassenwahn, Antikommunismus, Antisowjetismus und Kadavergehorsam züchtete und damit die Schuljugend direkt für den faschistischen Aggressionskrieg reif machte. 28179 von 39348 Lehrerinnen und Lehrern in den allgemeinbildenden Schulen waren bei Kriegsende Mitglieder der NSDAP.
Wie die zur Wiedereröffnung der Schulen nötigen Bestandsaufnahmen auswiesen, hatten Faschismus und Krieg das deutsche Schulwesen nicht nur inhaltlich auf einen Tiefstand seiner Entwicklung gebracht. Von den etwa 12 000 Schulen der Ostzone waren 2 741 beschädigt, 363 nahezu zerstört und 124 gänzlich vernichtet. Am härtesten betroffen durch Kampfhandlungen waren die Provinz Mark Brandenburg und das Land Sachsen. In Mark Brandenburg überstanden von 2101 Schulgebäuden nur 1281 das Kriegsende ohne nennenswerte Zerstörungen. In Mecklenburg-Vorpommern hatte ein Drittel aller Schulen Schäden davongetragen. Da gegen Ende des Krieges Schulen als Kasernen, Lazarette, Notunterkünfte für Flüchtlinge und ähnliches gedient hatten, ging oft genug auch noch das Inventar verloren. Von 6875 in ihrer Bausubstanz unbeschädigt gebliebenen Schulen der Ostzone (ohne Mecklenburg-Vorpommern) besaßen im Sommer 1945 nur noch 3 458 vollständige Einrichtungen. In einigen Berliner Stadtbezirken waren aus Schulbänken sogar Särge gezimmert worden. Und auch in anderen Großstadtschulen saßen die Schüler noch lange Zeit auf Plättbrettern oder anderen von zu Hause mitgebrachten Sitzgelegenheiten.
Infolge des Krieges fehlten in der Ostzone 20000 Lehrer. Hingegen wuchs die Zahl der schulpflichtigen Kinder und Jugendlichen durch den Zustrom von Flüchtlingen und Umsiedlern zum Teil erheblich.
Die Leitung der allgemeinbildenden Schulen in den Kreisen lag in den Händen von Schulräten, die mit Zustimmung der sowjetischen Kommandanturen zunächst von den Landräten, ab Sommer 1945 von den Landesbzw. Provinzialverwaltungen eingesetzt wurden. Ende 1945/Anfang 1946 gehörten von den 142 Schulräten in Mecklenburg-Vorpommern, Mark Brandenburg, dem Land und der Provinz Sachsen 37 der KPD, 73 der SPD, 23 der CDU bzw. der LDPD an, 9 waren parteilos. 16 der 30 Schulräte Thüringens waren ehemalige politische Häftlinge.
Mit der Schaffung von Landesund Provinzialverwaltungen im Juli 1945 hatte auch der Aufbau von Ämtern für Volksbildung und Kultur innerhalb dieser Verwaltungsorgane begonnen. An ihrer Spitze standen in allen Ländern und Provinzen Angehörige der Arbeiterparteien. In der im Sommer 1945 geschaffenen Deutschen Verwaltung für Volksbildung übten neben Paul Wandel als Präsident weitere Vertreter der revolutionären Arbeiterbewegung im Bündnis mit demokratischen Vertretern anderer Klassen und Schichten bestimmenden Einfluß aus. Paul Wandel, der im sowjetischen Exil an führender Position in der Schulungsund Bildungsarbeit der deutschen und internationalen Arbeiterbewegung sowie als Sekretär Wilhelm Piecks tätig gewesen war, hatte die kulturpolitischen Vorstellungen der KPD für Nachkriegsdeutschland mit erarbeitet und trug nun gemeinsam mit engagierten antifaschistischen Kulturpolitikern Sorge, sie schöpferisch umzusetzen. Als Vizepräsidenten der DVV wirkten Johannes R. Becher -— an dessen Stelle ab März 1946 der Dichter Erich Weinert trat -, der Sozialdemokrat Erwin Marquardt und der parteilose Arzt und Wissenschaftler Theodor Brugsch. Die Hauptabteilung Wissenschaft der DVV lag in den Händen des Physikerss und Kommunisten Robert Rompe. Zur DVV gehörte ein breit gefächerter Verantwortungsbereich, der von Schulen, Kindergärten und -heimen über Hochschulen, Theater, Verlage, Museen bis zu den Kinos, später dem Rundfunk und anderen Einrichtungen reichte. Sie übte durch ihre Kontrollund Lenkungstätigkeit einen beträchtlichen Einfluß auf die Entwicklung kultureller Teilgebiete aus, besaß aber keine Rechtsetzungsfunktionen.
Waldschule. Aus Raumnot mußte der Unterricht auch ins Freie verlegt werden, Dölitz 1946
Zur Unterstützung des demokratischen Neuaufbaus der Schule entstanden um die Wende 1945/46 in vielen Gemeinden Schulausschüsse bzw. Schulkommissionen, denen Vertreter der Blockparteien und der Jugendausschüsse angehörten. Diese Ausschüsse schufen günstigere Voraussetzungen für die antifaschistisch-demokratische Erneuerung des Bildungswesens.
Die schulpolitische Tätigkeit der deutschen Antifaschisten wurde wesentlich dadurch bestimmt und erleichtert, daß die Alliierten mit ihren Potsdamer Beschlüssen für das Erziehungswesen festgelegt hatten, „daß nazistische und militaristische Doktrinen völlig ausgemerzt werden und eine erfolgreiche Entwicklung demokratischer Ideen möglich gemacht wird“.
Nachdem die SMAD den Schulbeginn für den 1. Oktober 1945 angeordnet hatte, verlangte ihre für den Inhalt des Unterrichts zuständige Volksbildungsabteilung, bis zum 15. September vorläufige Lehrpläne sowie Verzeichnisse der vor 1933 entstandenen, noch benutzbaren Schulliteratur einzureichen. Eine so kurzfristige Terminierung erforderte — zumal unter den damaligen Bedingungen — die Anspannung aller Kräfte. Die Mehrzahl der faschistisch belasteten Lehrkräfte war zu entlassen. Von den Nazis aus dem Schuldienst entfernte Pädagogen wurden wieder eingestellt.
Immerhin konnten zum festgelegten Datum 10 822 allgemeinbildende Schulen der sowjetischen Besatzungszone ihre Arbeit aufnehmen. Auch eine große Zahl von Berufsschulen, jedoch noch längst nicht genug, öffneten wieder ihre Pforten.
Am 25. September 1945 entstand der Volk und Wissen Verlag GmbH, der sich der mehr als schweren Aufgabe unterzog, auf schnellstem Wege neue, im antifaschistisch-demokratischen Geist abgefaßte Schulbücher herauszubringen. Zunächst wurden den Schulen bis Ende 1945 4116000 Stück zum Teil überarbeitete und von reaktionären Passagen gesäuberte Lehrbücher aus der Weimarer Republik zur Verfügung gestellt.
Die Wiederaufnahme des Schulunterrichts schon im Herbst 1945 stellte eine herausragende kulturelle Leistung dar. Daß sie sich zu einem echten schulund bildungspolitischen Neubeginn gestaltete, ergab sich vornehmlich aus der Tatsache, daß die beiden Arbeiterparteien im Bereich des Erziehungswesens relativ rasch in Aktionseinheit zu handeln begannen.
Schon wenige Tage nach Aufnahme des Schulunterrichts legten das Zentralkomitee der KPD und der Zentralausschuß der SPD am 18. Oktober 1945 einen gemeinsamen Aufruf zur demokratischen Schulreform vor. Beide Parteien begründeten darin die Notwendigkeit einer allseitigen Demokratisierung des gesamten Schulwesens, ohne die die „Ausrottung des Nazismus und Militarismus mit ihren reaktionären Wurzeln, die Sicherung eines dauerhaften Friedens und die demokratische Erneuerung Deutschlands“ undenkbar seien.’° Die Zielsetzung, eine „wahrheitsund friedensliebende, arbeitsame Jugend“ zu erziehen?”, erfordere, so stellten sie fest, neben der Demokratisierung des Schulund Hochschulwesens auch die Säuberung des gesamten Lehrund Verwaltungspersonals von allen nazistischen und militaristischen Elementen sowie die Besetzung der Schulratsund Schulleiterstellen mit bewährten Antifaschisten. Ein „neuer Typ des demokratischen, verantwortungsbewußten und fähigen Lehrers“ °® sei heranzubilden, und dies wiederum setze eine gründliche Reform der Lehrerausbildung voraus. Zugleich sollten eine den neuen gesellschaftlichen Entwicklungen angepaßte Umstellung der Lehrpläne und die Erarbeitung neuer Lehrbücher in Angriff genommen werden. Im Mittelpunkt des Aufrufs stand die Forderung: „Alle Bildungsprivilegien einzelner Schichten müssen fallen. Das Ziel der demokratischen Schulreform ist die Schaffung eines einheitlichen Schulsystems, in dem die geistigen, moralischen und physischen Fähigkeiten der Jugend allseitig entwikkelt, ihr eine hohe Bildung vermittelt und allen Befähigten ohne Rücksicht auf Herkunft, Stellung und Vermögen der Eltern der Weg zu den höchsten Bildungsstätten des Landes frei gemacht wird.“?” KPD und SPD verlangten die klare Trennung von Schule und Kirche bei voller Anerkennung der Glaubensund Gewissensfreiheit und lehnten die Gründung oder Weiterführung von Privatschulen ab. Im November 1945 stellten Anton Ackermann und der sozialdemokratische Schulpolitiker Max Kreuziger diese Programmpunkte auf einer gemeinsamen Kundgebung von KPD und SPD in Berlin der Öffentlichkeit vor. In einer Entschließung stimmten die Kundgebungsteilnehmer dem Aufruf zur Schulreform zu.
Gefährlicher SchulwegDer erste Schritt zu seiner Realisierung bestand in der Entnazifizierung des Schulwesens. NSDAP-Mitgliedern und anderen Erziehern faschistischer Prägung, die für die rassistische und militaristische Verhetzung der Jugend in Nazideutschland verantwortlich gezeichnet hatten, sollten die heranwachsenden Generationen nicht mehr anvertraut werden. Sie wurden sukzessive aus dem Schuldienst entlassen. Am 1. Januar 1946 arbeiteten in den Bildungseinrichtungen der Ostzone nur noch 8037 ehemalige NSDAPMitglieder. Aber auch diese Zahl wurde in den folgenden Monaten zielstrebig und mit revolutionärer Konsequenz weiter reduziert. Mit der Entfernung der faschistischen Lehrer aus dem Volksbildungswesen verloren die reaktionären und restaurativen imperialistischen Kräfte in Deutschland wichtige ideologische Stützen und eifrige Propagandisten reaktionärer Lebenshaltungen und Denkweisen.
Nach den unerläßlichen antifaschistischen Säuberungen, die im Einklang mit alliierten Beschlüssen bzw. auf deren Grundlage durchgeführt worden waren, stand die antifaschistische Schule allerdings vor dem Problem, nunmehr insgesamt 40000 Volks-, Mittelund Sonderschullehrerstellen neu besetzen zu müssen. Die neuen Schulverwaltungen lösten diese schwierige Aufgabe auf revolutionäre Weise, indem sie mit Unterstützung der Parteien und Massenorganisationen Zehntausende meist junger Werktätiger, vor allem antifaschistisch gesinnte Arbeiter, Bauern und Angestellte, für den Einsatz als Neulehrer gewannen. Ein Teil dieser jungen Leute arbeiteten nach einer Aufnahmeprüfung sofort als Lehrer und qualifizierten sich daneben im Selbststudium für die neue Aufgabe. In anderen Fällen wurden die potentiellen Neulehrer in kurzfristigen pädagogischen Kursen auf ihre künftige Tätigkeit vorbereitet. Erst ab Januar 1946 fanden auf Befehl der SMAD in allen Ländern und Provinzen achtmonatige Lehrgänge für angehende Lehrer statt. Bereits im Schuljahr 1945/46 nahmen an die 16000 Neulehrer ihren Dienst auf. Viele von ihnen mußten nicht nur mit schwierigen Lebensumständen und Arbeitsbedingungen — mangelhafter Ernährung, schlechten Unterkünften, dem Fehlen von notwendiger Literatur und wichtigen Arbeitsmitteln -—, sondern auch mit dem Argwohn und dem Mißtrauen von seiten der Eltern ihrer Schüler und erfahrener Kollegen fertig werden. Indes bewältigte der größte Teil der Neulehrer diese Probleme. Dabei entwickelten gerade sie sich zu einem entscheidenden politischen und pädagogischen Potential der demokratischen Schulreform, das zudem die antifaschistisch-demokratische Umgestaltung insgesamt voranbrachte. An höheren
Lehreranstalten war eine solche revolutionäre Praxis des Neulehrereinsatzes allerdings nicht so ohne weiteres anwendbar, da die hier tätigen Lehrer zumindest über Spezialkenntnisse, letzten Endes aber doch über eine akademische Bildung verfügen mußten. Nach und nach gelang es jedoch auch an den Oberschulen, faschistisch belastete Lehrer entweder durch erfahrene Volksschullehrer oder aber durch Angehörige der Intelligenz aus anderen Berufsgruppen zu ersetzen. Mit diesen Maßnahmen wurde bereits im ersten Nachkriegsschuljahr wichtigen Auflagen des Potsdamer Abkommens entsprochen.
Die Grundsätze einer antifaschistisch-demokratischen Schule bedurften — sollte ihre Gültigkeit von Dauer sein — der gesetzlichen Fixierung. In den Ländern und Provinzen wurden daher schon im Herbst 1945 Entwürfe eines demokratischen Schulgesetzes diskutiert. Der Deutschen Verwaltung für Volksbildung, die sich bald zu einem von den Landesund Provinzialverwaltungen anerkannten Koordinierungsinstrument entwickelte, gelang es Anfang 1946 in Zusammenarbeit mit den Schulabteilungen der Landesund Provinzialverwaltungen, einen gemeinsamen Gesetzentwurf herzustellen. Nach gründlichen und auch kontroversen Diskussionen um die Notwendigkeit des Neulehrereinsatzes, um die Dauer der Grundschulpflicht und um bestimmte Vorschläge zur Begabtenförderung, die zum damaligen Zeitpunkt die Einheitlichkeit des Schulsystems wieder in Frage gestellt hätten, entstand das „Gesetz zur Demokratisierung der deutschen Schule“, das im Zeitraum von Mai bis Juni 1946 von allen Präsidien der Landesund Provinzialverwaltungen mit geringfügigen Abweichungen als verbindlich angenommen wurde.
Die Präambel des Gesetzes erinnerte daran, daß die deutsche Schule trotz ihres beachtlichen Ausbildungsniveaus vor 1933 eine Standesschule gewesen war, die den Söhnen und Töchtern des einfachen Volkes den Weg zur höheren Schulbildung versperrt und als Stätte der Völkerverhetzung gewirkt hatte. Die von jeglichen Elementen des Militarismus, Imperialismus, der Völkerverhetzung und des Rassenhasses freie, demokratische Schule sollte so aufgebaut werden, „daß sie allen Jugendlichen, Mädchen und Jungen, Stadtkindern und Landkindern, ohne Unterschied des Vermögens ihrer Eltern, das gleiche Recht auf Bildung und seine Verwirklichung entsprechend ihren Anlagen und Fähigkeiten“ garantierte.
Das Gesetz legte als Ziel der deutschen demokratischen Schule den Grundsatz fest, „die Jugend zu selbständig denkenden und verantwortungsbewußt handelnden Menschen“ zu erziehen, „die fähig und bereit sind, sich voll in den Dienst der Gemeinschaft des Volkes zu stellen“.
Ausdrücklich verankert war der Grundsatz, die schulische Erziehung als Angelegenheit des Staates zu betrachten und demzufolge den Religionsunterricht als Angelegenheit der Religionsgemeinschaften. Um diese Frage hatte es erhebliche Auseinandersetzungen mit konservativen Angehörigen der CDU gegeben, die selbst hinter schulpolitische Forderungen bürgerlicher Demokraten des 19. Jahrhunderts zurückgingen und Religionsunterricht als integrierenden Bestandteil des Schulunterrichts verstanden wissen wollten. Unter dem Einfluß reaktionärer Politiker hatte der kulturpolitische Ausschuß der CDU ausdrücklich die christliche Bekenntnisschule gefordert. Die Mitglieder der LDPD hingegen duldeten in dieser Frage keine Kompromisse und lehnten die Bekenntnisschule ab.
Demokratischen Organisationen sowie den Eltern ermöglichte das Gesetz, den Schulen und Schulbehörden beratend zur Seite zu stehen. Als verbindlich für alle Schultypen galt das Prinzip der Koedukation. Damit wurde langfristig ein tiefgreifender Beitrag zur Frauenemanzipation geleistet.
Mit dem Gesetz zur Demokratisierung der deutschen Schule konnte eine einheitliche, weltliche Schule entstehen, in der jegliche Bildungsprivilegien beseitigt und Wissenschaftlichkeit des Unterrichts auf allen Stufen garantiert waren. Sie umfaßte acht Grundschulklassen und war im wesentlichen schulgeldfrei; gewisse Einschränkungen gab es nur noch in einigen Fällen an Fach-, Oberund Hochschulen. Die Hochschulreife konnte über eine vierklassige Oberstufe mit Abitur oder aber auf dem Wege der Berufsschulbildung über einen Fachschulabschluß erreicht werden. Ein breites Netz von Bildungseinrichtungen wie Abendund Volkshochschulen letztere nahmen ab Januar 1946 ihre Tätigkeit auf — gab darüber hinaus Angehörigen aller Schichten weitere Möglichkeiten, die Hochschulreife zu erlangen. Obligatorisch wurde die dreijährige Berufsausbildung.
Durch seine antiimperialistische Zielsetzung erhielt das Gesetz eine besondere gesellschaftspolitische Qualität, markierte es eine Wende im deutschen Bildungswesen.
In Berlin verlief die schulpolitische Entwicklung abweichend. Mit Unterstützung durch die westlichen Besatzungsmächte konnten dort Gegner der demokratischen Schulreform 1946 die Annahme eines Gesetzes zur Demokratisierung der Schule zunächst verhindern und Fragen der Schulreform auf die Zeit nach den Berliner Wahlen im Oktober 1946 vertagen.
Der Beginn der demokratischen Hochschulreform
In engem Zusammenhang mit der demokratischen Schulreform erfolgte in der Ostzone die Reform des Universitätsund Hochschulwesens. Die Anweisung zur Neuaufnahme der Lehrund Forschungstätigkeit an den Hochschulen erging mit dem Befehl Nr.50 der SMAD vom 4.September 1945. Dieser forderte, „nazistische und militaristische Lehren aus dem Unterricht und der Erziehung der Studenten völlig zu beseitigen“ und die „Ausbildung solcher Kräfte zu sichern …, die fähig wären, demokratische Grundsätze in die Praxis umzusetzen“.
Die sowjetischen Verantwortlichen förderten die Bildung eines Leitenden Ausschusses für Hochschulfragen beim Magistrat von Berlin, dem neben Theodor Brugsch unter anderem auch der Mathematiker und kommunistische Kulturpolitiker Josef Naas, der antifaschistische Professor für technische Chemie Heinrich Franck und der konservative Hitlergegner Eduard Spranger, Philosoph, Pädagoge und Psychologe, angehörten. Der Ausschuß beteiligte sich aktiv an den Vorbereitungen zur Wiedereröffnung der Hochschulen nicht nur in Berlin, sondern auch in der gesamten sowjetischen Besatzungszone. Ein Wissenschaftlergremium unter Leitung von Johannes Stroux sondierte daneben die Möglichkeiten einer Wiedereröffnung der früheren Preußischen Akademie der Wissenschaften.
Wichtige Voraussetzung für den Neubeginn an den höchsten Lehranstalten war zunächst eine genaue Bestandsaufnahme in Hinblick auf die wissenschaftlichen Potenzen ihrer Institute und Einrichtungen bzw. ihres Personalbestandes sowie auf deren Rolle im „Dritten Reich“. Institute und Einrichtungen für Rassenhygiene, Geopolitik, faschistische Volkstheorie, Sippenund Grenzlandkunde wurden ebenso geschlossen wie militärischen Zwecken dienende Forschungseinrichtungen.
Zu den ersten Aktivitäten an Universitäten und Hochschulen, aber auch in anderen wissenschaftlichen Institutionen gehörten Aufräumungsarbeiten und die Sicherung ihrer wissenschaftlichen Einrichtungen, Sammlungen und Bibliotheken bzw. deren Rückführung aus der Evakuierung. Doch schon bald begann die Auseinandersetzung mit reaktionären Traditionen der deutschen Hochschulen und deren Säuberung von ehemaligen Nazianhängern: Faschistische Lehrund Studienmaterialien wurden eingezogen. Konservative Hochschullehrer stemmten sich den Entnazifizierungsmaßnahmen vielerorts entgegen. Aber auch bürgerlich-demokratische Kräfte vermochten nicht so ohne weiteres zu den Positionen der deutschen Antifaschisten vorzudringen, da sie in Vorstellungen von der Möglichkeit und Notwendigkeit.einer klassenindifferenten Neutralität der Hochschulen und der Wissenschaften befangen oder auch ganz einfach nur politisch unsicher waren. Dem konnte allein durch geduldige Überzeugungsarbeit begegnet werden. Die politischen und wissenschaftlichen Ausgangsbedingungen gestalteten sich an den einzelnen Universitäten recht unterschiedlich, so daß deren Neueröffnung nur schrittweise erfolgen konnte.
Feierliche Wiedereröffnung der Berliner Universität, Februar 1946. Vordere Reihe rechts: der neue Rektor, Johannes Stroux; daneben: Oberbürgermeister Arthur Werner
Als erste Universität der Ostzone nahm am 25. Oktober 1945 die Universität Jena ihren Vorlesungsbetrieb wieder auf. In Jena wurde das Thüringer Landesamt für Volksbildung von dem Kommunisten Walter Wolf geleitet, der sofort nach seiner Befreiung ‚aus dem KZ Buchenwald — noch unter amerikanischen Besatzungsbedingungen — gemeinsam mit anderen Widerstandskämpfern für die Schaffung antifaschistischer Selbstverwaltungsorgane gesorgt hatte. Anfang Juli 1945, nach Abzug der amerikanischen Truppen, führten Angehörige der SMAD und der KPD alsbald Gespräche mit dem geschäftsführenden Rektor, dem Altphilologen Friedrich Zucker, sowie mit anderen Universitätslehrkräften über die Mitschuld deutscher Universitäten sowie deutscher Intellektueller an der Etablierung des Faschismus. Gleichzeitig erörterten sie die neuen Wege, die nunmehr bei der Ausbildung von Lehrern, Medizinern und Naturwissenschaftlern eingeschlagen werden mußten. Damit wurden paradigmatische Schritte unternommen, namhafte Wissenschaftler für den demokratischen Neuaufbau zu gewinnen. W. I. Tschuikow, 1945 noch Chef der SMA Thüringen, forderte anläßlich der feierlichen Eröffnung der Universität, daß sie „eine Erneuerungsstätte“ würde „für ein Deutschland im demokratischen Geist und eine Grabstätte des Nazismus und der Nazi-Ideologie“.** Daß sich diese angestrebte Entwicklung in Jena keineswegs reibungslos vollzog, beweist die nochmalige Entlassung von 61 Lehrkräften im Dezember 1945. Auch die erste Vorlesung über die Beschlüsse der Potsdamer Konferenz stieß noch auf massive Ablehnung durch Studenten und Kreise der Hochschulintelligenz.
Im Januar und Februar 1946 öffneten weitere Universitäten und Hochschulen in Berlin, Halle, Leipzig, Greifswald, Rostock und Freiberg wieder ihre Tore. Im Laufe des Jahres kamen noch weitere Hochschulen, wie die Weimarer Hochschule für Baukunst und die Leipziger Hochschule für Musik, hinzu.
In seiner Rede zur Eröffnung der Berliner Universität verwies Paul Wandel darauf, daß es gerade die bewußte und gewaltsame Ausschaltung der Arbeiterklasse gewesen sei, die den Universitäten den schwersten Schaden zugefügt habe. Als den historischen Auftrag der höchsten Bildungsanstalten in einer antifaschistischen Demokratie bezeichnete er es, „eine neue deutsche Intelligenz hervorzubringen, die ihre Aufgaben in der friedlichen Aufbauarbeit“ und „in der Förderung einer friedlichen Zusammenarbeit unseres Volkes mit den anderen Völkern“ sehe
Die Eröffnungsfeierlichkeiten der Universitäten und Hochschulen machten offenkundig, daß durch konsequente Entnazifizierung, aber nicht weniger durch ehrliche Bereitschaft von Kräften der alten Intelligenz zur Mitarbeit am antifaschistischen Wiederund Neuaufbau erste wichtige Veränderungen im Hochschulwesen einzutreten begannen. Die weitere Ausprägung antifaschistisch-demokratischer Verhältnisse vollzog sich aber an den höchsten Bildungseinrichtungen auch in den folgenden Jahren noch recht widerspruchsvoll und konfliktreich. Die Herstellung eines wirklichen Bündnisses zwischen Arbeiterklasse und Hochschulintelligenz erforderte Geduld und Zeit, zumal sich auch die politische und soziale Zusammensetzung der Studentenschaft nur langsam im Sinne einer Verstärkung des Anteils fortschrittlicher Angehöriger der Arbeiterklasse änderte. In Berlin gehörten Anfang 1946 4,9 Prozent der Studenten der KPD und 5,3 Prozent der SPD, in Leipzig 4,9 Prozent der KPD und 10,9 Prozent der SPD an. Somit hatten die Arbeiterparteien an den Universitäten immerhin Fuß gefaßt. Da sich jedoch die soziale Zusammensetzung der Schülerschaft an den Oberschulen nur langsam veränderte, wuchs der Anteil der Arbeiterund Bauernstudenten zunächst nur geringfügig.
Elitedenken, Volksfremdheit, Lebensferne und Ablehnung politischer Notwendigkeiten blieben bei Lehrkörper wie Studentenschaft virulent und behinderten die zügige Demokratisierung der höchsten Bildungsanstalten. Für breite Kreise der alten Hochschulintelligenz bildeten eine politisch unverbindliche „akademische Freiheit“ und das Prinzip der Universitätsautonomie oft die einzig vorstellbare Alternative zur ehemaligen faschistischen Hochschulpolitik. Sehr zielstrebig agierten aber oft solche konservativen Kräfte, die unter der faschistischen Diktatur vor dem Nationalsozialismus kapituliert und ihren Frieden mit ihm gemacht hatten und nun die Konsequenzen fürchteten. In Leipzig, Berlin und anderen Universitätsstädten widersetzten sich beispielsweise Teile der Hochschullehrerschaft den gesellschaftlichen Maßnahmen der Entnazifizierung, suchten sie zu verschleppen und mit dem Hinweis auf die „Selbstreinigung des Lehrkörpers“ abzuschwächen. Die Berufung von Antifaschisten als Hochschullehrer stieß auf Widerstand. So nimmt es nicht wunder, daß in Leipzig nur 52 von 223 Lehrkräften, in Halle nur 70 von 165 im Dienst belassen werden konnten. Auf Grund dieser Situation verzögerte sich an vielen Fakultäten die volle Wiederaufnahme der Lehrtätigkeit.
Antifaschistisch-demokratische Erneuerung der Hochschulen erforderte auch eine tiefgehende allseitige Demokratisierung des Inhalts von Lehre und Forschung, Ausbildung und Erziehung. Diese Zielsetzung schloß ein, dem dialektischen und historischen Materialismus den ihm gebührenden Platz im System der Wissenschaften einzuräumen. Solche Bemühungen waren jedoch nach so vielen Jahren schärfster antikommunistischer Propaganda auf dem Wege der Überzeugung allein nicht durchzusetzen, sondern bedurften, wie die Entwicklung zeigte, auch besonderer organisatorisch-struktureller Maßnahmen. So fanden in den Anfangsjahren die marxistisch-leninistischen Gesellschaftswissenschaften dauerhaft Eingang in das Universitätsleben erst durch Neugründung entsprechender gesellschaftswissenschaftlicher Institute und Fakultäten, die in ihrer Berufungspolitik von den mehr oder weniger konservativen Universitätsleitungen unabhängig waren. 1945/46 fanden als erste Versuche, auch gesellschaftswissenschaftliche Problemstellungen zu diskutieren, und damit als Beitrag zur demokratischen Erziehung der Studenten Vortragszyklen zu aktuellen Fragen der antifaschistisch-demokratischen Erneuerung statt.
Die Vorbereitungen zur Wiedereröffnung der Akademie der Wissenschaften hatten seit Ende 1945 ebenfalls Fortschritte gemacht. Am 1. Juli 1946 erteilte die SMAD den Befehl zu ihrer Restitution unter der neuen Bezeichnung „Deutsche Akademie der Wissenschaften zu Berlin“. Bereits am 4. Juli 1946 beging sie anläßlich des 300. Geburtstages ihres Gründers den traditionellen Festtag zu Ehren von Gottfried Wilhelm Leibniz. Die eigentliche Wiedereröffnungsfeier fand am 1. August 1946 statt. Präsident der Akademie wurde der Altphilologe Johannes Stroux; die Funktion des wissenschaftlichen Direktors wurde dem Mathematiker Josef Naas übertragen, der nach der Befreiung vom Faschismus zunächst im Sekretariat der KPD mit kulturpolitischen Aufgaben betraut gewesen war.
Die Künste am Beginn der antifaschistisch-demokratischen Umgestaltung
Angesichts des Sieges über den Faschismus rüsteten in allen Exilländern antifaschistische deutsche Kulturschaffende zur Rückkehr in-ihre befreite Heimat. An die 3000 Künstler, Musiker, Journalisten, Kunstwissenschaftler und Schriftsteller, darunter nahezu alle Autoren von Rang, hatten Deutschland nach 1933 verlassen müssen. Die sozialistische und die bürgerlichdemokratische Kunst zum Schweigen zu bringen war dem faschistischen Herrschaftsapparat jedoch nicht gelungen. In der Emigration und im Widerstand entfaltete sie sich zu einer neuen politisch-ästhetischen Qualität. Werke und Autoren des revolutionären Antifaschismus brachten in den Prozeß der geistigen Erneuerung nach 1945 nicht nur vielgestaltige Kampferfahrungen und neue theoretische Erkenntnisse ein, sondern auch Lebenshaltungen und kulturelle Werte der revolutionären Demokratie, des kämpferischen Humanismus und des Sozialismus, die der von Faschismus und Krieg gezeichneten deutschen Bevölkerung Lebenshilfe und Orientierung sein konnten. Antifaschistische Schriftsteller und Kulturschaffende wie Johannes R.Becher, Willi Bredel, Ernst Busch, Fritz Erpenbeck, Herbert Gute, Hans Lorbeer, Otto Nagel, Adam Scharrer, Heinz Willmann, Günther Weisenborn, Ernst Niekisch, Bernhard Kellermann gehörten zu den Aktivisten der ersten Stunde. An ihre Seite traten bald Erich Weinert, Friedrich Wolf und andere, die nach und nach aus der Emigration zurückkehrten. Antifaschistische Künstler und Geistesschaffende wirkten damals nicht nur auf ihren ureigensten künstlerischen und publizistischen Feldern, sie betrachteten es als ihre nationale Pflicht, in antifaschistisch-demokratischen Verwaltungen zu arbeiten oder Funktionen in Parteien und gesellschaftlichen Organisationen auszuüben. Gemeinsam mit sowjetischen Kulturoffizieren widmeten sie sich der breiten kulturellen Sammlungsbewegung im Dienste der demokratischen Neugeburt des deutschen Volkes, die alle aufbauwilligen Vertreter der Intelligenz vereinen sollte, und setzten sich für eine gesellschaftlich wirksame antifaschistische Kunst ein. Insbesondere Johannes R. Becher bemühte sich um nach 1933 in Deutschland verbliebene Schriftsteller wie Hans Fallada und Ernst Wiechert oder Ehm Welk. Im Herbst 1945 besuchte er den greisen und todkranken Gerhart Hauptmann in seinem Haus in Jagniatköw, dem ehemaligen Agnetendorf, half, dessen Lebensumstände zu bessern, und gewann den Dichter der „Weber“ zu einer Stellungnahme für ein antifaschistisch-demokratisches Deutschland.
Die vielfältigen kunstpolitischen und künstlerischen Aktivitäten deutscher Antifaschisten wurden von den Kulturoffizieren der SMAD gefördert. Der am 4. September 1945 von der SMAD erlassene Befehl Nr. 51 nannte als Hauptaufgabe der künstlerischen Institutionen und Einrichtungen die volle Befreiung der Kunst von nazistischen, rassistischen, militaristischen oder anderen reaktionären Ideen und Tendenzen, die „aktive Verwendung der Kunstmittel im Kampf gegen den Faschismus und für die Umerziehung des deutschen Volkes im Sinne einer konsequenten Demokratie“ sowie die „Erschließung der Werte der internationalen und russischen Kunst“. *° Ehemalige Kunstgesellschaften galten als aufgelöst, zur Gründung neuer Vereinigungen bedurfte es, wie auch bei der Vorbereitung von Kunstausstellungen, der Genehmigung durch die SMAD. Repertoirepläne von Theatern, Sinfonieorchestern, Kapellen, Variet&s und Kabaretts waren von den zuständigen Militärverwaltungen zu bestätigen und zu registrieren. Eine Übersicht über alle Theater-, Konzertund Ausstellungsräume sowie über das gesamte künstlerische Personal wurde erarbeitet.
Trotz Hunger und Not regte sich in allen künstlerischen Bereichen neues Leben. Noch im Jahre 1945 kamen in Berlin, Dresden, Schwerin, aber auch in Altenburg, Glauchau und Freiberg Kunstausstellungen zustande, die Werke der von den Nazis verfemten Künstler vorstellten. Obwohl manches Bild den damaligen offiziellen Kunstauffassungen in der UdSSR nicht entsprach, entschieden sowjetische Kulturoffiziere, an erster Stelle S.I. Tjulpanow, daß es politisch wichtig sei, alle Bilder auszustellen.” Die erste größere Dresdner Exposition „Freie Künstler-Ausstellung Nr. 1“, schon um die Wende 1945/46 organisiert, spiegelte deutlich die geistige Situation jener Jahre. Viele Künstler und Kunstwissenschaftler verspürten zwar die Notwendigkeit des Aufbruchs zu einer neuen künstlerischen Kultur und wollten dazu einen Beitrag leisten, doch hatten sie noch sehr nebelhafte Vorstellungen von den politischen Zielen, sozialen Triebkräften und Bedingungen einer tiefgreifenden antifaschistisch-demokratischen Erneuerung der Gesellschaft und der Kultur. Das machte Versuche fortschrittlicher Künstler, sich zur Bewältigung ihrer Schaffensprobleme zu organisieren, verständlich. In Dresden entstand 1945 die Gruppe „Der Ruf“, in Berlin auf Initiative des Malers Fritz Duda die „Arbeitsgemeinschaft sozialistischer Künstler“, die sich an der 1928 entstandenen Assoziation Revolutionärer bildender Künstler (Asso) orientierte. Diese Arbeitsgemeinschaften entwickelten sich zeitweilig trotz gewisser sektiererischer Züge zu Konzentrationspunkten des progressiven Kunstlebens. Im Herbst 1945 bildete sich innerhalb der freien Gewerkschaften die Gewerkschaft Kunst und Schrifttum heraus, deren Sektionen Künstler der verschiedenen Kunstbereiche zur ersten Berufsorganisation im Rahmen der Ostzone vereinigten.
Künstler aller Schaffensbereiche verlangte es danach, wieder vor die Öffentlichkeit treten zu können. In den Monaten Mai/Juni 1946 wurde im .noch stark beschädigten Berliner Zeughaus die I. Deutsche Kunstausstellung der Deutschen Verwaltung für Volksbildung gezeigt, die „eine erste Inventur“* bieten und die in der Ostzone lebenden aufbauwilligen Kräfte unter den deutschen Kunstschaffenden zusammenführen sollte. Die Ausstellung vermittelte die erste große Begegnung mit Werken der antifaschistischen Kunst und war eine Ehrung von Künstlern des antifaschistischen Widerstandes wie Fritz Schulze, Fritz Schumacher, Hans und Lea Grundig und anderen. Bedeutende Bildwerke humanistischer Künstler von Rang und Namen waren zu sehen. Genannt seien Ernst Barlach, Heinrich Drake, Fritz Kühn, Bernhard Kretzschmar, Gerhard Marcks, Otto Niemeyer-Holstein, Max Pechstein, Wilhelm Rudolph, Renee Sintenis, Albert Schäfer-Ast, Karl Schmidt-Rottluff oder Herbert Tucholski.
Nacht über Deutschland. Triptychon von Horst Strempel, 1946. Staatliche Museen zu Berlin, Nationalgalerie/’DDR
Im Sommer 1946 organisierte der sächsische Staatssekretär für Kulturfragen, Herbert Gute, auf Initiative der Landesregierung Sachsen und des Kulturbundes gemeinsam mit der Dresdner Stadtverwaltung in der alten Kunststadt Dresden die I. Allgemeine Deutsche Kunstaustellung, die einen noch umfassenderen Überblick über den Entwicklungsstand der bildenden Kunst gab, da sie das Kunstschaffen aller Besatzungszonen berücksichtigte und somit politisch-moralische wie ästhetische Standorte von Künstlern in ihrer Varianzbreite noch deutlicher erkennen ließ. Die unter der künstlerischen Leitung von Hans Grundig entstandene Ausstellung, besucht von mehr als 75000 Menschen, war für Kunstpolitiker und Künstler Anlaß, über antifaschistisch-demokratische Kunstkonzepte intensiver nachzudenken. Ihr folgte ein Kongreß von Kulturschaffenden, auf welchem die aktuellen gesellschaftlichen und ästhetischen Fragen des Kunstschaffens sehr offen und auch kontrovers diskutiert wurden. Sowjetische Kulturoffiziere wie S. I. Tjulpanow, I. N. Fradkin und A.L. Dymschitz, aber auch antifaschistische deutsche Kulturpolitiker und Kulturschaffende wie Herbert Gute und Hermann Henselmann orientierten dort die nach neuen Haltungen suchenden Künstler auf eine volksverbundene, streitbare humanistische Kunst von gesellschaftlicher Relevanz und forderten sie zur aktiven Teilnahme an der Neugestaltung der Gesellschaft auf.
Neuansätze gab es auch in anderen kulturellen Bereichen. Der antifaschistisch-demokratische Neubeginn des Theaters setzte die Überwindung zahlloser praktischer Schwierigkeiten voraus, weil sich die Mehrzahl der Bühnen 1945 infolge von Kriegseinwirkungen als nicht bespielbar erwiesen. Dessenungeachtet fanden sich allerorts engagierte Regisseure, Schauspieler, Sänger, Musiker und andere Bühnenschaffende, die in Behelfsgebäuden oder notdürftig wiederhergestellten Räumen fast immer tatkräftig unterstützt von den Kommandanturen der SMAD mit der Theaterarbeit begannen. An Zuschauern mangelte es ihnen nie. Diese strömten in großen Scharen herbei, weil die Wiedereröffnung der im „totalen Krieg“ 1944 geschlossenen Spielstätten — vor allem von den traditionellen Bildungsschichten als ein wesentlicher Schritt in den Frieden und zur Normalisierung des Lebens aufgefaßt wurde.
Wartende vor der Kasse des Deutschen Theaters in Berlin, 1946
Analog zur Entwicklung in anderen Künsten begann auch die Theatertätigkeit von unterschiedlichsten weltanschaulichen und ideologischen Standorten aus. Viele der ersten Aufführungen in der Ostzone krankten an konzeptioneller Unsicherheit und einer gewissen politischen Unverbindlichkeit. Den bewußten antifaschistischen Theaterpolitikern und Theaterleitern fiel somit die Verantwortung zu, für ein sozial und politisch engagiertes, antifaschistisches, demokratisches Volkstheater zu wirken, das ideologisch aufklärend in den Prozeß der geistigen Erneuerung eingreifen konnte.
Vor allem die Viersektorenstadt Berlin und insbesondere ihr sowjetischer Sektor entwickelten sich in kurzer Frist zu einem beispielgebenden Zentrum antifaschistischer Theaterkultur. Hier wirkten antifaschistische und demokratische Theaterschaffende von Rang in Intendantenfunktionen, so Gustav von Wangenheim am Deutschen Theater und Karl-Heinz Martin am Hebbel-Theater, aber auch namhafte Schauspieler und Regisseure wie Heinrich Greif, Gerda Müller, Eduard von Winterstein, Paul Wegener, Fritz Wisten, Ernst Busch, Ernst Legal. Wegen ihrer Karriere im faschistischen Deutschland umstrittene Künstler wie Gustaf Gründgens und Wilhelm Furtwängler erhielten die Möglichkeit, mit ihrer Kunst neue Standpunkte anzusteuern. Dramatiker von der Bedeutung eines Günther Weisenborn und eines Friedrich Wolf, zu denen auch Hedda Zinner kam, arbeiteten in Berlin, desgleichen die renommierten Kritiker Herbert Ihering, Paul Rilla und Fritz Erpenbeck, die dem Nachkriegstheater zu wichtigen gesellschaftlichen und ästhetischen Einsichten verhalfen. Auf den Spielplänen der ersten Nachkriegsjahre dominierten Werke des klassischen deutschen Humanismus. Aber schon 1945 brachte Gustav von Wangenheim auch Shakespeares „Hamlet“ mit Horst Caspar in der Titelrolle heraus. Die Wiedergewinnung humanistischer Grundhaltungen bildete im Ringen um die geistige Überwindung des Faschismus eine wichtige Komponente, erforderte aber unter den Bedingungen des Kampfes um eine revolutionäre Demokratie neue Sichtund Spielweisen, zu deren Verständnis die Bühnenkünstler unter dem Einfluß marxistischer Kulturpolitiker schrittweise vordrangen. Zu den meistgespielten Autoren der Nachkriegszeit gehörte in der Ostzone Friedrich Wolf. Bei den von der Erfahrung mit Faschismus und Krieg aufgewühlten Zeitgenossen beförderten sein „Professor Mamlock“, aber auch Günther Weisenborns Stück „Die Illegalen“ die Herausbildung antifaschistisch-demokratischen Denkens und gesellschaftlichen Verantwortungsbewußtseins mit einer solchen Intensität, wie Aufführungen späterer Jahre dies wohl kaum noch erreichen konnten.
Auf den Musikbühnen gingen beliebte Werke der traditionellen Opernund Operettenliteratur in Szene. So begann der mit der Leitung der Deutschen Staatsoper in Berlin beauftragte Ernst Legal die Arbeit mit Glucks „Orpheus und Eurydike“; es folgten Verdis „Rigoletto“, Tschaikowskis „Eugen Onegin“ und andere klassische Opernwerke, in den Hauptrollen immerhin mit Stars wie Erna Berger, Margarete Klose, Tiana Lemnitz, Peter Anders, Willi Domgraf-Faßbaender und Josef Greindl. Die Städtische Oper in Berlin bewegte sich ebenfalls in diesen Geleisen. Brecht/Weills „Dreigroschenoper“ aufzuführen hatte damals nur das Hebbel-Theater den Mut. In den Operettentheatern amüsierten sich die nach Frohsinn dürstenden Menschen über die „Dollarprinzessin“, das „Schwarzwaldmädel* und das „Land des Lächelns“. Auch die Sprechbühnen brachten Lustspiele und Schwänke aller Art heraus.
Joachim Werzlau und Ferdinand May gründeten noch 1945 in Leipzig das politische Kabarett „Die Rampe“, Eberhard Schmidt in Berlin die Spieltruppe „Der Besen“, Herbert Krauß und Hermann Werner Kubsch in Dresden den „Eulenspiegel“. Mit Liedern und Chansons wie „Die Trümmerfrau“, „Der Krieg war aus“ und „Hunderttausend Steine“ brachten sie brennende Daseinsprobleme der Nachkriegszeit auf die Bühne.
Frühzeitig entstanden auch neue Werke für das Laienmusikschaffen, die die unmittelbaren Erfahrungen mit Faschismus und Befreiung zu verarbeiten suchten, so Rudolf Mauersbergers der Stadt Dresden gewidmete Motette „Wie liegt die Stadt so wüst“ oder Fidelio F. Finkes Adaption russischer Folklore „Zehn Gesänge nach alten russischen Volksliedern“. Liedtexte Walter Dehmels, der in den Traditionen sozialdemokratischer Arbeiterdichtung stand, wurden auf vielen Zusammenkünften und Veranstaltungen der Nachkriegszeit mit großem Erfolg zu Gehör gebracht, so neben anderen sein 1945 entstandener Liedtext „Wir sind die Jungen, die Unruhevollen, denen die Zukunft verlockend winkt …“ in der Vertonung von Walter Rohde.
Schon 1946 legten namhafte Architekten wie Otto Haesler, Max Taut, Heinrich Tessenow, Hans Scharoun, Reinhold Lingner und andere erste Entwürfe und Konzepte für den künftigen Wiederaufbau schwer zerstörter Städte vor. Im März 1946 öffnete in der sächsischen Landeshauptstadt eine Bauausstellung zum Thema „Das neue Dresden“ ihre Pforten. Ihr folgte im Sommer 1946 die Ausstellung „Berlin plant“. Das inhaltliche Spektrum der zur Diskussion unterbreiteten Aufbaupläne reichte von Vorschlägen zur radikalen Neugestaltung von Stadtlandschaften über Cityund Gartenstadtideen bis zu Plänen für einen Wiederaufbau nach historischem Vorbild.
Freizeitgestaltung nach dem Krieg
Antifaschistisch-demokratische Verwaltungen unternahmen mit Unterstützung der Sowjetischen Militäradministration alle Anstrengungen, inmitten der Ruinen ein vielfältiges Kulturleben zu entwickeln, das zur politisch-moralischen Überwindung und Ausmerzung des Faschismus beitragen sollte, aber eben auch Unterhaltung, Freude und Frohsinn bot. Doch Werktätige, die im Arbeitsprozeß standen und eine Familie zu ernähren hatten, verfügten damals kaum über Zeit zu aktiver Erholung. Oft genug waren viele von ihnen täglich zwölf oder gar mehr Stunden unterwegs, weil der Berufsverkehr nur mit Mühe funktionierte. Die arbeitsfreie Zeit, die sie zu Hause verbrachten, diente dem Schlaf oder dem „Organisieren“ lebenswichtiger Güter. Im Januar 1946 orientierte der Alliierte Kontrollrat die deutschen Behörden auf strenge Beachtung des Achtstundentages. Aber der Zustand der Wirtschaft forderte noch lange nicht nur großen körperlichen Einsatz, sondern manche Überstunde und manche Wochenendschicht. Alleinstehende Frauen mit Kindern oder Hausfrauen mit Familien standen in erster Linie vor der Frage, durchzukommen und das Überleben der Angehörigen zu sichern. Sie sehnten sich indes alle nach Geselligkeit und anderen kulturellen Erlebnissen, doch zumeist mußten das Radio, allenfalls der Film oder der Blick in die Zeitung genügen, das heißt, der schon traditionelle Gebrauch der Massenmedien dominierte im kulturellen Alltag. Oft aber fehlten sogar dafür, geschweige denn für anderweitige Vergnügungen Ausstattung bzw. das Geld.
Die vielen Jugendlichen und Arbeitslosen, die alleinstehenden Frauen, die Bewohner von Bunkern und Massenquartieren, heimatlose Heimkehrer oder Kriegsversehrte, auch ältere Menschen verfügten eher über die Zeit, am neu entstehenden kulturellen Leben teilzunehmen. Sie hungerten meist geradezu nach Vergnügungen und Abwechslungen aller Art, nach Informationen, Wissen, Geselligkeit und Spiel, nach Kunstgenüssen. Die antifaschistischen Funktionäre wiederum brauchten Bücher, denn nicht selten nutzten sie ihre freie Zeit bis tief in die Nacht, um sich für ihre neuen Aufgaben sachkundig zu machen. Somit war trotz zeitbedingter Hemmnisse ein vielfältiges Kulturangebot gefordert. Inhalt und Breite des kulturellen Lebens hingen zweifellos vom kulturpolitischen Engagement wie vom Niveau antifaschistisch-demokratischer Kulturarbeit und Kunstproduktion ab, jedoch ebenso vom Niveau und von der Dichte des Netzes der kulturund ideologieverbreitenden Einrichtungen, der Unterhaltungsstätten und der modernen Massenmedien. Faschismus und Krieg hatten aber Bibliotheken, Museen, Theater, Verlagshäuser und Druckereien, Sendestationen, Studios, Lichtspielhäuser, Schallplattenfirmen, Gaststätten, Varietebühnen und Buchhandlungen in unvorstellbarem Maße heimgesucht. Es fehlte an Textbüchern, Requisiten, Kostümen, Perücken, Musikinstrumenten, an Filmmaterial, Kameras, Magnettongeräten, Mikrofonen und anderer Technik sowie an Druckpapier. Presse und Rundfunk mußten darüber hinaus mit antifaschistischen und demokratischen Kadern völlig neu aufgebaut werden. Museen und Galerien waren großenteils nicht arbeitsfähig. So waren die Kunstschätze der Dresdner Gemäldegalerie zwar gerettet worden, aber ab August 1945 befanden sie sich im Moskauer Puschkinmuseum, das in überaus mühevoller Arbeit die feuchten, zum Teil von Schimmel bedeckten, mit Seidenpapier und Fischleim notdürftig abgesicherten Bildwerke restaurierte. Andere bedeutende Zeugnisse der deutschen und internationalen Kultur waren im Krieg für immer verlorengegangen oder in verlassenen Bergwerksschächten und anderen Verstecken noch nicht wieder aufgefunden.
In die Herbstmonate des Jahres 1945 fielen eine Reihe von Kulturbefehlen der SMAD, die gezielt die Wiedereröffnung der Kunstinstitutionen, der Bibliotheken und der Museen im Geiste eines kämpferischen Antifaschismus voranbrachten. Alle Leiter und Besitzer von Bibliotheken waren aufgerufen, faschistische und Kriegsliteratur sowie alle Art Literatur, die gegen die Sowjetunion und die Alliierten gerichtet war, auszusondern. Vom Kriegsende bis Mitte 1946 schufen Volksbildungsämter mit Hilfe von verantwortungsbewußten Bibliothekaren und Wissenschaftlern vieler Disziplinen durch gründliche Säuberungsaktionen die Voraussetzung dafür, daß 35 wissenschaftliche, 3 439 Volksund 806 Leihbüchereien eröffnetbzw. wiedereröffnet werden konnten. Als erste wissenschaftliche Bibliothek begann am 24. November 1945 die Deutsche Bücherei in Leipzig wieder zu arbeiten. Schon 1945 wurden die ersten Volksbuchhandlungen eingerichtet. Aufbewahrungslager für evakuierte Museumsgegenstände sammelten die vielfältigen Sachzeugen, um sie sodann restauriert an die Museen weiterzugeben. Die Museumstätigkeit wurde ab Herbst 1945 zunächst in den lokalen Heimatkundemuseen der Länder und Provinzen, die die Natur, die Arbeit und die Lebensweise der örtlichen Bevölkerung dokumentierten, in den naturwissenschaftlichen und kunsthistorischen Museen sowie in Gedenkstätten für große Humanisten wieder aufgenommen.
Nachdem als erste deutsche Verlage die Parteiverlage von KPD und SPD, Verlag Neuer Weg und der Verlag Vorwärts, mit der Arbeit begonnen hatten, machte die Herausbildung eines demokratischen Verlagswesens gute Fortschritte. Es entstanden volkseigene oder organisationseigene Verlage von großem Gewicht, wie der Aufbau-Verlag als dem Kulturbund nahestehender Verlag und der Verlag Volk und Wissen als Schulbuchverlag. Die SMAD erteilte auch politisch nicht belasteten bürgerlichen Verlagshäusern wie Reclam, Brockhaus oder dem Musikverlag Breitkopf & Härtel Lizenzen. Zu den kulturpolitisch bedeutsamen Verlagen, die 1945/46 aus der Taufe gehoben wurden, gehörten des weiteren der Henschel-Verlag und der Mitteldeutsche Verlag. Verlegt wurden in den ersten Monaten nach Kriegsende vor allem solche Bücher, von denen die deutschen Antifaschisten eine Humanisierung der Zustände und eine Aktivierung der Menschen für den antifaschistischen. Neuaufbau erwarteten. Das waren neben Arbeiten der Klassiker des Marxismus-Leninismus Schriften von Führern der Arbeiterbewegung, Werke des humanistischen Erbes, bedeutende Bücher der antifaschistischen Exilliteratur, die nur in der sowjetischen Besatzungszone eine derart massenhafte Verbreitung fand, und zeitgenössisches antifaschistisch-demokratisches Schriftgut. Im Aufbau-Verlag erschienen bis Ende 1945 bereits 14 Titel mit einer Auflage von einer Viertelmillion Bänden, darunter „Deutsches Bekenntnis“ von Johannes R.Becher, „Stalingrad“ von Theodor Plievier und „Maulwürfe — ein deutscher Bauernroman“ von Adam Scharrer. Ab 1946 edierte der Verlag in noch größerem Umfang herausragende Werke der antifaschistischen und demokratischen Literatur wie „Das siebte Kreuz“ von Anna Seghers, „Die Prüfung“ von Willi Bredel, „Der Untertan“ von Heinrich Mann, „Jeder stirbt für sich allein“ von Hans Fallada und „Die Illegalen“ von Günther Weisenborn.
Erstaunlich schnell wuchsen die Zahl der Zeitungen und Zeitschriften sowie deren Auflagenhöhen. Nach dem Stand vom Juni 1946 erschienen in der Ostzone 80 Tageszeitungen mit einer Gesamtauflage von 8,5 Millionen Exemplaren. Neben den großen politischen Zeitungen der Parteien und Massenorganisationen gab es eine Vielzahl sozial spezifizierter, kulturpolitischer oder literarisch-unterhaltender Presseerzeugnisse, darunter — um nur einige zu nennen — „Der freie Bauer“, „Neue Berliner Illustrierte“, „Neues Leben“, „Ulenspiegel“ (1945 mit amerikanischer, ab 1948 mit SMAD-Lizenz), „Frau von heute“, „Die Weltbühne“ und „Sonntag“.
Insgesamt bestand ein beträchtlicher Hunger nach Lesestoff aller Art, wenn auch die an das Lesen geknüpften Intentionen in äußerst unterschiedliche Richtungen gingen. Die einen bevorzugten Lehrund Fachbücher und wollten ihr Wissen erweitern oder die ihnen in zwölf Jahren Faschismus vorenthaltene Literatur — von den Werken der Klassiker des Marxismus über die Heinrich Heines und anderer wegen ihrer rassischen Herkunft bzw. wegen ihrer Gesinnung verpönter Autoren bis hin zur antifaschistischen Belletristik — endlich kennenlernen und vor allem der Wahrheit über die jüngste Vergangenheit näherkommen. Davon zeugten beispielsweise die hohen Ausleihzahlen von Theodor Plieviers „Stalingrad“. Andere wiederum — vor allem alte Menschen und wohl nicht zuletzt die vielen durch den Krieg alleinstehend gewordenen Frauen ohne Beruf — bevorzugten, Vergessen und Flucht aus dem bedrückenden Nachkriegsalltag suchend, vielfach Unterhaltsames und Triviales aus privaten Leihbüchereien. Junge Leute wiederum erhielten oftmals gerade durch literarische Zeugnisse der demokratischen und sozialistischen Kunst den entscheidenden Impuls, sich in den Dienst des Neuaufbaus zu stellen. Die Zahl der angemeldeten Rundfunkhörer betrug Ende 1945 bereits wieder 1.307.000 und stieg bis 31. März 1946 auf 1.531.198. Neben dem Berliner Rundfunk begannen zwischen Herbst 1945 und Dezember 1946 fünf Landessender ihre Tätigkeit. Mit Sendungen wie „Treffpunkt Berlin“, „Pulsschlag der Zeit“, „Tribüne der Demokratie“, mit dem Landfunk oder dem Schulfunk leistete der Berliner Rundfunk seit 1945 unter enger Einbeziehung (der Hörer einen beachtlichen ideologischen und mobilisierenden Beitrag zur antifaschistisch-demokratischen Umgestaltung und zum Wiederaufbau. Die am 7. Oktober 1945 in diesem Sender gestartete Sendereihe „Rettet die Kinder“ gehörte zu den ersten großen Solidaritätsaktionen des Rundfunks und brachte bis März 1946 Spenden im Werte von rund 4,5 Millionen RM ein.
Eine große Rolle im Leben der Nachkriegsbevölkerung spielte der Film. Im Sommer 1945 gab es in den Ländern und Provinzen der Ostzone 1324 Filmtheater mit 458739 Plätzen. Davon spielten täglich 497. Dazu kamen noch 77 Kinos im sowjetischen Sektor Berlins mit 28130 Plätzen, von denen 72 täglich spielten. Meist waren die Kinos bis zum letzten Platz besetzt. Nicht selten beeinträchtigten allerdings Stromsperren den Filmgenuß. Neben den von faschistischen Aussagen gereinigten Filmen aus deutscher Produktion gelangten in steigender Zahl sowjetische Filme in die Lichtspielhäuser, die die Zuschauer mit einer völlig anderen Welt konfrontierten. 1945 waren es bereits 18 Filme, darunter Sergej Eisensteins „Iwan der Schreckliche“ und Michail Romms „Lenin im Oktober“, 1946 27, darunter Grigori Alexandrows „Zirkus“ und Romms „Lenin im Jahre 1918“. Gleichwohl wuchs der Wunsch nach einer eigenen antifaschistischen, demokratischen deutschen Filmkunst. Im November 1945 fand in Berlin eine Beratung fortschrittlicher Filmschaffender statt, auf welcher Paul Wandel die Forderung erhob, einen neuen Film zu schaffen, getragen vom Geiste des Humanismus, der Völkerverständigung und der Demokratie. Ein Filmaktiv unter der Leitung von Kurt Maetzig, Hans Klering, damals Filmreferent der Deutschen Verwaltung für Volksbildung, und anderen bereitete die Aufnahme der Filmproduktion vor. Schon im Februar 1946 konnte die Premiere einer Wochenschau „Der Augenzeuge“ von Kurt Maetzig stattfinden. Es entstanden erste Dokumentarfilme, die den Wiederaufbau, die Vereinigung der Arbeiterparteien und Ergebnisse der revolutionären Umwälzungen vorstellten. Noch vor Gründung der DEFA gingen die Spielfilme „Die Mörder sind unter uns“ und „Irgendwo in Berlin“ unter der Regie von Wolfgang Staudte bzw. von Gerhard Lamprecht in Produktion. Dabei handelte es sich um Filme, die durch ihre ehrliche und konsequente Abrechnung mit dem Faschismus ein Millionenpublikum erschütterten und bewegten. Im Mai 1946 erteilte sodann die SMAD die Produktionslizenz für die Deutsche FilmAG (DEFA), die am 17. Mai 1946 feierlich übergeben wurde.
Unvermindert groß war das Interesse der Bevölkerung am Sport als Massenunterhaltung. Der Mißbrauch des Sports in den Jahren 1933 bis 1945 erforderte allerdings die gründliche Auseinandersetzung mit der faschistischen Sportpolitik und deren Folgen. Die ersten Schritte auf dem Wege zu einer antifaschistisch-demokratischen Sportbewegung unternahmen kommunale und örtliche Sportlerund Jugendgruppen, die Sportstätten enttrümmerten und Geräte sicherstellten, dann aber auch erste Sportveranstaltungen in ihren Heimatgemeinden organisierten. Dabei handelten die ehemaligen Arbeitersportorganisationen meist in Aktionseinheit und brachten ihren Willen
Dreharbeiten zum ersten DEFA-Film „Die Mörder sind unter uns‘, Mai 1946. Links: Regisseur Wolfgang Staudte
zum Ausdruck, eine einheitliche Volkssportbewegung zu schaffen. In örtlichen Verwaltungen entstanden Sportämter, die in die gleiche Richtung wirkten. Die Beschränkung der antifaschistischen Sportgruppen auf die örtliche und die Kreisebene blieb unter den Bedingungen der Entmilitarisierung des Sportwesens, die durch die Kontrollratsdirektive Nr.23 vom 17. Dezember 1945 geregelt wurde, noch einige Zeit erhalten. Sportarten wie Boxen, Judo, Segelfliegen und SchieBen waren zeitweise verboten. In Berlin fand aber schon am 30. September 1945 mit besonderer Genehmigung der Alliierten Kommandantur ein Stadtund Kreisgrenzen überschreitendes Leichtathletiksportfest statt, in dessen Rahmen auch ein Fußballspiel zwischen Berlin und Wittenberge über den Rasen ging. Sport und Wettkampfbetrieb als eine der bevorzugten Freizeitbeschäftigungen von Werktätigen entwickelten sich bis zur Jahreswende 1945/46 trotz ungenügender Ernährung beträchtlich. Allein in Berlin waren bis zu diesem Zeitpunkt schon 25000 Sportler organisiert. 1946 fanden in Berlin, Dresden, Leipzig, Chemnitz und anderen größeren Städten der sowjetischen Besatzungszone Sportfeste statt.
Nicht zu kurz kamen selbst in jenen schweren Tagen Veranstaltungen unterhaltenden Charakters und viele Formen der Geselligkeit, vor allem öffentliche Tanzvergnügen, die im letzten Kriegsjahr verboten gewesen waren. Zunächst noch durch eine Ausgangssperre ab 21 Uhr eingeschränkt, die dann Ende 1945 aufgehoben wurde, fanden nun wieder bunte Abende, Jugendtanz und allgemeine Tanzveranstaltungen statt. Tanzen weckte neuen Lebensmut, ja Lebensfreude und ließ die Armseligkeit des Nachkriegsdaseins zeitweilig vergessen. „Wir tanzten und tanzten und tanzten wie mittelalterliche Sektenspringer, Geißler, die Holzsohlen unserer Schuhe wurden zu Mulm“, beschreibt ein Zeitgenosse, der Schriftsteller Gerhard Holtz-Baumert, das übersteigerte Lebensgefühl der den tödlichen Gefahren des Krieges entronnenen Menschen.”
Varieteveranstaltungen und Bühnenschauen aller Art wurden eifrig frequentiert. Aber auch Schieberlokale und Bars entfalteten nach der Lockerung der Stromkontingentierung Anfang 1946 eine hektische Betriebsamkeit. Schwierig war es dagegen, Schausteller, Zirkusunternehmen und zoologische Gärten mit ihren Tierbeständen über die schweren Zeiten hinwegzubringen.
Da Werktätige von den kulturellen Aktivitäten nur in geringem Maße erreicht wurden, bemühten sich die Gewerkschaften um eine interessante Kulturarbeit für Arbeiter, indem sie Theaterbesuche für die Belegschaften oder Veranstaltungen im Betrieb selbst organisierten. Schon im Dezember 1945 luden die freien Gewerkschaften Vertreter des Berliner Magistrats, der Deutschen Verwaltung für Volksbildung und der Deutschen Verwaltung für Arbeit und Sozialfürsorge, Intendanten von Berliner Theatern, Leiter von Lichtspieltheatern, Künstler, Schriftsteller und Betriebsratsmitglieder zu einer Kulturkonferenz ins Berliner Stadthaus ein, um mit ihnen Fragen der kulturellen Zusammenarbeit zu beraten. Vor allem von der Jugend getragen, entstanden schon 1945 neue Chöre, Volksmusikund Laienspielgruppen, die dem Bedürfnis junger Menschen nach kultureller Betätigung und Gemeinschaftserlebnissen entgegenkamen. Diese volkskünstlerische Entwicklung trug zunächst mehr oder weniger spontanen Charakter, und die Programme waren bunt zusammengewürfelt. Unter behutsamer Einflußnahme durch SMAD und bewährte antifaschistische Kulturpolitiker, aber auch der Jugendausschüsse und später der FDJ erweiterten viele Jugendliche in diesen Gruppen ihren Gesichtskreis, lernten Werke des humanistischen bzw. des antifaschistischen Kulturerbes kennen und gewannen neue politische und weltanschauliche Einsichten.
Deutsche und internationale Arbeiterkampflieder erlangten wieder Popularität und stellten ein wesentliches Medium der Gemeinschaftsbildung dar. Dabei entsprach es der Aktionseinheit der Arbeiterparteien, daß auch das Liedgut der sozialdemokratischen Arbeiterbewegung eine echte Wiederbelebung erfuhr. So unterschiedliche Lieder wie „Brüder zur Sonne, zur Freiheit“, „Wenn die Arbeitszeit zu Ende“, „Wir sind jung, die Welt ist offen“, „Wann wir schreiten Seit an Seit“, aber auch „Die Moorsoldaten“ lösten Zuversicht und Tatbereitschaft aus und förderten das Umdenken, vor allem bei der arbeitenden Bevölkerung.
Anfang 1946 bildeten die Arbeiterparteien gemeinsam mit den Gewerkschaften einen Kulturausschuß, der sich das Ziel setzte, durch Wort und Tat die kulturellen Interessen der Arbeiterklasse in der sowjetischen Besatzungszone zu vertreten. Er organisierte im März 1946 Kulturwochen, die Werktätige und Kulturschaffende in zahlreichen Veranstaltungen bildenden und aufklärenden Charakters zusammenbrachten. Auch die Vorbereitung der Aktivitäten zum 100. Geburtstag von Franz Mehring lagen in seiner Verantwortung.
Das Ringen um die revolutionäre Einheitspartei der deutschen Arbeiterklasse. Die Gründung der SED
- 1 Das Ringen um die revolutionäre Einheitspartei der deutschen Arbeiterklasse. Die Gründung der SED
- 1.1 Die Zuspitzung gegensätzlicher Tendenzen in der Weltpolitik und auf deutschem Boden
- 1.2 Der Kurs auf die Schaffung einer revolutionären Einheitspartei der deutschen Arbeiterklasse
- 1.3 Kulturpolitik und kulturelle Programmatik der KPD
- 1.4 Die Entstehung einheitlicher Gewerkschafts- und Jugendorganisationen
- 1.5 Die Februarbeschlüsse von KPD und SPD. Die Vereinigung von „unten nach oben“
- 1.6 Scharfe Auseinandersetzungen in der Berliner SPD-Organisation. Die Spaltung der Berliner SPD
- 1.7 Die Gründung der SED als Garant der geschichtlichen Wende auf deutschem Boden
Die Zuspitzung gegensätzlicher Tendenzen in der Weltpolitik und auf deutschem Boden
Im Herbst 1945 zeichneten sich international und. auf deutschem Boden zunehmend widersprüchliche Entwicklungstrends ab. Die Wiederherstellung der Volkswirtschaft der Sowjetunion machte beträchtliche Fortschritte. In den ost- und südosteuropäischen Ländern festigte sich die Volksmacht, war eine Bodenreform vollzogen oder in Angriff genommen worden und formierte sich mit Enteignungsmaßnahmen gegen Kriegsverbrecher und Kollaborateure ein volkseigener Wirtschaftssektor. Dem Wahlsieg der Labour Party in Großbritannien vom Juli 1945 folgte im Herbst 1945 in Frankreich der Sieg der Arbeiterparteien bei den Wahlen zur Nationalversammlung der Vierten Republik. Kommunisten und Sozialisten errangen die absolute Mehrheit. Die FKP, inzwischen fast 1 Million Mitglieder zählend, wurde zur wählerstärksten Partei. In Italien zeichnete sich eine ähnliche Entwicklung ab, wenngleich hier die Christlich-Demokratische Partei als die bürgerliche Hauptpartei über stärkere Positionen verfügte als die bürgerlichen Kräfte in Frankreich. Der IKP hatten sich rund 2 Millionen Mitglieder angeschlossen. Auch in anderen Ländern Westeuropas nahm die Arbeiterbewegung einen beträchtlichen Aufschwung und mit ihr das Ringen breiter Kreise um sicheren Frieden, reale Demokratie und sozialen Fortschritt. Getragen vom Einheitsdrang der internationalen Arbeiterklasse und anderer fortschrittlicher Kräfte, wurden im Oktober/November 1945 der Weltgewerkschaftsbund (WGB), der Weltbund der Demokratischen Jugend (WBDJ) und die Internationale Demokratische Frauenföderation (IDFF) gegründet.
Die Sowjetunion rang beharrlich um die Festigung der Antihitlerkoalitiion und um die gemeinsame Durchführung ihrer Beschlüsse, insbesondere des Potsdamer Abkommens. Sie trat für die Abrüstung, das Verbot von Atomwaffen und für die ausschließliche Nutzung der Atomenergie für friedliche Zwecke ein.
Die Waffenbrüderschaft und die Ergebnisse der Kooperation der Hauptmächte der Antihitlerkoalition, der Geist und die Beschlüsse von Jalta und Potsdam beeinflußten unverkennbar die Weltpolitik und die internationalen Beziehungen, die Zusammenarbeit in der UNO, im Alliierten Kontrollrat und in anderen alliierten Kommissionen. Der Internationale Militärgerichtshof hatte seine Tätigkeit aufgenommen. Gemeinsam klagten die Verbündeten die deutschen Naziund Kriegsverbrecher an.
Doch zugleich gewannen in den herrschenden Kreisen der Westmächte und anderer Länder Bestrebungen und Kräfte an Boden, die sich gegen die Kooperation mit der Sowjetunion und die Beschlüsse von Jalta und Potsdam wandten und auf einen antisowjetischen Konfrontationskurs hinwirkten. Das von den auf eine geschichtliche Wende zielenden Bestrebungen in seiner Existenz bedrohte Monopolkapital verstärkte in Westeuropa und anderen Territorien seinen Widerstand, formierte Gegenpositionen und aktivierte mit allen verfügbaren Mitteln systemstabilisierende Potenzen und Kräfte.
Der amerikanische Präsident, Harry S. Truman, meldete einen Führungsanspruch des amerikanischen Imperialismus in bezug auf die gesamte Welt an. Gegenüber der Sowjetunion setzte er einerseits immer mehr auf eine Politik der Drohung mit der Atombombe bzw. der militärischen Stärke und zeigte er sich andererseits immer weniger zur Verständigung und zu Kompromissen bereit. Truman kritisierte seinen Außenminister James F. Byrnes wegen angeblich zu großer Nachgiebigkeit und erklärte ihm in einem Brief vom 5. Januar 1946 unumwunden: „Wenn man ihm (gemeint ist die Sowjetunion — d. V.) nicht die eiserne Faust zeigt und die stärkste Sprache Spricht, werden wir einen neuen Krieg erleben. Es gibt nur eine Sprache, die die Russen verstehen, nämlich: Wie viele Divisionen habt ihr? Ich glaube, wir sollten uns jetzt auf keine Kompromisse mehr einlassen.“
Die Sicherung des imperialistischen Einflusses in Europa, vor allem in Westund Mitteleuropa, und seine Ausdehnung auf Ostund Südosteuropa wurden zu erstrangigen Zielen der Außen-, Außenwirtschafts- und Militärpolitik der Vereinigten Staaten. Damit korrespondierte auch die Forcierung britischer Bestrebungnen zur Schaffung eines Westblocks.
Unter diesen Umständen nahmen die Schwierigkeiten in den Beziehungen zwischen den Westmächten und der Sowjetunion zu. Die Lösung anstehender Fragen wie der einer Kontrolle der US-amerikanischen Atomrüstung durch Verhandlungen rückte in unbestimmte Ferne; Fronten taten sich auf, und damit wuchsen die Polarisierungstendenzen. In der Labour Party und in den sozialdemokratischen Parteien Westeuropas traten zunehmend antikommunistische Tendenzen hervor bzw. erlangten antikommunistische Kräfte stärkeren Einfluß. In Frankreich gelang es daher nicht, eine sozialistisch-kommunistische Regierung zu bilden, obwohl die Mehrheitsverhältnisse in der Nationalversammlung dies ermöglicht hätten. Die Aktionseinheit der Arbeiterklasse erlitt Rückschläge. Bei den Wahlen in Österreich erhielten die Kommunisten im November 1945 nur 5 Prozent der Stimmen und 4 Mandate, während die bürgerliche Österreichische Volkspartei eine absolute Mehrheit erlangen konnte.
Diese Zuspitzung gegensätzlicher Tendenzen zeigte sich auch auf deutschem Boden. Während in der sowjetischen Besatzungszone im Kontext mit einer sich immer breiter und stärker entwickelnden Aktionseinheit der Arbeiterklasse, der Blockzusammenarbeit und dem Wirken demokratischer Verwaltungsorgane tiefgreifende antifaschistisch-demokratische Umwälzungen eingeleitet worden waren und voranschritten, wurden in die gleiche Richtung zielende Bestrebungen in den Westzonen nur sehr begrenzt wirksam. Dem starken Drang nach Aktionseinheit der Arbeiterklasse und nach antimonopolistisch-demokratischen Umgestaltungen wirkten die westlichen Besatzungsmächte auf vielfältige Weise entgegen. Ihre Besatzungspolitik ermöglichte es dem deutschen Monopolkapital und den mit ihm verbundenen traditionellen „Eliten“, spürbaren Einfluß auf die Bedingungen und das politische Kräfteverhältnis in den Westzonen zu gewinnen.
International und auf deutschem Boden zeigten sich somit ab Herbst 1945 deutlich Tendenzen und Erscheinungen, die sich gegen die Zusammenarbeit der Hauptmächte der Antihitlerkoalition, gegen die nationale Einheit des deutschen Volkes und dessen Streben richteten, eine tiefgreifende geschichtliche Wende zu vollziehen. Dies reflektierte sich auch in der deutschen Sozialdemokratie.
Am 5. Oktober 1945 fand unter Leitung von Kurt Schumacher eine Konferenz sozialdemokratischer Funktionäre der britischen Zone in Wennigsen bei Hannover statt. Einen Tag später berieten in Hannover in einer gesonderten Tagung die SPD-Funktionäre der amerikanischen und der französischen Zone. An dieser Tagung nahmen als Vertreter des Zentralausschusses der SPD Gustav Dahrendorf, Max Fechner und Otto Grotewohl teil.
Schumacher, der auf beiden Konferenzen referierte, entwickelte hier sein Konzept vom „Sozialismus als Tagesaufgabe“ und von einem Westeuropa des „demokratischen Sozialismus“ als „dritter Kraft“, das zugleich eine deutliche antikommunistische und antiso. wjetische Stoßrichtung enthielt. Er verunglimpfte die KPD als „Organ Moskaus“ und konstruierte unüberbrückbare Gegensätze zwischen Sozialdemokraten und Kommunisten auf Grund einer angeblichen Demokratiefeindlichkeit der KPD. Gleichzeitig mußte er zugeben, daß es auch in der Sozialdemokratie der Westzonen starke Bestrebungen zur Schaffung einer Einheitspartei durch Zusammenschluß mit der KPD gab. Den Zentralausschuß in Berlin als Parteiführung der SPD für alle Zonen zu akzeptieren lehnte er ab und behauptete, daß die organisatorische Einheit der Partei erst durch einen Reichsparteitag im Zusammenhang mit der Herstellung der Einheit Deutschlands herbeigeführt werden könnte.
Die Konferenzen benannten Schumacher als politischen Beauftragten der SPD für die westlichen Zonen, den Zentralausschuß als Führung der SPD in der Ostzone und die noch in London verbliebenen Mitglieder des ehemaligen Exilvorstandes als Vertretung der Sozialdemokratie im Ausland.
Nun baute das „Büro Schumacher“ seinen Einfluß in den Westzonen rasch aus. Die auf seinen Kurs festgelegten sozialdemokratischen Funktionäre setzten sich bis Ende 1945 in der SPD der Westzonen immer mehr durch und gelangten in den Parteibezirken oft mit Hilfe der Besatzungsmächte — in Schlüsselpositionen. Die Aktionsfähigkeit der einheitswilligen Mitglieder und Funktionäre in der SPD wurde nach den Konferenzen von Wennigsen und Hannover systematisch immer mehr eingeschränkt.
Die durch Schumacher herbeigeführte organisatorische Teilung in eine westzonale und eine ostzonale Sozialdemokratie war ein folgenschwerer Schritt, der der Herstellung der demokratischen Einheit Deutschlands ein neues Hindernis entgegenstellte und den sich entwickelnden Westzonenpartikularismus auch in die SPD der westlichen Territorien hineintrug. Deutlicher als bisher zeichneten sich nun eine proletarisch-revolutionäre und eine reformistisch-parlamentarische, „westorientierte“ Linie und damit die Gefahr einer Weichenstellung zu zwei unterschiedlichen und getrennten Wegen der deutschen Sozialdemokratie ab.
Der Kurs auf die Schaffung einer revolutionären Einheitspartei der deutschen Arbeiterklasse
Angesichts der Entwicklungstendenzen im internationalen Maßstab und auf deutschem Boden, insbesondere der sich in der deutschen Sozialdemokratie abzeichnenden zwei unterschiedlichen Linien, stellte sich die Frage der Schaffung einer Einheitspartei auf neue Weise und drängte zu einer Entscheidung. Dies reflektierte auch eine Funktionärskonferenz der SPD, die am 14. September 1945 in Berlin stattfand. Otto Grotewohl erklärte, die weitgehende Übereinstimmung mit der KPD in Grundfragen betonend, in seinem Referat: „Die organisatorische Vereinigung der deutschen Arbeiterbewegung und die Schaffung einer sozialistischen Gesellschaft sind unser unverrückbares Ziel. Damit dürfte unser Verhältnis zur Bruderpartei geklärt sein.“°! Der Vorsitzende des ZA der SPD schätzte zugleich ein, daß die Bedingungen „für eine organisatorische Vereinigung noch nicht erfüllt sind“. Er orientierte darauf, die SPD in ganz Deutschland zu organisieren und die Entscheidung über die Vereinigung mit der KPD auf einem Reichsparteitag zu treffen. Aus dieser Orientierung konnte die Gefahr erwachsen, daß eine Vereinigung von KPD und SPD auf unbestimmte Zeit hinausgeschoben wurde und dies darüber hinaus den Einheitsgegnern die Möglichkeit eröffnen würde, eine Vereinigung von KPD und SPD überhaupt zu verhindern.
Die Parteiführung der KPD gelangte unter diesen Umständen und veränderten Bedingungen zu der Auffassung, daß es nunmehr unbedingt notwendig sei, unmittelbar Kurs auf die Vorbereitung der Vereinigung von KPD und SPD zu nehmen und diese zu vollziehen — auch dann, wenn noch nicht alle notwendigen Klärungsprozesse bis zur Vereinigung vollendet sein würden. In diesem Sinne erhob Wilhelm Pieck auf einer Großkundgebung zur Bodenreform in Berlin am 19. September 1945 erstmals öffentlich die Forderung, beide Parteien sollten „die Schaffung einer kampffähigen Einheit der Arbeiterklasse“ vorbereiten und Kurs „auf eine möglichst baldige Vereinigung“ nehmen.
Im September/Oktober 1945 wurden gemeinsame Arbeitsausschüsse der Landesund Provinzialvorstände von KPD und SPD geschaffen. Solche Ausschüsse entstanden auch auf Kreis-, Ortsund Betriebsebene. Die Parteien beschlossen Maßnahmen zur Beschleunigung des ideologischen Klärungsprozesses und zur Schulungstätigkeit. Die Grundorganisationen beider Arbeiterparteien verstärkten ihre Zusammenarbeit.
KPD und SPD nutzten zur Entfaltung der Aktionseinheit vor allem die Gedenktage im Herbst 1945, den 28. Jahrestag der Oktoberrevolution, den 27. Jahrestag der Novemberrevolution sowie den 125. Geburtstag von Friedrich Engels, und bezogen die Erläuterung der Beschlüsse des Potsdamer Abkommens und der Anklageschriften im Nürnberger Prozeß gegen die Hauptkriegsverbrecher in den ideologischen Klärungsprozeß ein. Wilhelm Pieck leitete auf der vom Zentralkomitee der KPD veranstalteten Großkundgebung am 9. November 1945 in Berlin in seiner Rede über „Die Lehren der deutschen Novemberrevolution und die Ergebnisse der Großen Sozialistischen Oktoberrevolution“ drei Hauptaufgaben daraus ab: erstens unter allen Umständen und mit ganzer Kraft die organisatorische Einheit der Arbeiterklasse herzustellen und die Einheitsfront der vier Parteien auszubauen; zweitens einen neuen Staat mit einer wahrhaft kämpferischen Demokratie und einem antifaschistisch-demokratischen Regime unter Führung der Arbeiterklasse zu errichten; drittens allmählich die engsten wirtschaftlichen, politischen und kulturellen Beziehungen zur UdSSR zu entwickeln und schrittweise wieder die Achtung und das Vertrauen der friedliebenden Völker zu erwerben.
Der Vereinigungsprozeß wurde in entscheidendem Maße durch das Zusammenwirken von Kommunisten und Sozialdemokraten in den Gewerkschaften und Betriebsräten, bei der Bodenreform, der Schulreform, der Entnazifizierung, der Sequestrierung und im Ringen um die Enteignung der Naziund Kriegsverbrecher befördert. In der politischen Praxis wuchs die Gemeinsamkeit von KPD und SPD, schwand das gegenseitige Mißtrauen und wurden die antikommunistischen Argumente der Einheitsgegner widerlegt. Der damalige Vorsitzende des SPD-Provinzialvorstandes Sachsen, Werner Bruschke, betonte in diesem Zusammenhang: „Für uns ehemalige Sozialdemokraten war der ganze Prozeß der antifaschistisch-demokratischen Umwälzung eine hervorragende Schule des Marxismus-Leninismus.“
Die Zustimmung von großen Teilen der Arbeiterklasse und von anderen Werktätigen zu diesem Kurs sowie die Massenverbundenheit der Arbeiterparteien fanden einen deutlichen Niederschlag auch in der Mitgliederbewegung von KPD und SPD. Von September bis Dezember 1945 wuchs die Zahl der KPD-Mitglieder in der Ostzone von 179000 auf über 372000 an. Das waren fast viermal soviel wie 1933 auf diesem Territorium. Fast ein Drittel davon gehörten an der Jahreswende zur KPD-Landesorganisation Sachsen. Ende Januar 1946 betrug der Arbeiteranteil an der Mitgliedschaft der KPD (ohne Angestellte und Landarbeiter) 56,8 Prozent. Während die SPD in den Westzonen ihren Vorkriegsmitgliederstand zunächst nicht wieder erreichte, hatte sie in der Ostzone einen großen Zuwachs. Im Dezember 1945 umfaßte die SPD fast 420.000 Mitglieder. Von den Landesbzw. Provinzialorganisationen der SPD hatten die des Landes und die der Provinz Sachsen daran den größten Anteil.
Am 20. und 21. Dezember 1945 fand auf Vorschlag des ZK der KPD eine von den Führungen beider Arbeiterparteien einberufene gemeinsame Funktionärskonferenz in Berlin statt. An ihr nahmen je 34 Vertreter von KPD und SPD teil. Wilhelm Pieck und Otto Grotewohl hielten die Hauptreferate zum Thema
Schaffung einer einheitlichen Arbeiterpartei. Der Vorsitzende der KPD begründete die Notwendigkeit der baldigen Vereinigung der Arbeiterparteien. Sie bilde die Voraussetzung, um mit der ganzen Kraft der geeinten Arbeiterklasse „nicht nur die reaktionären Versuche bereits im Keime zu ersticken“, sondern auch „die größten Notstände schnell zu beiseitigen und das Vertrauen zum Aufbau eines neuen, demokratischen Staates im deutschen Volke zu stärken“.°° Otto Grotewohl bekannte sich in seinem Referat, wie die Mehrheit der anwesenden Sozialdemokraten, grundsätzlich zur Vereinigung, teilte jedoch auch mit, daß in der SPD noch Bedenken gegen die Vereinigung bestünden. Die intensive Aussprache und die zugunsten der Vereinigung vorgebrachten überzeugenden Argumente veranlaßten eine Reihe sozialdemokratischer Funktionäre noch während der Konferenz, ihre Einwände und Vorbehalte zu bedenken und schließlich die Vereinigung zu befürworten.
So konnte die Konferenz mit großer Mehrheit beschließen, die „Verschmelzung“ von KPD und SPD „zu einer einheitlichen Partei“ vorzubereiten.’° Die Einheitsgegner erlitten eine Niederlage. Entscheidenden Anteil an diesem Ergebnis hatten neben den beiden Parteivorsitzenden Anton Ackermann, Franz Dahlem und Walter Ulbricht vom ZK der KPD, Max Fechner und Helmut Lehmann vom ZA der SPD sowie die Vorsitzenden der Landesparteiorganisationen Sachsen der KPD bzw. der SPD, Hermann Matern und Otto Buchwitz, die an der Spitze der beiden stärksten Landesparteiorganisationen der Ostzone standen.
Eine grundsätzliche Übereinstimmung über Charakter und Ziel der Einheitspartei kam zustande. Sie sollte auf revolutionärer. Grundlage, auf dem Boden der marxistischen Programmdokumente der deutschen Arbeiterbewegung entstehen. Die Ergebnisse der Konferenz wurden in einer Entschließung zusammengefaßt. Diese kennzeichnete die künftige Einheitspartei als „Klassenpartei der Arbeiter“ und als „Partei des schaffenden Volkes in allen seinen Schichten“, die „die Sache des Friedens, der Demokratie, des Fortschritts und des Sozialismus“ fördern „und jedwede Äußerung des Chauvinismus, der Rassenund Völkerhetze wie der Hetze gegen die Sowjetunion energisch“ bekämpfen sollte.” Das Programm der künftigen Einheitspartei sollte im „Minimum“ auf „die Vollendung der demokratischen Erneuerung Deutschlands“ und im „Maximum“ auf „die Verwirklichung des Sozialismus auf dem Wege der Ausübung der politischen Herrschaft der Arbeiterklasse“ orientieren. In seinem Schlußwort ging Otto Grotewohl davon aus, daß auch weiterhin die Vereinigung von KPD und SPD in ganz Deutschland angestrebt werden müsse. Sollte sich das nicht erreichen lassen, werde der Zentralausschuß der SPD neue Beschlüsse fassen.
Die Konferenz wählte eine gemeinsame‘ Studienkommission. Diese erhielt den Auftrag, die programmatischen Dokumente der Einheitspartei vorzubereiten. Außerdem wurde vereinbart, gemeinsam eine theoretische Zeitschrift unter dem Titel „Einheit“ herauszugeben, eine gemeinsame Schulungstätigkeit zu organisieren, die Gewerkschaftsarbeit besser abzustimmen und auf allen Gebieten noch enger zusammenzuarbeiten.
Die Beschlüsse der Dezemberkonferenz fanden in den Organisationen beider Parteien, aber auch in den Gewerkschaften eine große Resonanz. Tausende von Zustimmungserklärungen kamen aus Betrieben, von Gemeinde-, Stadtund Kreisorganisationen. Überall faßten kommunistische und sozialdemokratische Parteiorganisationen Beschlüsse zur engeren Zusammenarbeit. Es entstanden Einheitsbüros, Organisationsausschüsse und gemeinsame Kommissionen für Wirtschaft, Landwirtschaft, Ernährung, Sozialpolitik, für Gewerkschaftsund Genossenschaftsfragen. In einer Reihe von Großbetrieben gingen die Betriebsgruppen der KPD und unter deren Einfluß auch die der SPD über die Dezemberbeschlüsse hinaus. Sie führten Mitgliederversammlungen und Schulungen nur noch gemeinsam durch. Schließlich vollzogen einzelne Betriebsgruppen bereits im Januar/Februar 1946 ihre Vereinigung.
In der Entschließung der gemeinsamen Funktionärskonferenz der Betriebsgruppen von KPD und SPD in den Leunawerken vom 18. Februar einer typischen Äußerung jener Zeit — wurde erklärt: „Wir Sozialdemokraten und Kommunisten des Leuna-Werkes sind der Ansicht, daß schon genug von der Einheit geredet worden ist. Wir müssen jetzt die Einheit durchführen.“ Gleichzeitig wurden aber auch jene Kräfte, die sich der Vereinigung aus unterschiedlichen Motiven widersetzten, vor allem die antikommunistischen Einheitsfeinde in der SPD, aktiver.
Kulturpolitik und kulturelle Programmatik der KPD
Auf ihrer ersten zentralen Kulturtagung, die vom 3. bis 5. Februar 1946 in Berlin stattfand, legte die KPD vor leitenden Funktionären der Arbeiterbewegung sowie der zentralen und regionalen Verwaltungen für Volksbildung, vor namhaften Künstlern und Wissenschaftlern, vor Pfarrern, Dorfschullehrern, Vertretern der Jugendund Frauenausschüsse und vor Angehörigen aller demokratischen Parteien und Massenorganisationen erstmals nach dem Krieg in umfassender Weise ihr Verhältnis zu Fragen der Kultur dar, erläuterte sie ihre in den Lernprozessen der Partei nach 1933 entstandenen kulturund bündnispolitischen Konzepte. Der Parteivorsitzende der KPD hielt selbst die einleitende Rede über das Programm der kulturellen Erneuerung und dokumentierte damit, daß die KPD so wie für Politik und Wirtschaft auch für die Bereiche der Kultur Verantwortung übernehmen wollte und konnte. Zugleich gehörte die Konferenz, an der auch eine Delegation des Zentralausschusses der SPD teilnahm, zu jenen Beratungen, die die Vereinigung von KPD und SPD inhaltlich vorbereiteten, indem sie die Gemeinsamkeiten in kulturpolitischen Grundfragen verdeutlichte und weitere Klärungsprozesse initiierte.
Ausgehend von der „beispiellosen Katastrophe“, die der Hitlerfaschismus über das deutsche Volk gebracht hatte, verwies Wilhelm Pieck auf die „Prostituierung, Schändung und Barbarisierung von Kunst und Wissenschaft“, auf den Rassenwahn, auf „die zu Kasernen herabgewürdigten Volksschulen“, auf die verbrecherische faschistische „Menschenformung“ sowie auf den tiefen Bildungsund Kulturverfall im Ergebnis der faschistischen Kulturpolitik und leitete aus diesen bitteren Erfahrungen die Pflicht für jeden Antifaschisten und Demokraten ab, das wiedererwachende Kulturleben für alle Zeiten von Faschisten und Naziideologie zu säubern.
Damit orientierte der Vorsitzende der KPD auf die Fortsetzung der Volksfrontpolitik auch unter den veränderten Bedingungen nach der Befreiung vom Faschismus. Wesentliche Überlegungen galten dabei dem dringend gebotenen Bündnis mit der Intelligenz, die für den Prozeß der kulturellen Erneuerung und für den antifaschistisch-demokratischen Neuaufbau zu gewinnen war. Und daher stand an der Spitze des programmatischen Konzepts der KPD die Forderung, „daß der wissenschaftlichen Forschung und dem künstlerischen Schaffen unbedingte Freiheit und jede materielle und moralische Unterstützung zugesichert“ werden müssen.‘! Zugleich setzte jedoch eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit der Intelligenz nach Meinung der Kommunisten auch voraus, daß sich deren Angehörige des Versagens vieler deutscher Intellektueller gegenüber dem Faschismus und ihrer Anfälligkeit für reaktionäre Ideologien bewußt zu werden begannen.
Dem werktätigen Volk sollten die kulturellen Umwälzungen einen breiteren Zugang zur Kunst und zur kulturell-künstlerischen Betätigung eröffnen. Die wichtigste, weil am tiefsten greifende kulturpolitische Umgestaltung im Sinne der arbeitenden Klassen war und blieb in den Augen der revolutionären Antifaschisten aber die demokratische Bildungsreform, die auch im Zentrum der Kulturtagung stand. Problemen der Volksbildung waren immerhin zwei grundsätzliche Referate von Josef Naas und Walter Bartel gewidmet, wobei letzterer, der ehemalige Vorsitzende des Internationalen Lagerkomitees im KZ Buchenwald, über die neue Volkshochschule sprach.
Hatte Wilhelm Pieck die unmittelbaren kulturpolitischen Aufgaben der antifaschistisch-demokratischen Umwälzung angesprochen, so legte Anton Ackermann in seinem Hauptreferat einen eindrucksvollen Entwurf der langfristigen kulturellen Strategie der KPD vor, der den Gesamtprozeß der Kulturrevolution bis zur Schaffung der sozialistischen Gesellschaft theoretisch auszuschreiten suchte. Höchst bedeutsam, weil wegweisend für künftige kulturelle Aufgaben und Entwicklungen war sein Versuch, die theoretische Kulturauffassung der KPD unter dem Aspekt der dialektischen Einheit von materiellen und geistigen Faktoren zu formulieren.
Ackermanns kulturtheoretischer Ansatz besagte entsprechend, daß „eine hochstehende Kultur“ nicht nur durch einen hohen Stand der Wissenschaft, Literatur, Kunst und Volksbildung gekennzeichnet ist, „sondern ebenso dadurch, daß die Menschen in menschenwürdigen Wohnungen leben, sich menschenwürdig ernähren und kleiden können und alle Voraussetzungen einer hochstehenden Volkshygiene gegeben sind. So gehört zur Kultur ebenso das Buch und das Kunstwerk wie die Kanalisationsanlage und der Wohnungsbau. Reichtum oder Armut an materiellen wie geistigen Gütern und Werten machen einen hohen oder niedrigen Stand der Kultur eines Volkes aus.
Mit Nachdruck hob Anton Ackermann den Anteil der werktätigen Klassen und Schichten an der Schaffung materieller und geistiger Kulturwerte hervor und begründete damit ihren Anspruch auch auf den Genuß der kulturellen Errungenschaften in ihrer Gesamtheit. Entschieden wende sich die KPD dagegen, Kultur „als Vorrecht und Privileg nur für eine Klasse oder einige Schichten zu reservieren“. Diese Einsicht habe sie daher auch zu dem Schluß geführt, „daß die kulturelle Erneuerung Deutschlands Sache nicht nur einzelner Spezialisten auf dem Gebiete der Kultur, nicht nur einzelner Berufe sein kann, sondern daß sie Sache des ganzen schaffenden Volkes ist“.
In den Referaten wie auch in vielen Diskussionsreden kam das Bemühen der KPD um ein neues, schöpferisches Verhältnis zum humanistischen kulturellen Erbe ebenso zum Ausdruck wie ihre enge Beziehung zu den progressiven und revolutionären Traditionen der deutschen Geschichte — von den revolutionären Bauernbewegungen, dem Wirken Thomas Müntzers bis hin zum kämpferischen Antifaschismus. Auch ihre Haltung zum eigenen proletarischen Erbe wurde umrissen, wenn Ackermann erklärte, daß weder aus der politischen noch aus der Kulturgeschichte des 19. und 20. Jahrhunderts „die Arbeiterbewegung und der Marxismus hinwegzuzaubern“ wären, „ohne eine grobe Geschichtsfälschung zu begehen“.
Zentrale Kulturtagung der KPD in Berlin, 3. bis 5. Februar 1946. Blick auf das Präsidium
Angesichts des durch Faschismus und Krieg bedingten Kulturverfalls besaß die Orientierung auf das humanistische Erbe der bürgerlich-klassischen deutschen Literatur, Philosophie und Wissenschaft eine besondere Funktion. Die zu den bedeutenden Kulturwerten der Menschheit gehörende geistige Hinterlassenschaft eines Leibniz, von Lessing, Goethe, Schiller, Freiligrath, Heine, Feuerbach, Hegel und anderen vermochte im Prozeß der Faschismusbewältigung eine wichtige aufklärerische und humanisierende Rolle zu spielen.
Wilhelm Pieck und Anton Ackermann wandten sich entschieden gegen nationalen Nihilismus. Ihre Auffassung, daß nunmehr die Arbeiterklasse die Interessen der Nation zu vertreten hatte, wurde vor allem durch Paul Wandels Diskussionsbeitrag erhärtet.
Es konnte nicht Aufgabe der Konferenz sein, alle kultur- und kunstpolitischen Fragen der Zeit zu klären. So manche blieben offen oder umstritten — etwa die Probleme einer modernen Massenkultur oder die schwierige Frage des Verhältnisses zum spätbürgerlichen Kulturerbe. Insgesamt machte die Tagung aber ersichtlich, daß die KPD kulturelle und kulturpolitische Zielsetzungen als gleichwertige Bestandteile ihrer gesellschaftlichen Gesamtstrategie betrachtete. „Wir wollen durch diese Arbeit den Weg frei machen für eine sozialistische Gesellschaftsordnung“, hatte Wilhelm Pieck verdeutlicht, „die keine Ausbeutung und keine Knechtschaft kennt, sondern in der das Glück und der Wohlstand und die Kultur unseres Volkes zur höchsten Entfaltung gebracht werden.“
Auf der Tagung wurden richtungweisende und perspektivisch weitreichende Orientierungen gegeben, die schon bald darauf von der SED aufgegriffen wurden. Von ihr gingen tiefgreifende Wirkungen auf die revolutionäre Praxis aus, erhielt der kulturrevolutionäre Prozeß starke Impulse.
Die Entstehung einheitlicher Gewerkschafts- und Jugendorganisationen
Am 21.November 1945 vereinbarten die Vertreter der Landes- und Provinzialausschüsse der Gewerkschaften der Ostzone in Potsdam, einen zentralen Gewerkschaftskongreß einzuberufen. Die Veröffentlichung der Entwürfe der programmatischen Dokumente „Sichert die Einheit in den Betrieben — Grundsätze und Aufgaben der freien Gewerkschaften“ und „Richtlinien für die Delegiertenwahlen“, die am 5. Dezember erfolgte, bereiteten ihn vor. Von Anfang Januar bis Anfang Februar 1946 fanden auf Orts-, Kreis- und Landes- bzw. Provinzialdelegiertenkonferenzen die Gewerkschaftswahlen statt. Sie reflektierten den beträchtlichen Entwicklungsund Reifeprozeß, den Arbeiterklasse und Gewerkschaften seit der Befreiung vom Faschismus im Ringen um antifaschistisch-demokratische Umgestaltungen bereits durchlaufen hatten. Andererseits wurde die neue gesellschaftliche Rolle der Gewerkschaften von vielen Mitgliedern, die im traditionellen Denken befangen waren, noch nicht voll erkannt. Auf den Konferenzen kam es oft auch zu scharfen ideologischen Auseinandersetzungen mit Auffassungen, die sich gegen die Vereinigung von KPD und SPD richteten.
In Berlin spitzten sich diese Auseinandersetzungen besonders zu. Eine Reihe von Gewerkschaftsfunktionären bzw. sozialdemokratischen Einheitsgegnern versuchten gemeinsam mit den westlichen Besatzungsmächten, die Gewerkschaftswahlen zu einem Kräftemessen zwischen Kommunisten und Sozialdemokraten zu gestalten und einheitsfeindliche Mehrheiten in den Vorständen des Freien Deutschen Gewerkschaftsbundes von Groß-Berlin zu erreichen. Deshalb attakkierten sie die gemeinsamen Beschlüsse von KPD und SPD zur Unterstützung der Gewerkschaften und die Entwürfe der programmatischen Dokumente für die Einheitsgewerkschaften. Sie wollten gesonderte Gewerkschaften in den Westsektoren schaffen.
Sowohl auf den 20 Stadtbezirkskonferenzen der Berliner Gewerkschaften am 27. Januar 1946 mit insgesamt 5000 Delegierten als auch auf der ersten Delegiertenkonferenz des FDGB von Groß-Berlin am 2. und 3. Februar 1946 setzten sich jedoch jene Gewerkschaftsfunktionäre durch, die sich auf den Boden der programmatischen Dokumente stellten und für die Vereinigung eintraten.
Die SMAD förderte die Formierung demokratischer Einheitsgewerkschaften. Sie unterstützte die Herausgabe der ersten Gewerkschaftszeitung, die unter dem Titel „Die Freie Gewerkschaft“ ab Oktober 1945 erschien, half bei der materiellen Absicherung der Arbeit und trug mit einer Vielzahl von Beiträgen in der „Täglichen Rundschau“ zu einer breiten politisch-propagandistischen Aufklärung über die Rolle der Gewerkschaften beim demokratischen Neuaufbau bei.
Von 9. bis 11. Februar 1946 tagte im Berliner „Admiralspalast“, dem damaligen Domizil der Deutschen Staatsoper, der 1. Kongreß des Freien Deutschen Gewerkschaftsbundes (FDGB). An ihm nahmen 1019 Delegierte der Gewerkschaften der Ostzone und 150 Gastdelegierte des Berliner FDGB teil. Außerdem waren auch Repräsentanten der alliierten Besatzungsmächte, der antifaschistisch-demokratischen Parteien, der Massenorganisationen, der Verwaltungsorgane sowie Gewerkschafter aus den ‚Westzonen anwesend. Die Delegierten aus der Ostzone vertraten etwa 2,2 Millionen Gewerkschaftsmitglieder.
Der FDGB bekannte sich zu den Zielen des Weltgewerkschaftsbundes, zur antifaschistisch-demokratischen Umwälzung und zur Errichtung eines einheitlichen deutschen Friedensstaates. Er orientierte darauf, die werktätigen Massen zur Solidarität und zum Klassenbewußtsein zu erziehen, die Naziund Kriegsverbrecher zu entmachten, maßgeblich an der Arbeit aller Verwaltungs- und Wirtschaftsorgane mitzuwirken, das Mitbestimmungsrecht der Gewerkschaften und der Betriebsräte zu erweitern sowie entschieden auf die Verbesserung der Arbeitsund Lebensbedingungen Einfluß zu nehmen.
In Übereinstimmung mit dem Willen von Millionen Gewerkschaftsmitgliedern entstand der FDGB als Einheitsgewerkschaft nach dem Prinzip „Ein Betrieb — eine Gewerkschaft“. Sein 1. Kongreß wurde zu einem Höhepunkt in den Auseinandersetzungen um die Einheit der Arbeiterklasse. In großer Einmütigkeit und unter Zurückweisung anderer Auffassungen sprachen sich die Delegierten dafür aus, die Vereinigung von KPD und SPD so schnell wie möglich zu verwirklichen.
Der 1.Kongreß des FDGB beschloß folgende Dokumente: „Sichert die Einheit in den Betrieben Grundsätze und Aufgaben des FDGB“; „Aufgaben und Rechte der Betriebsräte“; Vorläufige Satzung des FDGB. Er nahm Resolutionen zum Kriegsverbrecherprozeß in Nürnberg, zur Liquidierung der Großbanken, zur Hilfe für die Neubauern und zu den Forderungen der Jugend an. Die Entschließung kennzeichnete den FDGB als einheitliche Massenorganisation aller Arbeiter und Angestellten. Der Kongreß wählte den Bundesvorstand des FDGB als dessen Führungsorgan und Hans Jendretzky (KPD) zum 1. Vorsitzenden des Bundesvorstandes, Bernhard Göring (SPD) zum 2. und Ermst Lemmer (CDU) zum 3. Vorsitzenden. Mit Jendretzky trat an die Spitze des FDGB ein in langjährigen Klassenauseinandersetzungen erfahrener, im antifaschistischen Widerstandskampf bewährter Funktionär des ehemaligen Deutschen Metallarbeiterverbandes.
Parallel zur Gewerkschaftseinheit entwickelte sich die Bewegung zur Schaffung einer einheitlichen antifaschistisch-demokratischen Jugendorganisation. Viele Jugendliche gelangten zu neuen Einsichten und verstärktem politischem Engagement. Der Kreis derjenigen, die sich aktiv für die Einheit der Jugendbewegung einsetzten, wuchs stetig. Andererseits stand die Masse der Jugendlichen noch abseits; viele lehnten politische Tätigkeit ab. Der Gedanke, eine einheitliche antifaschistisch-demokratische Jugendorganisation zu schaffen, stieß bei Teilen der Jugend, in Kreisen von CDU und LDPD und in denen der Kirche auf unterschiedlich motivierte Vorbehalte und auch auf Ablehnung. Er mußte sich gegen überkommene Traditionen und Auffassungen Bahn brechen. Vor allem lehnten natürlich die Gegner der antifaschistisch-demokratischen Umwälzung die Herausbildung einer einheitlichen, antifaschistischen Jugendorganisation ab und suchten diese sogar durch Vergleiche mit der Hitlerjugend zu diffamieren. Sozialdemokraten in den Westsektoren Berlins, die vor. Funktionären der SPD in den Westzonen unterstützt wurden, forderten den Aufbau einer eigenen sozialdemokratischen Jugendorganisation.
Erster Kongreß des FDGB im Berliner Admiralspalast, 9. bis 11. Februar 1946
Am 2. und 3. Dezember 1945 kamen erstmals die Funktionäre der antifaschistischen Jugendaussschüsse aus der gesamten Ostzone in Berlin zusammen. Der Verlauf dieser Beratung zeigte, daß es einerseits noch sehr unterschiedliche Standpunkte gab, andererseits aber das Streben nach Einheit aller demokratischen Kräfte der Jugend sehr stark war. Funktionäre, die aus der kommunistischen und sozialistischen Arbeiterjugend stammten und die die übereinstimmende Konzeption des ZK der KPD und des ZA der SPD für die Schaffung einer einheitlichen Jugendorganisation vertraten, setzten sich mit Angriffen auf dieses Konzept entschieden auseinander und sprachen sich für eine gleichberechtigte Zusammenarbeit der Angehörigen der jungen Generation aus allen Klassen und Schichten sowie aller Weltanschauungen aus. Die Tagung begrüßte die Bildung des Weltbundes der Demokratischen Jugend und dessen Ziele. Von Dezember 1945 bis Anfang Februar 1946 wurden in allen Ländern und Provinzen der Ostzone Delegiertenkonferenzen der antifaschistischen Jugendausschüsse durchgeführt. Ihr Einfluß auf das gesellschaftliche Leben in vielen Bereichen wuchs. In einzelnen Betrieben und Einrichtungen, in Städten und Dörfern entstanden Jugendgruppen, die teilweise schon den Namen „Freie Deutsche Jugend“ (FDJ) trugen.
Theo Wiechert, Erich Honecker und Paul Verner (v.1.n.r.) bei der Unterzeichnung des Beschlusses über die Gründung der FDJ, März 1946
Ein bedeutsamer Schritt zur Gründung einer einheitlichen Jugendorganisation war die Beratung von Jugendfunktionären der KPD und der SPD am 7. Februar 1946 in Berlin. Hier gelang es, eine Übereinstimmung über die Ziele, den organisatorischen Aufbau und die nächsten Schritte zur Bildung der FDJ herbeizuführen. Diese sollte eine einheitliche, demokratische und überparteiliche, aber nicht unpolitische Massenorganisation der Jugend werden und konsequent mit allen die antifaschistisch-demokratische Umwälzung tragenden Kräften, Parteien und Organisationen zusammenarbeiten. Am 7. März 1946 genehmigte die SMAD den Antrag des Zentralen antifaschistischen Jugendausschusses zur Bildung dieser Jugendorganisation. Dieser Antrag, der von Erich Honecker, Theo Wiechert, Edith Baumann, Paul Verner, Manfred Klein, Gerhard Polack, Rudolf Mießner, Emil Amft, Rudolf Böhme, Fritz Votava, Robert Lange, Heinz Keßler, Heinrich Külkens und Ostwald Hanisch unterzeichnet war, wurde zur Geburtsurkunde der FDJ.
Mit ihrem I. Parlament, das vom 8. bis 10.Juni 1946 in Brandenburg stattfand, konstituierte sich die Freie Deutsche Jugend als einheitliche Jugendorganisation mit bereits 240 500 Mitgliedern. Das Parlament verabschiedete die Dokumente „Grundsätze und Ziele der FDJ“ und „Grundrechte der jungen Generation“, in denen die Forderungen der FDJ zusammengefaßt waren, sowie die Statuten. Sie bildeten die Grundlage ihrer Tätigkeit. Die FDJ formulierte in den „Grundrechten“ solche wichtigen Forderungen wie die nach gleichberechtigter Teilnahme der Jugend am politischen Leben, nach dem Wahlrecht ab 18 Jahre, nach der Wählbarkeit ab 21 Jahre, nach den Rechten auf Arbeit, Erholung, Bildung, Freude und Frohsinn. Die FDJ stellte sich die Aufgabe, die junge Generation im Sinne der Ideale der Freiheit, des Humanismus, einer kämpferischen Demokratie, des Friedens und der Völkerfreundschaft zu erziehen.
Erster Vorsitzender wurde Erich Honecker, der vor seiner Verhaftung durch die Faschisten 1935 mehrere Jahre als führender Funktionär des Kommunistischen Jugendverbandes Deutschlands gearbeitet hatte. Nach seiner Befreiung aus dem Zuchthaus Brandenburg hatte er sich im Auftrag des ZK der KPD mit der Schaffung einer demokratischen Jugendorganisation befaßt. Stellvertretende Vorsitzende der FDJ wurde Edith Baumann, die führend in der sozialistischen Arbeiterjugend gewirkt hatte und ebenfalls im illegalen Widerstandskampf gegen das faschistische Regime aktiv tätig gewesen war.
Die Gründung der FDJ wurde zu einem Wendepunkt in der Geschichte der deutschen Jugendbewegung. Die FDJ entstand als einheitliche Jugendorganisation, die alle jungen Menschen unabhängig von ihrer Weltanschauung, ihrer sozialen Herkunft und ihrer Mitgliedschaft in politischen Parteien vereinen sollte.
Auch die Entwicklung antifaschistisch-demokratischer Frauenausschüsse wurde von der SMAD unterstützt. Nachdem diese die Bildung von Frauenausschüssen bei den Stadtverwaltungen am 30. Oktober 1945 offiziell genehmigt hatte, beschleunigte sich der Prozeß der Entstehung der demokratischen Frauenbewegung.
Die Anzahl und die politische Aktivität der antifaschistischen Frauenausschüsse, insbesondere für die Gleichberechtigung der Frauen und Mädchen, wuchsen. Am 27. Januar 1946 fand die erste zentrale Tagung der antifaschistischen Frauenausschüsse der Ostzone einschließlich Berlins statt. In der Provinz Sachsen existierten Anfang 1946 bereits mehr als 400 solcher Ausschüsse. Am 23. und 24. Februar wurde in Halle ihre erste Tagung auf Provinzebene durchgeführt. Die Tätigkeit dieser Ausschüsse verstärkte die Einbeziehung der Frauen und Mädchen in den demokratischen Neuaufbau.
Aus der Entschließung der Landesdelegiertenkonferenz des FDGB von Mecklenburg-Vorpommern in Schwerin, 3. Februar 1946
Wie die Entwicklung der Gewerkschaften und der Jugendorganisation war auch die der Frauenbewegung mit dem Vereinigungsprozeß der Arbeiterbewegung verflochten. Zu einem Höhepunkt im Wirken der antifaschistischen Frauenbewegung wurden die Aktivitäten zum Internationalen Frauentag am 8. März 1946.
Die Februarbeschlüsse von KPD und SPD. Die Vereinigung von „unten nach oben“
Die Einheitsbewegung breitete sich in der Ostzone mit großer Dynamik aus. Dies schlug sich auch im weiteren starken Mitgliederzuwachs beider Arbeiterparteien nieder. Die Landes- bzw. Provinzialparteiorganisationen verzeichneten für die Zeit von Dezember 1945 bis Februar 1946 folgenden Mitgliederzuwachs: Mecklenburg-Vorpommern: KPD 72 Prozent, SPD 75 Prozent; Mark Brandenburg: KPD 67 Prozent, SPD 37,2 Prozent; Provinz Sachsen: KPD 38,2 Prozent, SPD 50 Prozent; Land Sachsen: KPD 31,5 Prozent, SPD 52,5 Prozent; Thüringen: KPD 52 Prozent, SPD 30,6 Prozent; Berlin: KPD 20 Prozent, SPD 14 Prozent.
Die Einheitsgegner in der SPD, vor allem in den Landes- und Provinzialvorständen, wurden weiter zurückgedrängt, verfügten aber noch über ernst zu nehmenden Einfluß. Eine komplizierte Lage bestand im Zentralausschuß und im Berliner Vorstand der SPD. Angehörige dieser Gremien befürworteten immer offener die politische Linie Schumachers.
Während in der Ostzone die Entscheidung über den Zeitpunkt der Vereinigung herangereift war, zeichnete sich immer deutlicher ab, daß der angestrebte Zusammenschluß von KPD und SPD in ganz Deutschland nicht zu erreichen war. In einer Beratung zwischen
Otto Grotewohl und Kurt Schumacher am 8. Februar 1946 lehnte letzterer endgültig ab, auf einem gesamtdeutschen Parteitag der SPD über die Vereinigung mit der KPD zu entscheiden. Er schlug vor, die SPD in der Ostzone demonstrativ aufzulösen. Daraufhin kam es am 11. Februar 1946 zu einer dramatischen Sitzung des Zentralausschusses. Mit Stimmenmehrheit, wobei die Stimmen der fünf Landes- bzw. Provinzialvorsitzenden der SPD den Ausschlag gaben, wurde folgender Beschluß gefaßt: Der Zentralausschuß der SPD „ist nach Beratung der Vertreter der Bezirke zu dem Entschluß gekommen, der Mitgliedschaft der Partei alsbald die Einheit der beiden Arbeiterparteien zur Entscheidung vorzulegen“ und „sofort einen Parteitag für die sowjetische Besatzungszone, einschließlich Berlin, einzuberufen. Dieser Parteitag, dem Bezirks- bzw. Landesparteitage vorangehen, soll über eine Vereinigung der beiden Parteien entscheiden.“‘ Dieser Beschluß wurde von Otto Grotewohl auf dem 1. FDGB-Kongreß unter dem großen Beifall der Delegierten bekanntgegeben.
Im Februar 1946 erschien die erste Nummer der „Einheit“. Sie enthielt folgende Grundsatzartikel: „Die Einheit der Arbeiterklasse und die Einheit der Nation“ von Wilhelm Pieck; „Gibt es einen besonderen deutschen Weg zum Sozialismus?“ von Anton Akkermann; „Zur Frage der innerparteilichen Demokratie“ von Franz Dahlem; „Sicherung der Demokratie“ von Gustav Dahrendorf; „Erfahrungen aus der Aktionseinheit“ von Max Fechner; „Die Bedeutung des Kommunistischen Manifestes“ von Otto Grotewohl; „Von der Demokratie zum Sozialismus“ von Helmut Lehmann; „Thesen über den Hitlerfaschismus“ von Walter Ulbricht. Diese Beiträge übten auf den weiteren Klärungsprozeß bei der Erarbeitung der programmatischen Basis für die Einheitspartei einen großen Einfluß aus. Im Artikel von Anton Ackermann wurde, ausgehend von der Entschließung der Dezemberkonferenz, vor allem die Frage beantwortet, welchen Weg die Einheitspartei verfolgen müßte, um zum Sozialismus vorwärtszuschreiten. Werke der Klassiker des Marxismus-Leninismus und die konkreten Bedingungen in Deutschland analysierend, gelangte der Verfasser zu der Schlußfolgerung, daß Grundzüge der Oktoberrevolution in Rußland auch für Deutschland Gültigkeit besäßen und daß die Errichtung der politischen Herrschaft der Arbeiterklasse die entscheidende Bedingung für den Übergang zum Sozialismus darstelle. Zugleich hob er die Erkenntnis W.I.Lenins hervor, daß jedes Land in „dieser oder jener Form der Demokratie, … dieser oder jener Abart der Diktatur des Proletariats, … diesem oder jenem Tempo“ die sozialistische Umgestaltung vollziehen wird. In diesem Sinne gelte es, „einen besonderen deutschen Weg zum Sozialismus“‘ unbedingt zu bejahen. Der Kampf um den Sozialismus müsse auf dem Boden der demokratischen Republik geführt werden. Wenn es gelänge, „die antifaschistisch-demokratische Republik als einen Staat aller Werktätigen unter Führung der Arbeiterklasse“ zu entwickeln, sei ein friedlicher Übergang
zum Sozialismus möglich. Der spezifische Charakter bzw. die Besonderheiten dieses „deutschen Weges“ würden sich aus der historischen Entwicklung des deutschen Volkes, aus dessen politischen und nationalen Eigenheiten sowie aus den besonderen Zügen seiner Wirtschaft und Kultur ergeben. Diese auch im Artikel von Wilhelm Pieck gegebene — Orientierung grenzte sich von reformistischen Vorstellungen von einem „Volksstaat“ bzw. einem „Hineinwachsen in den Sozialismus“ ohne Veränderung der alten Machtverhältnisse ab. Sie entsprach der marxistisch-leninistischen Revolutionstheorie, wenngleich die doppelte Betonung des Spezifischen durch die Adjektive „besonders“ und „deutsch“ und die starke Hervorhebung der Möglichkeit eines friedlichen Weges zum Sozialismus Ansatzpunkte für Fehlinterpretationen boten.
Am 26. Februar 1946 fand die zweite Konferenz des ZK der KPD und des ZA der SPD mit Vertretern der Landes- bzw. Provinzialorganisationen in Berlin statt. Sie begrüßte, „daß der Beschluß der Konferenz vom 21. Dezember 1945 über die Vorbereitung der Verschmelzung der beiden Arbeiterparteien weitgehend durchgeführt wurde“? und daß das ZK der KPD und der ZA der SPD für den 19. und 20. April Parteitage einberufen hatten.
Die Konferenz wurde von Otto Grotewohl geleitet. Wilhelm Pieck referierte über den Stand der Arbeiten am Entwurf für das programmatische Dokument der zu schaffenden Partei „Grundsätze und Ziele der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands“. Nach einer intensiven Diskussion wurde dieser Entwurf einstimmig gebilligt. Zustimmung erhielten auch die Entwürfe für das Statut und den Organisationsbeschluß, mit dem die Konferenz festlegte, wie die Vereinigung auf den verschiedenen Ebenen „von unten nach oben“ vollzogen werden sollte. Unterschiedliche Auffassungen bestanden noch zum Verhältnis von Betriebs- und Orts- bzw. Wohnbezirksgruppen. Die Konferenz beschloß, den Vereinigungsparteitag am 21. und 22. April 1946 durchzuführen. Die gemeinsame Studienkommission wurde in einen zentralen Organisationsausschuß umgewandelt.
Nur eine Woche später, am 2. und 3. März 1946, tagte in Berlin eine Reichskonferenz der KPD. An ihr nahmen 400 Delegierte aus allen Besatzungszonen sowie Vertreter des Zentralausschusses der SPD teil. Im Zentrum ihrer Beratungen standen Fragen des Vereinigungsprozesses und die nächsten Aufgaben beim demokratischen Neuaufbau. Wilhelm Pieck analysierte den Stand der Einheitsbewegung und hob dabei hervor, daß die Einheitspartei auf marxistisch-leninistischer Grundlage entstehen müsse, wenn sie ihre großen historischen Aufgaben erfüllen will. Die Reichskonferenz beschloß die „Resolution zur Vereinigung der beiden Arbeiterparteien“, das Dokument „Die nächsten Aufgaben der KPD beim Neuaufbau Deutschlands“ und „Das Wohnungsbauprogramm der KPD“ und bekräftigte die „Richtlinien der KPD zur Wirtschaftspolitik“. Bezüglich der Vereinigung zog sie die Schlußfolgerung: „Obwohl wir die Vereinigung der beiden Arbeiterparteien im ganzen Reich gewünscht haben, zwingen uns die besonderen Umstände …, die Vereinigung in allen Bezirken zu befürworten, wo sie … möglich ist. Die Vereinigung soll … in allen Gebieten erfolgen, wo die demokratische Entwicklung fortgeschritten ist und wo die Mitglieder beider Parteien ihren Willen zur Verschmelzung bekundet haben … Wir sind überzeugt, daß durch dieses Beispiel die Vereinigung auch in anderen Teilen Deutschlands gefördert wird.“
In der ersten Märzhälfte fanden in Tausenden von Betriebs-, Wohnbezirks- und Ortsgruppen getrennte Mitgliederversammlungen von KPD und SPD statt. Dabei konnte jedes Parteimitglied zum Zusammenschluß der Arbeiterparteien sowie zu den Entwürfen für die „Grundsätze und Ziele“ der Einheitspartei und deren Statut Stellung nehmen. Hier wählten die Parteimitglieder auch die Delegierten für die Kreiskonferenzen. Diese Versammlungen stimmten nicht nur mit überwältigender Mehrheit der Vereinigung zu, sondern brachten auch den Klärungsprozeß zum Charakter der Einheitspartei, zu den Lehren der Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung und zu den Grundprozessen der antiimperialistischen Umgestaltung in intensiven Diskussionen weiter voran.
In der zweiten Hälfte des Monats März fanden die getrennten Kreisdelegiertenkonferenzen von KPD und SPD statt. Auch sie beschlossen die Vereinigung. Sie wählten die Mitglieder für die Kreisvorstände der Einheitspartei und die Delegierten zu den Landesbzw. Provinzialparteitagen.
Große Aufmerksamkeit widmete die SMAD, insbesondere ihre unter Leitung von S. I. Tjulpanow stehende Informationsverwaltung, dem Vereinigungsprozeß. Mitarbeiter dieser Abteilung analysierten ständig die Auseinandersetzungen über die Vereinigung und berichteten regelmäßig in der „Täglichen Rundschau“ über Fortschritte und Probleme. „Worauf es ankam“, schrieb Tjulpanow in seinen Erinnerungen, „war, daß wir nicht die Aufgaben der KPD und SPD übernahmen, sondern ihnen vielmehr halfen, die von ihnen beschlossene Politik durchzusetzen.“’? Durch ihr politisches Wirken beschnitt die SMAD jedoch die Aktionsmöglichkeiten der Einheitsfeinde.
Am 6. April 1946 fanden die Landesbzw. Provinzialparteitage von KPD und SPD in Dresden, Gotha, Halle, Potsdam und Schwerin statt. Wie die KPD-Parteitage, so stimmten auch die SPD-Parteitage dem Zusammenschluß zur SED zu. Otto Buchwitz (SPD), der mit Hermann Matern (KPD) durch ihr enges Zusammenwirken zum Symbol des Kampfes um die Arbeitereinheit geworden war, hob auf dem Parteitag der Landesorganisation Sachsen der SPD am 6. April 1946 in Abrechnung mit der Geschichte seiner Partei hervor: „Wir wollen nicht soziale Reformer, sondern revolutionäre Sozialisten sein.“
Am 7. April traten unter großer Anteilnahme der Werktätigen die Vereinigungsparteitage in den Ländern und Provinzen zusammen und vollendeten den Zusammenschluß auf dieser Ebene. Zu gleichberechtigten Vorsitzenden der Landesbzw. Provinzialvorstände der SED wurden erfahrene und im Vereinigungsprozeß bewährte Funktionäre aus beiden Arbeiterparteien gewählt. Otto Buchwitz und Wilhelm Koenen im Land Sachsen, Kurt Bürger und Carl Moltmann in Mecklenburg-Vorpommern, Bruno Böttge und Bernard Koenen in der Provinz Sachsen, Friedrich Ebert und Willi Sägebrecht in Mark Brandenburg, Werner Eggerath und Heinrich Hoffmann in Thüringen.
Scharfe Auseinandersetzungen in der Berliner SPD-Organisation. Die Spaltung der Berliner SPD
Im Zusammenhang mit der Wirksamkeit der westlichen Militärbehörden in den Westsektoren Berlins entstand für das Ringen um die Einheit der Arbeiterklasse eine komplizierte Lage. Auf Anordnung der Kommandanturen der Westmächte wurden in deren Sektoren Kommunisten zunehmend aus den Verwaltungsorganen entlassen. Am 2. März 1946 befahl die amerikanische Kommandantur, die Betriebsgruppen von KPD und SPD in den Verwaltungen des Magistrats aufzulösen. Und nicht zuletzt wirkten Vertreter der amerikanischen Gewerkschaft American Federation of Labor (AFL), die schon während des Krieges mit reformistischen Gewerkschaftsfunktionären aus Deutschland zusammengearbeitet hatte, gegen die Einheit der Gewerkschaften. Innerhalb der Berliner SPD-Organisation formierte sich seit Ende 1945 unter der unmittelbaren Einwirkung Kurt Schumachers eine offen einheitsfeindliche Fraktion. Zu ihr gehörten auch — obwohl sie die Dezemberbeschlüsse mit unterschrieben hatten -— Gustav Dahrendorf, Karl Germer und Gustav Klingelhöfer.
Mit Hilfe des im amerikanischen Sektor verlegten „Tagesspiegel“, der sich den Gegnern der Vereinigung zur Verfügung stellte, verbreiteten diese immer wieder Zweifel an der Notwendigkeit der Einheit der Arbeiterklasse und an der Aufrichtigkeit der KPD und diffamierten sie den Vereinigungsprozeß als „Zwangsvereinigung“.
Trotz dieser Aktivitäten konnten die Einheitsgegner aber nicht verhindern, daß die Gewerkschaftseinheit hergestellt wurde und daß der Vereinigungsprozeß auch in Berlin voranschritt. Im Vergleich zu den Ländern und Provinzen der Ostzone gab es in Berlin aber doch deutliche Rückstände.
Plakate der gemeinsamen Betriebsgruppe von KPD und SPD in den Technischen Werken Gera, Frühjahr 1946
Den Einheitsgegnern gelang es, auf einer Funktionärskonferenz am 1. März 1946 den Beschluß durchzusetzen, in der Berliner SPD eine „Urabstimmung“ über die Vereinigung durchzuführen. Schon bei der Vorbereitung dieser Abstimmung konnten sie jedoch die Stimmung in der Berliner Arbeiterklasse und in den SPD-Organisationen für die Überwindung der Spaltung deı Arbeiterbewegung nicht unberücksichtigt lassen. Deshalb stellten sie die verwirrenden Fra gen: „Bist Du für den sofortigen Zusammenschluß beider Arbeiterparteien? Ja/Nein“ und „Bist Du für ein Bündnis beider Parteien, welches gemeinsame Arbeit sichert und Bruderkampf ausschließt? Ja/Nein“.
Der Zentralausschuß der SPD nahm am 27. März in einer Erklärung gegen die Umtriebe der Einheitsgegner Stellung. Bereits einen Tag vorher hatte sich die erste gemeinsame Funktionärskonferenz von KPD und SPD in Berlin mit etwa 2500 Teilnehmern für die schnelle Vereinigung ausgesprochen. Für Berlin konstituierte sich ein Organisationsausschuß.
Unterstützt von den westlichen Besatzungsmächten, führte die einheitsfeindliche Fraktion in der Berliner SPD am 31. März 1946 in den Westsektoren die geplante „Urabstimmung“ durch. Die sozialdemokratischen Kreisorganisationen im sowjetischen Sektor hatten sich, entsprechend den Beschlüssen des ZA der SPD, schon für die Vereinigung ausgesprochen. An der Abstimmung in den Westsektoren nahmen 23.019 Sozialdemokraten teil. Das waren 58,0 Prozent der 39.716 Mitglieder der SPD-Kreisorganisationen in diesen Sektoren und 34,7 Prozent der 66.300 Mitglieder der SPD Groß-Berlin. Gegen die sofortige Vereinigung mit der KPD stimmten 18951 Parteimitglieder. Das waren zwar 82,3 Prozent der an der Abstimmung Teilnehmenden, jedoch nur 47,7 Prozent der Sozialdemokraten der Westsektoren und nur 28,6 Prozent der Mitglieder der SPD Groß-Berlin. Gegen ein Bündnis mit der KPD überhaupt stimmten nur 5.707 Abstimmungsteilnehmer. Das waren 14,4 Prozent der SPD-Mitglieder in den Westsektoren und nur 8,6 Prozent in ganz Berlin.
Die einheitsfeindliche Fraktion in der Berliner SPD nahm dieses Ergebnis völlig zu Unrecht zum Ausgangspunkt, um am 7. April 1946 in Berlin-Zehlendorf eine separate Konferenz durchzuführen und eine eigene SPD-Organisation für Berlin zu konstituieren, die Antikommunismus und Antisowjetismus zu ihrem Hauptmotiv machte. Am 10. April 1946 schuf deren antikommunistische Führungsspitze im Beisein von Offizieren der Westmächte das „Ostbüro der SPD“, das mit allen Mitteln den Fraktionskampf in der SED organisieren sollte. Schon kurz nach der Spaltung der Berliner SPD schrieb Gustav Klingelhöfer im „Tagesspiegel“: „Seit dem 7. April ist Berlin Brückenkopf und Brücke geworden.“
Im sowjetischen Sektor folgte die große Mehrheit der Sozialdemokraten den Einheitsgegnern nicht. Am 13. April traten die Parteitage der Berliner Organisationen von KPD und SPD zusammen und beschlossen die Vereinigung. Einen Tag später führten sie ihren Vereinigungsparteitag durch. Er vollzog den Zusammenschluß der etwa 70.000 Berliner Kommunisten und von etwa 29.000 Sozialdemokraten zu einer SED-Organisation von rund 100.000 Mitgliedern. Zu gleichberechtigten Vorsitzenden des SED-Vorstandes von Groß-Berlin wurden Hermann Matern und Karl Litke gewählt. Rund 37000 Sozialdemokraten — mehr als die Hälfte des Berliner SPD-Verbandes nahmen nicht an der Vereinigung teil.
Auf Grund eines vom Alliierten Kontrollrat Ende Mai 1946 beschlossenen Kompromisses konnte die SPD neben der SED in ganz Berlin wirken. Trotz der antikommunistischen Haltung der Berliner SPD-Führung bemühte sich die SED schon bald nach ihrer Gründung darum, mit der SPD zusammenzuarbeiten, um eine gemeinsame Politik im Interesse der Werktätigen durchzusetzen.
Die Gründung der SED als Garant der geschichtlichen Wende auf deutschem Boden
Der Prozeß der Vereinigung von KPD und SPD zur SED, der das gesellschaftliche und politische Leben in der Ostzone einschließlich Berlins seit Monaten in zunehmendem Maße prägte, trat am 19. und 20. April 1946 mit der Durchführung des 15. Parteitages der KPD und des 40. Parteitages der SPD in Berlin in sein letztes Stadium. Der Verlauf dieser Parteitage machte unübersehbar deutlich, daß sich das Streben nach schnellstmöglicher Vereinigung auf revolutionärer Grundlage als Ergebnis eines demokratischen Willensbildungsprozesses endgültig durchgesetzt hatte und daß alle notwendigen Voraussetzungen für die Vereinigung vorhanden waren. Das monatelange Ringen um die Schaffung dieser Voraussetzungen, die unzähligen klärenden Aussprachen, das gemeinsame Handeln, aber auch die scharfen Auseinandersetzungen mit den Einheitsgegnern zahlten sich aus. Die Delegierten beider Parteitage stimmten Beschlüssen über die Vereinigung zu und wählten je 40 Mitglieder für den Parteivorstand der Einheitspartei.
Am 21. und 22. April 1946 wurde Berlin, die von den Kriegsfolgen schwer gezeichnete traditionelle deutsche Hauptstadt, vor allem ihr sowjetischer Sektor, zum Schauplatz eines Ereignisses, das den Verlauf der deutschen Geschichte wesentlich beeinflussen sollte. Der nahe dem Bahnhof Friedrichstraße gelegene „Admiralspalast“, das Domizil der Deutschen Staatsoper, war am Morgen des 21. April in einem weiten Umkreis dicht umlagert. Viele Mitglieder beider Aırbeiterparteien waren mit roten Fahnen herbeigekommen und begrüßten ihre Delegierten. Arbeiterlieder erklangen. 548 sozialdemokratische und 507 kommunistische Delegierte traten in der Staatsoper zum Vereinigungsparteitag zusammen. Unter den Delegierten befanden sich 127 Funktionäre der KPD und 103 der SPD aus den Westzonen. Die Vertreter aus der sowjetischen Besatzungszone repräsentierten rund 680.000 Sozialdemokraten und 620.000 Kommunisten.
„Der imposante, repräsentative Saal … war ebenso festlich wie würdig geschmückt“”°, hielt das Protokoll des Vereinigungsparteitages fest. „Mehr als tausend Delegierte und Ehrengäste, dazu noch eine größere Zahl von Gästen und Zuhörern füllten den mächtigen Raum bis auf den letzten Platz. Lebhaft und herzlich war durchweg die persönliche Begegnung alter Kampfgenossen aus den bisher getrennten Parteilagern nach jahrzehntelanger Spaltung. Nachdem die FidelioOuvertüre von Ludwig van Beethoven, gespielt vom Orchester der Staatsoper, verklungen war, betraten die beiden Parteivorsitzenden, Wilhelm Pieck und Otto Grotewohl, von verschiedenen Seiten kommend, die Bühne, trafen in der Mitte zusammen und reichten sich unter minutenlangem stürmischem Beifall der Delegierten und Gäste, die sich von ihren Plätzen erhoben hatten, die Hände. Einem Schwur gleich brauste ein dreifaches Hoch auf die deutsche Arbeiterklasse durch den Saal.“’* Bewegt verwies Otto Grotewohl darauf, daß 30 Jahre Bruderkampf in diesem Augenblick endgültig ihr Ende fänden, und Wilhelm Pieck erwiderte: „Wir werden unsere Sozialistische Einheitspartei zu der Millionenpartei der deutschen Werktätigen machen, um das große Werk zu vollenden, das wir uns zum Ziel gesetzt haben: den Sozialismus. Otto Grotewohl! Das sei der Sinn unseres Händedrucks, das sei unsere Tat!
Vereinigungsparteitag von KPD und SPD, 21./22. April 1946. Die Delegierten bei der Abstimmung
Derer, die für dieses Ziel, im Kampf gegen Imperialismus, Faschismus und Krieg ihr Leben gelassen hatten und diesen denkwürdigen Tag nicht mehr erleben konnten, gedachten die Delegierten und Gäste des Parteitages zu Beginn der Beratungen.
Wilhelm Pieck und Otto Grotewohl besiegeln mit ihrem Händedruck den Zusammenschluß der beiden Arbeiterparteien, 21. April 1946
In ihren Referaten zum Thema „Die Einheitspartei und der Neuaufbau Deutschlands“ zogen Wilhelm Pieck und Otto Grotewohl eine geschichtliche Bilanz. Sie setzten sich mit den Einheitsfeinden auseinander, erläuterten die historische Mission der deutschen Arbeiterklasse und die Aufgaben der Einheitspartei im Ringen um eine antifaschistisch-demokratische deutsche Republik und bei der Bahnung des Weges in Richtung des Sozialismus. Ihre Ausführungen machten den hohen Grad der Annäherung und Übereinstimmung in den Auffassungen deutlich, der im Vereinigungsprozeß bereits erreicht worden war.
Nach einer konstruktiven Aussprache beschlossen die Delegierten einstimmig die Vereinigung der SPD und der KPD und die Konstituierung der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands. Ebenfalls einstimmig billigten sie die „Grundsätze und Ziele der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands“ sowie das „Manifest an das deutsche Volk“. Das Statut wurde mit großer Mehrheit gegen 21 Stimmen bei 4 Stimmenthaltungen angenommen.
Der I. Parteitag der SED wählte einen 80 Mitglieder umfassenden Parteivorstand und Wilhelm Pieck und Otto Grotewohl zu gleichberechtigten Vorsitzenden.
In ihrem programmatischen Dokument „Grundsätze und Ziele“ umriß die SED in 14 Gegenwartsforderungen die wichtigsten Aufgaben, die bei der Durchführung antifaschistisch-demokratischer, antiimperialistischer Umwälzungen in den Westzonen und bei ihrer Weiterführung in der Ostzone bewältigt werden mußten. Die SED bekannte sich darin zur „Herstellung der Einheit Deutschlands als antifaschistische, parlamentarisch-demokratische Republik“ und trat für die Bildung einer deutschen Zentralregierung ein. Sie betonte, daß die endgültige „Lösung der nationalen und sozialen Lebensfragen“ des deutschen Volkes „nur durch den Sozialismus erreicht werden“ kann und daß daher „die Gegenwartsbestrebungen der Arbeiterklasse in die Richtung des Kampfes zu lenken seien.
Mit den „Grundsätzen und Zielen“ verfügte die SED über ein Programmdokument, das von der historischen Mission der Arbeiterklasse ausging und den Weg zum Sozialismus über die konsequente Zuendeführung der antiimperialistisch-demokratischen Umwälzung wies. Im Gegensatz zu reformistischen Vorstellungen vom „Hineinwachsen in den Sozialismus“ wurde die Eroberung der politischen Macht durch die Arbeiterklasse zur unabdingbaren Voraussetzung des Sozialismus erklärt, die Führungsrolle der revolutionären Partei der Arbeiterklasse begründet und die Notwendigkeit der Herstellung enger Bündnisbeziehungen der Arbeiterklasse mit den anderen Werktätigen betont.
Titelseite der ersten Ausgabe der als Schulungsmaterial der SED herausgegebenen „Sozialistischen Bildungshefte“, 1946
Mit der Gründung der SED wurde in der Ostzone ein jahrzehntelanges Ziel der Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung die Herstellung der Einheit der Arbeiterklasse auf revolutionärer Grundlage erreicht. Die SED ging aus dem Wirken der deutschen Kommunisten und der revolutionären Sozialdemokratie, aus dem Kampf der besten Vertreter des deutschen Volkes gegen den faschistischen deutschen Imperialismus hervor. Sie entstand als Fortsetzerin aller progressiven und humanistischen Bestrebungen des deutschen Volkes.
Die Gründung der SED war Bestandteil des Kampfes um die Herstellung der Einheit der Arbeiterbewegung, der sich in vielen Ländern entwickelte. Mit ihr wurde die grundlegende Lehre aus der Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung gezogen, daß die Arbeiterklasse ihre historische Mission nur erfüllen kann, wenn sie von einer einheitlichen, auf marxistisch-leninistischer Grundlage wirkenden Partei geführt wird, die fest mit den Massen verbunden ist. Die SED war zugleich als „Partei aller Werktätigen“ entstanden, die auch künftig eine „enge und aufrichtige Zusammenarbeit mit den antifaschistisch-demokratischen Parteien“ anstrebte, „die auf dem Boden eines anderen Programms und einer anderen Weltanschauung“ standen, wie sie in ihrem „Manifest an das deutsche Volk“ hervorhob.
Die Gründung der SED stärkte wesentlich die Kampffront für die Errichtung eines antiimperialistisch-demokratischen deutschen Staates. Die SED war mit einer Mitgliederzahl von 1,3 Millionen bei ihrer Gründung und von 1,8 Millionen schon wenige Monate danach die mit Abstand stärkste politische Partei in Deutschland. Ihre Gründung war ein entscheidender Sieg für Frieden, Demokratie, sozialen Fortschritt und Sozialismus auf deutschem Boden. Sie erfolgte im Kampf gegen den Antisowjetismus und für ein neues Verhältnis zur Sowjetunion, im Ringen um die Durchsetzung der Prinzipien des proletarischen Internationalismus. Die mit den antifaschistisch-demokratischen Umwälzungen eingeleitete Wende im Leben des deutschen Volkes und die Neuformierung seines nationalen Lebens wurden gegen die restaurativen Bestrebungen des deutschen Imperialismus abgesichert.
Am 23.April 1946 fand die 1. Tagung des Parteivorstandes der SED statt. Sie wählte das Zentralsekretariat, dem Anton Ackermann, Franz Dahlem, Max Fechner, Erich W. Gniffke, Otto Grotewohl, August Karsten, Käthe Kern, Helmut Lehmann, Hermann Matern, Otto Meier, Paul Merker, Wilhelm Pieck, Elli Schmidt und Walter Ulbricht angehörten. Max Fechner.und Walter Ulbricht übernahmen die Funktionen der stellvertretenden Vorsitzenden der Partei.
Der Vereinigungsparteitag und seine Beschlüsse fanden ein nachhaltiges Echo und breite Zustimmung. Diese bekundeten die Werktätigen in den großen Demonstrationen aus Anlaß des 1.Mai 1946.
Zonalisierung und widersprüchliche Entwicklung in den Westzonen
- 1 Zonalisierung und widersprüchliche Entwicklung in den Westzonen
- 1.1 Komplikationen in der Viermächtezusammenarbeit
- 1.2 Westzonenpartikularismus gegen die demokratische Einheit Deutschlands
- 1.3 Antifaschistisch-demokratische Bestrebungen zwischen Dominanz und Restriktion
- 1.4 Der antikommunistische Kurs der westzonalen SPD. Das Verbot der Gründung der SED
Komplikationen in der Viermächtezusammenarbeit
Dem Alliierten Kontrollrat gelang es — nach dem weitgehend erfolgreichen Auftakt seiner Tätigkeit im Jahre 1945 -, auch im 1. Halbjahr 1946 bei der Behandlung einer Vielzahl von Themen Einigung zu erzielen. Das fand seinen Niederschlag in entsprechenden Gesetzen und Direktiven. Insgesamt erließ der Kontrollrat vom Zeitpunkt seiner Arbeitsaufnahme bis Mitte 1946 rund 30 Gesetze und die gleiche Anzahl Direktiven. Mit Sicht auf die gesamte Tätigkeit dieses Viermächteorgans bis 1948 waren das die Hälfte aller Gesetze und Direktiven, die von ihm verabschiedet wurden. Den Kern der Gesetzestätigkeit und Rechtsetzung — wie überhaupt der Tätigkeit des Kontrollrates im Zeitraum bis Mitte 1946 — bildeten solche Gesetze und Direktiven sowie Proklamationen, Befehle und Anordnungen, die auf die Verwirklichung der alliierten Beschlüsse zur Entnazifizierung, Entmilitarisierung und Demokratisierung zielten. Das wiesen auch die vom Kontrollrat, vom Koordinierungskomitee sowie von den Direktoraten regelmäßig verfaßten „Status-Reporte“ zur Verwirklichung der Potsdamer Beschlüsse eindeutig aus. Einen breiten Raum nahmen steuergesetzliche und zivilrechtliche Regelungen sowie solche in bezug auf Arbeitszeit und andere Arbeitsbedingungen, die Kontingentierung von Gas und Strom, Kommunikationsund Wohnungsfragen ein. Nach langwierigen Diskussionen verabschiedete der Kontrollrat am 26. März 1946 einen „Plan für die Reparationen und das Niveau der deutschen Nachkriegswirtschaft in Übereinstimmung mit dem Berliner Protokoll“%,. Dessen leitende Grundsätze waren, ausgehend von den Potsdamer Beschlüssen, darauf gerichtet, das deutsche Kriegspotential zu beseitigen und eine industrielle Abrüstung Deutschlands zu bewirken, die Zahlung von Reparationen zu gewährleisten, die deutsche Landwirtschaft und Friedensindustrie so zu entwickeln, daß Deutschland ohne Hilfe von außen existieren und die deutsche Bevölkerung einen durchschnittlichen Lebensstandard erreichen konnte, der nicht höher liegen sollte als der durchschnittliche Lebensstandard in anderen europäischen Ländern. Der Plan basierte auf der Annahme, daß es ausreiche, das Niveau der deutschen Industrieproduktion bis 1949 auf etwa 50 bis 55 Prozent des Standes von 1938 festzulegen, und daß es möglich sei, die Kapazitäten der Metall-, der Maschinenbauund der chemischen Industrie wesentlich zu reduzieren. Der Plan setzte voraus, daß es gelingen würde, Deutschland als wirtschaftliche Einheit zu behandeln. Angesichts des niedrigen Industrieniveaus vom Frühjahr 1946 bot der Industrieplan beträchtliche Entwicklungsmöglichkeiten; andererseits sprach auch vieles dafür, daß die festgelegten Restriktionen die Entwicklungsbedürfnisse der deutschen Landwirtschaft und Friedensindustrie auf lange Sicht beeinträchtigen würden. Die Notwendigkeit einer späteren Revision des Industrieplanes zeichnete sich daher schon bei seiner Verabschiedung ab. Wenn es nicht gelang, die deutsche Wirtschaftseinheit zu verwirklichen, und sich die Besatzungszonen weiterhin als relativ eigenständige Gebilde entwickelten, mußte sich darüber hinaus die Frage des Industrieniveaus ohnehin auf neue Weise stellen.
Eine Sitzung des Zentralsekretariats des ZK der SED, Mai 1946. V. I.n.r.: Otto Meier, Anton Ackermann, Bruno Karsten, Walter Ulbricht, Max Fechner, Käthe Kern, Wilhelm Pieck, Otto Grotewohl
Ein wichtiges Element für die Durchsetzung einer abgestimmten und koordinierten Viermächtepolitik in Deutschland bestand in einer gemeinsamen Regelung der Beseitigung der Monopolvereinigungen, dargestellt insbesondere von Konzernen, Trusts und Kartellen. Dafür lag ein gemeinsamer Gesetzentwurf der sowjetischen, der amerikanischen und der französischen Seite vor. Er wurde jedoch auf der 49. Sitzung des Wirtschaftsdirektorates am 23. Mai 1946 von der britischen Delegation abgelehnt. Diese wandte sich gegen die vorgesehene Verbindlichkeitsklausel in bezug auf alle Betriebe einer bestimmten Größenordnung, gegen die Durchführungskompetenzen der einzusetzenden Viermächtekommission und gegen die Anzahl der aufgelisteten Konzernbetriebe, die eliminiert werden sollten. Die britische Delegation vertrat eine Position, die von einem völlig anderen Herangehen an die Problematik bestimmt wurde. Nicht mehr die Aspekte der Sicherheit der Alliierten vor einer erneuten deutschen Aggression, der Beseitigung der Grundlagen des Faschismus und der faschistischen Aggression und der Erfordernisse der Friedenssicherung standen im Vordergrund, sondern rein wirtschaftliche Erwägungen, insbesondere solche in bezug auf die wirtschaftliche Rekonstruktion Westeuropas.
Die Wirksamkeit des Kontrollrates, eine Viermächteregelung der deutschen Frage und die Wiedererlangung staatlicher Souveränität durch das deutsche Volk hingen in wesentlichem Maße von der Bildung deutscher Zentralverwaltungen ab, die zugleich als Vorstufe zur etappenweisen Errichtung einer deutschen Regierung fungieren konnten. Ausgehend von den französischen Stellungnahmen zu den Potsdamer Beschlüssen, beharrte die französische Sektion des Kontrollrates auch 1946 auf ihrer Position, die Bildung deutscher Zentralverwaltungen entweder überhaupt oder so lange abzulehnen, wie die nach ihrer Auffassung noch offenen Fragen der deutschen Staatsorganisation, der Westgrenze Deutschlands und des. Status von Rheinland und Ruhrgebiet nicht geklärt seien. Eine Druckausübung seitens der USA oder Großbritanniens auf Frankreich hätte die französische Haltung eventuell „aufweichen“ können. Jene waren jedoch, je mehr Zeit verging, desto weniger dazu bereit, weil die Bildung deutscher Zentralverwaltungen und einer deutschen Zentralregierung in Berlin von ihnen selbst zunehmend skeptischer beurteilt wurde, so daß ihnen die französische Haltung immer mehr willkommen war. Die französische Sektion verhinderte auch und mit der gleichen Argumentation — das Zustandekommen von Kontrollratsgesetzen, die den Parteien und Gewerkschaften die Organisation im nationalen Rahmen und eine legale Tätigkeit über die Zonengrenzen hinweg ermöglicht hätten.
Das Nichtzustandekommen von Beschlüssen und Regelungen, die für eine koordinierte Deutschland- und Besatzungspolitik wesentlich waren, belastete die Viermächteverwaltung Deutschlands in zunehmendem Maße. Weitere Differenzen waren die Folge. Indem es den vier Mächten nicht gelang, die wirtschaftliche Einheit Deutschlands zu gewährleisten bzw. herzustellen wie überhaupt Deutschland als einheitliches Ganzes zu behandeln und ihre Besetzungsdirektiven koordiniert durchzusetzen, konnten sie wichtige Fragen überhaupt nicht oder doch nicht einheitlich 1ösen. Außer den Fragen der Beseitigung von Großgrundbesitz und Monopolvereinigungen gehörten dazu auch die der Aufstellung eines einheitlichen deutschen Wirtschaftsplanes bzw. der Koordinierung der wirtschaftlichen Potentiale der einzelnen Besatzungszonen und der Vorlage eines einheitlichen Export-Import-Planes. Aus verschiedenen Gründen, nicht zuletzt auch aus solchen, die in ihrer widersprüchlichen Besatzungspolitik selbst wurzelten bzw. in der ungenügenden Bekämpfung der Wirtschaftsabotage und des schwarzen Marktes in ihren Besatzungszonen, sahen sich Briten und Amerikaner gezwungen, beträchtliche Mittel — und zwar in Dollar — aufzuwenden, um in ihren Zonen ein Existenzminimum zu garantieren. Großbritannien — selbst am Rande eines wirtschaftlichen Bankrotts und eine Milliardenanleihe von den USA anstrebend — wurde davon hart getroffen. Bei der Analyse dieser Tatsache muß allerdings in Rechnung gestellt werden, daß die Westmächte deutsche Steinkohle zwangsweise weit unter dem Weltmarktpreis exportierten, wodurch 1946 für ihre Zonen ein geschätzter Nettoverlust von etwa 200 Millionen Dollar bewirkt wurde. Die britische Militärregierung verhinderte — in Verfolgung der Interessen britischer Wirtschaftskreise — selbst eine Ankurbelung der Exportindustrie in ihrer Zone.
Briten und Amerikaner nahmen das selbstoder mitverschuldete Defizit zum Anlaß, einen Export-Import-Plan für Deutschland durchdrücken zu wollen, der darauf abzielte, daß die sowjetische Besatzungszone für Defizite der Westzonen mit aufkommen bzw. daß die Sowjetunion auf Reparationen verzichten sollte. Die USA betrachteten die von ihnen angestrebte Regelung der Export-Import-Probleme zugleich als Hebel, um eine eventuelle Unterbzw. Einordnung der ganzen deutschen Wirtschaft in ihr wirtschaftliches Hegemonialsystem zu realisieren. In der westalliierten Deutschlandund Besatzungspolitik blockierten oder erschwerten zunehmend antisowjetische Motivationen die mögliche einvernehmliche Regelung anstehender Probleme, da sie den Kompromißwillen und damit die Kooperationsfähigkeit der Westmächte immer mehr einschränkten.
All das bestärkte die Tendenz, daß die Einteilung Deutschlands in Besatzungszonen zu einer Aufteilung werden würde, außerordentlich. Die vier Besatzungszonen nahmen bis Mitte 1946 immer mehr den Charakter relativ autonomer Gebilde an, die sich gemäß der eigenständigen obersten Gewalt der Zonenbefehlshaber und der weitgehenden Eigenständigkeit deutscher Landesund Provinzialregierungen bzw. -verwaltungen relativ unabhängig voneinander entwickelten. Der Zonenund Länderpartikularismus erreichte bis Mitte 1946 ein beträchtliches Ausmaß. Die von der britischen Militärregierung im Sommer 1946 — im Vorgriff auf die Auflösung Preußens und ohne Einschaltung des Kontrollrates — vorgenommene administrativ-territoriale Neugliederung der britischen Zone verstärkte diese Tendenzen. Die britische Zone bestand nun aus den Ländern Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Holstein und der Freien Hansestadt Hamburg. Die amerikanische Zone — mit den Ländern Bayern, Hessen und Württemberg-Baden — wurde mit Wirkung vom 1.Januar 1947 durch das aus den amerikanischen Enklaven in der britischen Zone, Bremen und Bremerhaven, gebildete Land Bremen arrondiert. Nach der Bildung des Landes Rheinland-Pfalz am 30. August 1946 bestand die französische Zone neben diesem aus den Ländern Baden und Württemberg-Hohenzollern, deren Konstituierungsprozeß allerdings erst im Jahre 1947 endgültig abgeschlossen wurde, und aus dem Saargebiet, das jedoch Ende 1946 zollpolitisch mit Frankreich vereinigt wurde. Die Eigenständigkeit der Länder war in den Westzonen insgesamt stärker ausgeprägt als in der Ostzone. Am deutlichsten zeigte sich dies in der französischen Zone, wo bis 1948 keine institutionelle Zusammenarbeit der Länder möglich war.
Die Entwicklung der amerikanischen und der britischen Besatzungszone wurde 1946 von Maßnahmen des zonalen Ausbaus — dem Aufbau von wirtschaftlichen Zentralämtern auf Zonenebene und eines Zonenbeirates in der britischen Zone und der Stärkung des Länderrates in der amerikanischen Zone — und damit verstärkter zonaler Eigenentwicklung geprägt. Zugleich traten immer stärker Bestrebungen in Richtung auf eine separate Zusammenfassung oder Angleichung zwischen britischer und amerikanischer Zone hervor, wie sie zum Beispiel vom Vorsitzenden des Zonenbeirates, Robert Lehr, auf der Tagung des Länderrates am 3. April 1946 in Stuttgart artikuliert wurden, an der eine Delegation des Zonenbeirates der britischen Zone teilnahm. Die territorial-administrativen Abgrenzungen übergreifend, schritt in allen Ländern der Westzonen zugleich, wenn auch widerspruchsvoll ein Prozeß restaurativer Neuordnung voran, der sie gesellschaftlich-politisch einander annäherte und zugleich von den Ländern der Ostzone separierte. Immer deutlicher zeichnete sich in diesem Zusammenhang die Gefahr einer Ost-West-Polarisierung auf deutschem Boden und der Spaltung Deutschlands ab.
Westzonenpartikularismus gegen die demokratische Einheit Deutschlands
Mitte Juni 1946 beschäftigte sich der Parteivorstand der SED mit den Fragen der Zonalisierung und des Kampfes um die Herstellung der demokratischen Einheit Deutschlands.
In einem dazu im Auftrag des Zentralsekretariats gehaltenen Referat stellte Max Fechner auf der 3. Tagung des Parteivorstandes der SED fest: „Die Zonengrenzen sind im Laufe der Zeit erstarrt, und wir sind von der projektierten Wiederherstellung Deutschlands als eines wirtschaftlichen und politischen Ganzen weiter entfernt als vor einem Jahr … Innerhalb der einzelnen mehr willkürlich gezogenen Grenzen haben sich selbständige wirtschaftliche und politische Gebilde entwickelt oder sind noch im Entstehen begriffen, die eine Lebensgefahr für die Wiederherstellung der Einheit Deutschlands darstellen.“® Diese Gefahr werde noch dadurch vergrößert, daß das von politischen Kräften im Westen und im Süden Deutschlands „angestrebte föderalistische Prinzip weitgehend und systematisch ausgebaut wird und daß offensichtlich die Frage einer deutschen Zentralregierung oder die Frage der politischen Einheit Deutschlands nicht wesentlich diese politische Konzeption bestimmt “®*, Entschieden wende sich die SED gegen „die Aufteilung Deutschlands in einzelne lebensunfähige Stücke“ bzw. in zwei machtpolitische Interessensphären und deren „Abschnürung“ entlang der Elbe. Die Zonalisierung des wirtschaftlichen, des politisch-staatlichen und bedingt auch des geistig-kulturellen Lebens des deutschen Volkes, insbesondere die sich Mitte 1946 deutlich abzeichnende Polarisierung zwischen Ostzone und Westzonen, waren eine Realität, die die SED in Rechnung stellte, ohne sie jedoch zu akzeptieren.
Zonenseparatismus und -partikularismus, die nicht zuletzt von wirtschaftlichen Gegebenheiten genährt wurden, hemmten zugleich einen koordinierten wirtschaftlichen Aufbau. Es war daher keineswegs zufällig, daß im Laufe des Jahres 1946 auch in den Westzonen — wie die Umfragen von OMGUS ergaben die Zahl derjenigen beträchtlich zunahm, die eine zumindest wirtschaftliche Zentralisierung Deutschlands von Berlin aus wünschten.
Eine Zentralisierung des staatlich-politischen Lebens lag im Interesse des deutschen Volkes, eröffnete sie doch die Möglichkeit, den Prozeß’ der antifaschistisch-demokratischen Umgestaltung und der Friedenssicherung zu koordinieren und gegen alle Widerstände zum Erfolg zu führen, alle Ressourcen optimal für den Wirtschaftsaufbau zusammenzufassen, dienationalstaatliche Einheit, Souveränität und Unabhängigkeit wiederzuerlangen. Die SED trat im Ringen um Faschismusund Militarismusbewältigung, antiimperialistische Friedenssicherung und demokratische Umgestaltung auf dem gesamten deutschen Territorium zugleich als entschiedener Anwalt der Wahrung der nationalen Einheit des deutschen Volkes durch die Errichtung eines antiimperialistisch-demokratischen Nationalstaates auf. Sie trat dem mit nationalem Nihilismus, „Europa-Ideologie“ und Kosmopolitismus verbundenen Westzonenpartikularismus entschieden entgegen. Mit den antifaschistisch-demokratischen Verhältnissen waren im Osten Deutschlands bereits wesentliche Grundlagen für einen einheitlichen, demokratischen deutschen Friedensstaat geschaffen worden.
Auch die beiden anderen Blockparteien der Ostzone engagierten sich mit spezifischer Motivation und Zielvorstellung für die Errichtung eines deutschen demokratischen Staates mit Berlin als Hauptstadt. Die LDPD mit ihrem Vorsitzenden Wilhelm Külz kam dabei in ihren Auffassungen den von der SED entwickelten Vorstellungen von einem demokratischen Einheitsstaat recht nahe, wenngleich die Meinungen über die sozialökonomischen Grundlagen und den sozialen Inhalt dieses Staates stark divergierten. Dabei gab es in der LDPD bei solchen Politikern wie Johannes Dieckmann und anderen Aufgeschlossenheit und Verständnis dafür, daß die Ergebnisse der antifaschistisch-demokratischen Umgestaltungen in den zu errichtenden zentralen deutschen Staat einzubringen und in ihm zu bewahren seien. Auch in der CDU war das Streben nach der Einheit Deutschlands bzw. der „Reichseinheit“ stark entwickelt. Viele Mitglieder verbanden dabei ihr Engagement für einen „christlichen Sozialismus“ mit antimonopolistisch-demokratischen Vorstellungen über die Grundlagen des zukünftigen deutschen Staates. Demgegenüber ließ sich die Führungsspitze der CDU mit Jakob Kaiser als Vorsitzenden und Ernst Lemmer als dessen Stellvertreter von der erklärten Absicht leiten, einen Ausgleich zwischen den Verhältnissen im Osten Deutschlands und denen im Westen herbeizuführen und auf diesem Wege die Länder der Ostzone in einen föderalistischen deutschen Staat einzubringen. Kaiser gab jedoch der von ihm propagierten Losung, Deutschland habe „Brücke zu sein zwischen Ost und West“3°, zunehmend eine „westliche“, „abendländische“ Interpretation. Nichtsdestoweniger war es ein Charakteristikum der Situation im Vierzonendeutschland, daß die in der Ostzone wirkenden antifaschistisch-demokratischen Parteien und Organisationen das Ringen um antifaschistischdemokratische Veränderungen in dem Zonenrahmen, in dem sie wirken konnten, zugleich mit der Orientierung auf die Errichtung eines deutschen demokratischen Staates mit Berlin als seiner Hauptstadt verbanden und vor den Gefahren der Zonalisierung oder einer Ost-West-Spaltung Deutschlands warnten. Die antifaschistisch-demokratischen Umgestaltungen in der Ostzone wurden als Vorleistungen und Bausteine für eine demokratische deutsche Republik betrachtet und waren auch unter Berücksichtigung dieses Anliegens konzipiert.
Demgegenüber war in den Westzonen von Anfang an die Orientierung auf die demokratische Einheit Deutschlands nicht nur weniger ausgeprägt, sondern es dominierten — flankiert von separatistischen Umtrieben — partikularistische Orientierungen und Bestrebungen, die sich zunehmend in einer Art Westzonenpartikularismus konzentrierten.
Anknüpfend an seine Rheinstaatpläne vom Sommer 1945 gab Konrad Adenauer im Oktober 1945 in einem Presseinterview eine Lagebeurteilung ab, die in der Schlußfolgerung gipfelte, daß der „von Rußland besetzte Teil… für eine nicht zu schätzende Zeit für Deutschland verloren“ sei und daß man „die drei Teile des nicht russisch besetzten Gebietes, die bei Schaffung eines Rhein-Ruhr-Staates entständen, in einem staatsrechtlichen Verhältnis miteinander“ belassen, eventuell bundesstaatlich zusammenfassen sollte.
Eine ähnliche Position brachten alle Politiker — mit Ausnahme derer aus den Reihen der KPD im Januar 1946 in von der britischen Militärregierung durchgeführten Befragungen zum Ausdruck. Sofern sie überhaupt bereit waren, der Errichtung deutscher Zentralverwaltungen zuzustimmen, forderten sie, daß dieser die Errichtung einer „Zentralverwaltung für die drei Westzonen“®® vorausgehen müsse.
Als sich am 3. April 1946 die Vorsitzenden der christlich-demokratischen bzw. -sozialen Parteiverbände der britischen und der Länder der amerikanischen Zone in Stuttgart trafen, ging man zwar noch nicht so weit, sich — wie Konrad Adenauer, nunmehr Vorsitzender der CDU der britischen Zone offiziell für einen Westzonenstaat auszusprechen, aber die ausschließliche Westzonenorientierung war ebenso eindeutig wie das faktische Abschreiben der Ostzone. Einmütig sprach man sich dagegen aus, daß Deutschland als eine Art „Brücke zwischen Ost und West“ fungieren könnte oder sollte. Der politische Schwerpunkt des zukünftigen Deutschlands müsse auf jeden Fall im Westen liegen; Berlin käme als Hauptstadt und politische Zentrale auf keinen Fall in Betracht. Die Ostzone existierte in den Besprechungen nur als Randproblem, als Gegenstand der Abschirmung und Ausgrenzung einerseits, der konterrevolutionären Einwirkung im Zusammenhang mit einer späteren Lösung der „Ostfrage“ — einschließlich der Frage der Grenzen — andererseits.
Mitte Mai 1946 forderte Hans Schlange-Schöningen, Leiter des Zentralamtes für Ernährung und Landwirtschaft der britischen Zone, in einer Denkschrift an die britische Militärregierung, die er kurz nach seiner Rückkehr von einer Dienstreise nach Thüringen verfaßt hatte, „die drei Westzonen im Sinne einer zielklaren Westpolitik unter einer deutschen Zentralregierung mit Exekutivgewalt zu organisieren und damit einen wirtschaftlich gesunden und politisch gefestigten Block gegen die russischen Bestrebungen zu schaffen, der einen festen Anschluß an die westeuropäische Politik und Kultur findet“.®° Wenn Schlange-Schöningen eine solche Forderung erhob, dann wußte er sich zweifellos nicht nur mit vielen seiner „Amtskollegen“, sondern auch mit Vertretern der britischen Militärregierung einig.
Die Führung der Sozialdemokratie ordnete sich mit der westzonalen Eingrenzung der SPD, der Ausrichtung ihrer Politik gegen die antifaschistisch-demokratischen Umwälzungen im Osten Deutschlands und der Ablehnung jeder Kontakte und Gespräche mit der SED in diesen Westzonenpartikularismus ein.
Wie immer auch dieser Westzonenpartikularismus motiviert war, seine Hauptnutznießer waren das deutsche Monopolkapital einerseits und die aggressiv-antisowjetischen Kräfte in den herrschenden Kreisen der Westmächte mit ihren Plänen für einen Westblock bei Abkehr von Jalta und Potsdam andererseits. Trotz Inhaftierungen einzelner Konzernherren, einer Reihe Beschlagnahmemaßnahmen, wie in bezug auf den IGFarben-Konzern, und weiterhin ungesicherter Zukunft konnte das deutsche Monopolkapital in den Besatzungszonen der USA, Großbritanniens und Frankreichs seine wirtschaftlichen Positionen — allerdings unter Kuratel der Westmächte — weitgehend erhalten und damit beginnen, sie zu reorganisieren und zu stabilisieren. Anders als in der Ostzone setzten Deutsche Bank, Dresdner Bank, Commerzbank und andere Großbanken, wenn auch dezentralisiert und mit mancherlei Beschränkungen, ihre Geschäftstätigkeit fort. Das gleiche galt für die großen deutschen Konzerne, wie die Vereinigten Stahlwerke, das Flick-Imperium, Thyssen, Mannesmann, Klöckner, die Gutehoffnungshütte, Bosch, Siemens, AEG, Schering und andere. Die Konzernzusammenhänge blieben erhalten und wurden im Rahmen der Westzonen — ausgerichtet auf diese — reorganisiert. Zugleich wurden verstärkt Versuche unternommen, die internationalen Konzernzusammenhänge und Geschäftsverbindungen zu aktivieren. Der Aufbau von Unternehmerorganisationen schritt zügig voran. Um die alliierten Beschlüsse zu unterlaufen, entwickelte man eigene Pläne zur „Entflechtung“ von Konzernen. In den Spitzenpositionen der Banken und Konzerne hatte es einige Veränderungen gegeben, aber solche Führungskräfte wie Hermann J. Abs (Deutsche Bank), Heinrich Dinkelbach (Vereinigte Stahlwerke), Karl Jarres (Klöckner-Konzern), Herrmann Reusch (Gutehoffnungshütte), Wilhelm Zangen (Mannesmann) und viele andere hatten auch schon während der faschistischen Diktatur führende Positionen innegehabt. Nicht wenige von ihnen — darunter Abs — übten zudem bei den westalliierten Militärregierungen Beraterfunktionen aus. Sie selbst oder ihre Beauftragten gelangten in Spitzenpositionen der Verwaltungen, wie der Konzernherr Abraham Frowein als Direktor des Zentralamtes für Wirtschaft der britischen Zone. Wie sicher sie sich zum Teil schon wieder fühlten, machte im Dezember 1945 eine Initiative von Karl Jarres deutlich, der Konzernherren und Spitzenvertreter von Verwaltungen zu einem gemeinsamen Protest bei Marshall Montgomery wegen „der Massenverhaftung in der Stahlindustrie“ aufforderte. „Meiner Meinung nach“, schrieb Jarres, „die, soweit ich sehe, weitgehend von Wirtschaftskreisen geteilt wird, darf sich ein solch stillschweigendes Hinnehmen derartig einschneidender Maßnahmen nicht wiederholen, wenn wir uns in Deutschland nicht später dem berechtigten Vorwurf aussetzen wollen, durch solche Passivität die Rechtmäßigkeit und Zweckmäßigkeit solcher Besatzungsmaßnahmen anerkannt zu haben …“”
Das Klasseninteresse des Monopolkapitals, sein Streben, um jeden Preis seine Machtgrundlagen zu erhalten bzw. seine Macht zu restaurieren, wurde zur Haupttriebfeder des immer stärker um sich greifenden Westzonenpartikularismus. Denn nur durch Konzentration auf die Westzonen und deren rigorose Abschirmung von den Einwirkungen der antifaschistisch-demokratischen Umwälzungen der Ostzone konnten die restaurativen Bestrebungen — wenn überhaupt zum Erfolg gelangen. Doch es war ungewiß, ob diese Rechnung aufgehen würde, denn auch in den Westzonen machten sich starke antifaschistisch-demokratische Bestrebungen bemerkbar.
Antifaschistisch-demokratische Bestrebungen zwischen Dominanz und Restriktion
Konsequente Faschismusund Militarismusbewältigung auf dem Wege tiefgreifender antifaschistisch-demokratischer Umgestaltungen erforderte in den Westzonen unter den Bedingungen westlicher, allerdings in der Pflicht der Potsdamer Beschlüsse stehender Militärgewalt in besonderem Maße die Aktionseinheit der Arbeiterklasse und die Herstellung eines breiten sozialen und politischen Bündnisses aller antimonopolistischen, demokratischen Kräfte. Von diesem Erfordernis ließ sich die KPD, mit solchen bewährten Funktionären wie Max Reimann, Albert Buchmann, Walter Fisch und Heinz Renner an der Spitze, auch weiterhin leiten. Sie kämpfte hierfür konsequent und beharrlich, konnte allerdings nicht verhindern, daß die Zusammenarbeit zwischen Organisationen von KPD und SPD seit Jahresbeginn 1946 ernste Rückschritte erlitt. Die Bezirksleitungen der KPD der britischen Zone boten im Mai 1946 dem westzonalen Parteitag der SPD in Hannover an, „alle Schritte gemeinsam“ zu gehen, „die der Überwindung der unmittelbaren Not im Aufbau der deutschen Friedenswirtschaft, der Verteidigung der Interessen aller Werktätigen und der Sicherung der Einheit Deutschlands dienen“, und verwiesen darauf, daß es „der einmütige Wille der deutschen Arbeiterklasse“ sei, „die wirtschaftlichen Machtpositionen der deutschen Imperialisten endgültig zu vernichten und den demokratischen Weg zum Sozialismus zu sichern“.?! Die KPD unterbreitete Vorschläge für eine Zusammenarbeit mit der SPD bei der Entnazifizierung, zur Durchsetzung der Mitbestimmung und in anderen Fragen. Die Bezirksparteitage der KPD entwickelten 1946 konkrete Aktionsprogramme für die Sicherung der Ernährung und die Durchführung antifaschistisch-demokratischer Umgestaltungen in den Ländern und Zonen. So listete die vom Bezirksparteitag der KPD Wasserkante im Mai 1946 angenommene Resolution „Junkerland in Bauernhand“ die in Schleswig-Holstein befindlichen Güter über 100 Hektar auf. Die KPD widerlegte hiermit und mit anderen Dokumenten die von Bodenreformgegnern vertretene Behauptung, daß in den Ländern der Westzonen kein ausreichender Großgrundbesitz vorhanden sei, der für eine Bodenreform größeren Stils herangezogen werden könnte.
In ihren Beschlüssen und Aufrufen gab die KPD zugleich tiefgründige Analysen der in den Westzonen vor sich gehenden widersprüchlichen Entwicklungsprozesse, deckte sie Manöver und Machenschaften der mit Großkapital und Großgrundbesitz verbundenen Kräfte auf, die eine restaurative Neuordnung anstrebten. Weitsichtig warnte sie vor den Gefahren der OstWest-Spaltung Deutschlands. Die Kritik am Verbot eigenständiger Aktionen von Betriebsräten und örtlichen Entnazifizierungsausschüssen zur Säuberung der Betriebsleitungen und Verwaltungen von aktiven Nazis und faschistisch belasteten Personen, an deren Weiterbeschäftigung und an anderen Maßnahmen der westlichen Besatzungsmächte führte wiederholt zu zeitweisem Verbot kommunistischer Zeitungen bzw. der Tätigkeit anderer kommunistischer Lizenzträger. In ihrer Entwicklung als legale Massenpartei erreichte die KPD bis März 1946 eine Mitgliederzahl von rund 187000. Die KPD besaß in den Westzonen deutlich mehr Mitglieder, als sie im gleichen Gebiet 1932 gehabt hatte. Angesichts der in den Westzonen herrschenden schwierigen Bedingungen und der vielfältigen antikommunistischen Umtriebe bedeutete das einen großen Erfolg. Allerdings blieb diese Mitgliederzahl absolut und noch mehr relativ weit hinter der in der Ostzone erreichten zurück, und ım Vergleich zur Mitgliederstärke der westzonalen SPD betrug die der KPD 1946 nur rund ein Drittel. Trotzdem errang die KPD beachtliche Erfolge bei den Betriebsrätewahlen im Ruhrgebiet und anderswo. Ihre Betriebsräte stellten sich an die Spitze des Kampfes um die Säuberung der Betriebsleitungen von ehemaligen Nazis und um die Enteignung der großkapitalistischen Naziund Kriegsverbrecher. Der KPD gelang es 1946, mit einer beträchtlichen Zahl von Exponenten in Vertretungskörperschaften von der Gemeindebis zur Landesebene aktiv zu werden. Sie stellte eine große Anzahl von Bürgermeistern und Stadträten sowie auch einige Länderminister.
Wahlplakat der KPD in der amerikanischen Zone, 1946
Auch in den Ländern der Westzonen konnte 1946 die gewerkschaftliche Zersplitterung zunehmend überwunden werden. Es entstanden einheitliche Industriegewerkschaften. Das Wirken kommunistischer Gewerkschafter, die 1946/47 in den Einheitsgewerkschaften über beträchtlichen Einfluß verfügten, spielte dabei eine wichtige Rolle. Die Mehrzahl der führenden Gewerkschaftsfunktionäre waren Sozialdemokraten oder standen der SPD nahe. Die Einheitsgewerkschaften beschränkten ihr Tätigkeitsfeld nicht auf Fragen von Lohn und Tarif sowie betriebliche Arbeitsbedingungen, sondern traten für die Durchsetzung eines umfassenden Mitbestimmungsrechts der Gewerkschaften ein und erhoben die Forderung nach Enteignung der großkapitalistischen Naziund Kriegsverbrecher und nach Schaffung einer gelenkten, sozial gerechten Wirtschaftsordnung, in der die Grundstoffund Schlüsselindustrien Gemeineigentum sein sollten. So nahm beispielsweise der Gewerkschaftskongreß der britischen Zone, der vom 21. bis 23. August 1946 in Bielefeld stattfand, eine Entschließung „Zur Beseitigung der Monopole“ an, in der es hieß: „Die unheilvolle Rolle, welche die privaten Monopole der Wirtschaft in der Vergangenheit gespielt haben, verlangt in der zukünftigen Wirtschaft ihre Beseitigung, wie es zugleich die Potsdamer Beschlüsse fordern … Das Eigentum derartiger Gebilde ist in die Hände des Staates zu überführen und nicht einzelnen Gemeinden, Provinzen oder Ländern zu übertragen.“ Die Einheitsgewerkschaften konnten sich im Verlauf des Jahres 1946 in der amerikanischen und der französischen Zone im Länderrahmen, in der britischen zonal organisieren. Ende 1946 lag die Gesamtmitgliederzahl der westzonalen Gewerkschaften bei 3 Millionen.
OMGUS ließ bereits im Januar 1946 — angesichts der restriktiv gehandhabten Parteienentwicklung und des unzureichenden Standes der Entnazifizierung viel zu früh — in den Ländern der amerikanischen Zone Gemeindewahlen durchführen. Diese erbrachten in Bayern und Württemberg-Baden klare Erfolge für CSU und CDU. In Hessen erhielt die SPD 41 Prozent der abgegebenen Stimmen. In Bayern entfielen fast ebensoviel Stimmen wie auf die CSU auf parteilose Kandidaten, bei denen es sich meist um Bürgermeister und Gemeinderäte aus der Nazizeit handelte. Die im Februar 1946 von OMGUS berufenen Landesverfassungsausschüsse oder auch vorläufigen Landesparlamente leiteten zur Konstituierung von verfassunggebenden Versammlungen der Länder über, die am 30. Juni 1946 direkt gewählt wurden. SPD und KPD erhielten dabei in Hessen mit 42 bzw. 10 Sitzen eine absolute Mehrheit gegenüber CDU und LDP mit 35 bzw. 6 Sitzen. In Württemberg-Baden erhielten die CDU 41, die SPD 32, die DVP 17 und die KPD 10 Sitze. In Bayern erreichte die CSU 109 von 180 Sitzen.
In den verfassunggebenden Versammlungen vor allem Hessens, aber auch Württemberg-Badens bzw. in ihren Vorläufern kam es zu einer zum Teil engen Zusammenarbeit von KPD und SPD, was sich auf die gesamte Verfassungsarbeit deutlich auswirkte. So stellten alle Parteien in der Vorläufigen Volksvertretung von Württemberg-Baden am 27. März 1946 in einer gemeinsamen Erklärung fest: „Die Bereitschaft zur Wiedergutmachung muß begleitet sein von dem festen Willen, einen deutschen Beitrag zur Sicherung des Weltfriedens zu leisten. Der Verbündete des Nazismus war der Monopolkapitalismus. (Sehr gut! in der Mitte.) Die Anhäufung materieller Machtmittel in seinen Händen muß unterbunden werden. Die junge deutsche Demokratie hat die Aufgabe, ihr alleiniges Entscheidungsrecht in den Fragen, die das Schicksal des ganzen Volkes und den Frieden der Welt berühren, nicht nur im formalen Verfassungsrecht zu sichern, sondern durch eine neue Wirtschaftsverfassung und im Willen und Bewußtsein des deutschen Volkes fest zu verankern. (Beifall.) Mit der Lösung dieser Aufgabe wird sie die von der Potsdamer Konferenz geforderte Dezentralisierung des deutschen Wirtschaftslebens mit dem Ziele der Vernichtung der bestehenden übermäßigen Konzentration der Wirtschaftskraft, dargestellt durch Kartelle, Syndikate, Trusts und andere Monopolvereinigungen, verwirklichen.“
Reeducationplakat der amerikanischen Besatzungsbehörden
Auch in den Ländern der westlichen Besatzungszonen wurden Maßnahmen ergriffen, um die Faschisierung von Schulen und Hochschulen zu beseitigen und diese zu demokratisieren. Ein beträchtlicher Teil der nazistisch belasteten Lehrer wurde aus dem Schuldienst entfernt. Sie konnten durch Wiedereinstellung älterer Lehrer nur zum geringen Teil ersetzt werden. Deshalb wurde anfangs auch auf „Schulhelfer“ zurückgegriffen. Als Lehrbücher dienten solche aus der Weimarer Republik. Westalliierte Bestrebungen zur „re-education“ (Umerziehung) und solche deutscher Reformpädagogen erreichten in einer Reihe von Ländern Teilerfolge bei einer Demokratisierung von Schulwesen und Unterricht, ohne daß das bürgerliche Bildungsprivileg davon tangiert wurde. An den Universitäten und Hochschulen wurden den Reformbestrebungen von Anfang an noch engere Grenzen gesetzt.
In einer Reihe von Ländern und Einrichtungen der Westzonen konnten sich Bestrebungen für eine grundlegende geistig-kulturelle Erneuerung Geltung verschaffen. Großes Echo fand vor allem der Gedanke, die demokratischen Kulturschaffenden in einer so breit angelegten antifaschistischen Kulturorganisation zu vereinigen, wie sie der Kulturbund zur demokratischen Erneuerung Deutschlands darstellte. Seit Herbst 1945 entstanden in einer Reihe von Städten der West-: zonen Ortsgruppen des Kulturbundes. Die westlichen Militärregierungen beobachteten diese Entwicklung mit Argwohn und behinderten die Herausbildung des Kulturbundes als umfassende antifaschistische Massenorganisation. Aus diesem Grunde traten manche’ Ortsgruppen unter anderen Bezeichnungen in Erscheinung, wie als „Freie Deutsche Kulturgesellschaft“ in Bonn, Düsseldorf, Hamburg und Frankfurt am Main oder als „Kulturliga“ in München. An der Spitze dieser antifaschistisch-demokratischen Kulturbewegung in den Westzonen wirkten solche bekannten Persönlichkeiten wie Max Burghardt, Wolfgang Langhoff, Walther Pollatschek, Walter Markov, Otto Pankok, Ernst Rowohlt und Theodor Heuss. Mitte 1946 existierten im westlichen Besatzungsbereich 40 Kulturbundgruppen mit 6500 Mitgliedern. Vor allem in Industriegebieten mit einer starken, kulturell interessierten Arbeiterklasse nahmen die Mitgliederzahlen weiter zu. Besonders günstig entwickelte sich demzufolge die Kulturbundarbeit im Ruhrgebiet und in der Provinz Westfalen. Damit entstanden in der britischen Zone die Voraussetzungen für die Gründung eines Landesverbandes des Kulturbundes, die nach erhaltener Genehmigung durch die Militärregierung ab April 1946 in Angriff genommen werden konnte und im Oktober 1946 mit der Essener Konferenz aller Ortsgruppen des inzwischen gebildeten Landes NordrheinWestfalen ihren Abschluß fand. An die Spitze des Landesverbandes trat der ehemalige KPD-Reichstagsabgeordnete Johann Fladung, der sich als Sekretär und Vorsitzender des Freien Deutschen Kulturbundes in Großbritannien, einer der größten deutschen Kulturorganisationen im Exil, Erfahrungen und Verdienste in der kulturpolitischen Arbeit erworben hatte.
Vom Landesverband Nordrhein-Westfalen ging eine aktivierende Wirkung auf die Organisationen in den anderen Ländern aus.
Als Generalintendant der Städtischen Theater in Düsseldorf wirkte Wolfgang Langhoff. In der Stadtverwaltung dieser nordrheinischen Großstadt hatte der Kommunist Hanns Kralik die Stellung eines Kulturdezernenten inne. Das Künstlertheater in Bremen leitete Willy A.Kleinau. Zeitweise arbeiteten am Sender Köln unter der Intendanz von Max Burghardt solche fortschrittlichen Rundfunkjournalisten wie Karl-Eduard von Schnitzler, Karl Georg Egel, Karl Gass und Els Vordemberge. Für diese antifaschistischen Kräfte bildeten die kulturellen Entwicklungen in der Ostzone einen wichtigen Bezugspunkt. Zunehmend gerieten sie mit ihren progressiven Auffassungen aber in Widerspruch zu den immer mehr tonangebenden konservativen Kräften in den westlichen Militärregierungen.
Im Herbst 1945 begannen westalliierte Kulturund Presseoffiziere Lizenzen für die Herausgabe von Presseerzeugnissen und Büchern an politisch Unbelastete zu erteilen, wobei sie sich in den ersten Monaten an den Beschlüssen der Antihitlerkoalition gegen Nazismus und Militarismus orientierten. So gehörte zu den ersten lizenzierten Zeitungen die „Frankfurter Rundschau“, deren Redaktion aus drei Kommunisten, darunter der Buchenwaldhäftling Emil Carlebach, drei Sozialdemokraten und dem engagierten Linkskatholiken Wilhelm Karl Gerst bestand. Auch für die „Rhein-Neckar-Zeitung“ und die „Hessischen Nachrichten“ besaßen Kommunisten zusammen mit anderen progressiven Kräften eine Lizenz. Die erste Verlagslizenz erhielt im Oktober 1945 Peter Suhrkamp; im November 1945 bekam Ernst Rowohlt die seine. Zeitschriften wie „Der Ruf“ und die „Frankfurter Hefte“ engagierten sich mit antimonopolistischer Akzentuierung für eine antifaschistisch-demokratische Neuordnung.
Die gesellschaftlichen Strukturen und die Kommandohöhen von Wirtschaft und Verwaltung wurden von alledem jedoch nicht tangiert. Das erwies sich — je länger dieser Zustand andauerte, desto mehr als gravierend und beförderte zunehmend restaurative Gegentendenzen. Trotz anhaltender Aufbruchsstimmung zu einem Neuanfang von Grund auf nahm die Gefahr zu, daß die politische Initiative an die restaurativen Kräfte überging, die sich Chancen ausrechneten, wenn es ihnen gelang, das große Lager der Demoralisierten, Verwirrten, Apathischen, politisch und sozial Entwurzelten und Heimatlosen für ihre Zwecke zu benutzen. Die restaurativen Tendenzen waren schon so stark und die Gefahren so groß, daß ihnen vermutlich nur durch die entschlossene Aktionseinheit der Arbeiterklasse, vor allem den engen Schulterschluß zwischen SPD und KPD verbunden mit einem Brückenschlag zur Ostzone — noch wirksam hätte begegnet werden können.
Der antikommunistische Kurs der westzonalen SPD. Das Verbot der Gründung der SED
Die westzonale SPD nahm auf ihrem ersten Parteitag in Haunover im Mai 1946 eine „Kundgebung“ an, in der unter der Losung eines „Sozialismus als Tagesaufgabe“ die Enteignung von Großgrundbesitzern, Bankund Konzernherren, die Überführung ihrer Betriebe in Öffentliches Eigentum und die Einführung einer Wirtschaftsplanung gefordert wurden. Damit bezog die SPD übereinstimmende oder angenäherte Standpunkte zu den von der KPD erhobenen antifaschistisch-demokratischen Forderungen sowie zu den Grundsatzerklärungen der meisten Gewerkschaften. Die „Kundgebung“ brachte deutlich die Forderung der überwiegenden Mehrheit der Sozialdemokraten nach antifaschistisch-demokratischen, antimonopolistischen Umgestaltungen-und ihr Festhalten am sozialistischen Kampfziel zum Ausdruck. Die ungenügende Differenzierung zwischen Gegenwartsund Zukunftsforderungen war ein strategischer Fehler, der sich politisch äußerst nachteilig auswirkte. Entscheidender Mangel der „Kundgebung“ jedoch war, daß sie von keinem Aktionsprogramm flankiert wurde. Man vertraute in starkem Maße auf übergreifende Entwicklungen, auf die Entstehung eines Westeuropas des „demokratischen Sozialismus“ als „dritte Kraft“. Was die Westzonen betraf, so wurde der parlamentarische Weg verabsolutiert, eine klassenmäßige Wertung von Demokratie und Staat zurückgewiesen, der „demokratische Sozialismus“ ohne Berücksichtigung der Machtfrage proklamiert. Mit einer antifaschistisch, aber zugleich antikommunistisch akzentuiertenGegenüberstellung von „Demokratie“ und „Diktatur“ wurde — ungeachtet der erhobenen gesellschaftspolitischen Forderungen — faktisch die Schaffung parlamentarisch-demokratischer Verhältnisse zur Hauptaufgabe der Faschismusüberwindung gemacht. Dies begründete eine grundlegende Gegenposition zur Blockpolitik und zu den antifaschistisch-demokratischen Umwälzungen in der Ostzone einerseits, Gemeinsamkeit mit begrenzten westalliierten Konzepten der Faschismusüberwindung andererseits. Die westzonale SPD grenzte sich von der KPD nicht nur ab, sondern profilierte sich in Frontstellung zur KPD. Die Mehrheit der Mitglieder ihres Parteivorstandes bezogen in Ablehnung jeder Annäherung zwischen SPD und KPD und des Vereinigungsprozesses in der Ostzone — eine prononciert antikommunistische Position.
Delegierte des SPD-Parteitages in Hannover, Mai 1946
Die Vereinigung von KPD und SPD zur SED war dort vollzogen worden, wo die Bedingungen dafür herangereift waren — in der Ostzone Deutschlands. Die SED verstand sich aber nicht als zonale, sondern alsnationale Partei, und sie betrachtete es als ihr Anliegen, dem Einheitsgedanken in allen Besatzungszonen zum Siege zu verhelfen. In diesem Sinne richtete der Parteivortand der SED am 7.Mai 1946 einen „Offenen Brief an alle Sozialdemokraten und Kommunisten“ mit dem Appell, für den demokratischen Neuaufbau eng zusammenzuwirken. Dieser Brief löste in den Westzonen starke Aktionen zur Gründung der SED: aus, die bis Sommer 1946 anhielten. Im Juli und August 1946 kam es in Großstädten der britischen und der amerikanischen Zone zu großen Einheitskundgebungen, auf denen Wilhelm Pieck, Otto Grotewohl, Max Fechner und Walter Ulbricht sprachen.
Die Bestrebungen, die SED auch in den Westzonen zu gründen, stießen auf das Verbot der westalliierten Militärregierungen. OMGUS wollte eine Gründung der SED nur unter der Voraussetzung zulassen, daß sich zuvor die Mehrheit der KPD und die der SPD für eine Vereinigung aussprachen. Das war jedoch angesichts der ablehnenden Haltung der westzonalen SPDFührung, die diese auf dem Parteitag in Hannover bekräftigt hatte, eine unrealisierbare Vorbedingung. Die historische Chance, das Vermächtnis des antifaschistischen Widerstandskampfes auch in den Westzonen zu erfüllen und die Einheit der Arbeiterbewegung auf revolutionärer Grundlage herzustellen, konnte hier nicht genutzt werden. Damit verbunden war zugleich, daß sich nunmehr deutlicher zwei unterschiedliche Wege von Faschismusbeseitigung und Neubeginn auf deutschem Boden abzuzeichnen begannen.
Führende Vertreter des Parteivorstandes der SED sprachen im ‚Sommer 1946 auf verschiedenen Kundgebungen für die Arbeitereinheit in den Westzonen. Ankunft in Essen, 20. Juli 1946, V. r.n.1.: Otto Grotewohl, Heinz Renner (KPD), Wilhelm Pieck, Paul Wojtkowski (KPD), Max Reimann (KPD)
Die Enteignung der Betriebe der Nazi- und Kriegsverbrecher in der Ostzone
- 1 Die Enteignung der Betriebe der Nazi- und Kriegsverbrecher in der Ostzone
- 1.1 Die Übergabe des sequestrierten Vermögens an die deutschen Verwaltungsorgane
- 1.2 Der Volksentscheid in Sachsen
- 1.3 Die Länder und Provinzen der sowjetischen Besatzungszone 1946
- 1.4 Die Enteignung der Nazi- und Kriegsverbrecher in Mark Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, der Provinz Sachsen und Thüringen. Die Beseitigung des Monopolkapitals in der Ostzone
- 1.5 Die Konstituierung der landeseigenen Unternehmen
Die Übergabe des sequestrierten Vermögens an die deutschen Verwaltungsorgane
Am 29. März 1946 ordnete der Oberste Chef der SMAD durch Befehl Nr. 97 die Übergabe der in den Ländern und Provinzen der Ostzone seit Herbst 1945 sequestrierten Vermögenswerte von Naziund Kriegsverbrechern in die Verfügungsgewalt der deutschen demokratischen Verwaltungsorgane an. Ausgenommen hiervon waren eine Reihe auf einer Sonderliste verzeichnete Betriebe, über die sich die SMAD die Verfügungsgewalt vorbehielt.
Der Befehl Nr. 97 beinhaltete eine bedeutsame Entscheidung der sowjetischen Regierung zugunsten des deutschen Volkes und des antifaschistisch-demokratischen Neuaufbaus. Die bisherigen Ergebnisse der in der Ostzone seit der Befreiung vom faschistischen Joch vollzogenen Umgestaltungen bestärkten die Sowjetunion in dem Vertrauen, daß die in Aktionseinheit handelnde Arbeiterklasse sich zusammen mit ihren Verbündeten als stark genug erweisen würde, die deutschen Naziund Kriegsverbrecher wirksam zu enteignen und deren Betriebe als wirtschaftliche Grundlage eines zukünftigen demokratischen deutschen Friedensstaates zu nutzen.
Das Vorgehen der Sowjetunion war ein richtungweisender Akt der Interpretation und der Realisierung eines entscheidenden Bestandteils der Potsdamer Beschlüsse. Es setzte ein Wegzeichen für die Beseitigung der deutschen Monopolvereinigungen auf eine solche Art und Weise, wie sie gleichermaßen den Interessen der Völker der Antihitlerkoalition und denen des deutschen Volkes entsprach. Mit ihrem Befehl Nr. 97 eröffnete die SMAD der deutschen Arbeiterklasse die Möglichkeit, ihre allenthalben erhobene Forderung nach entschädigungsloser Enteignung der monopolkapitalistischen Nazi- und Kriegsverbrecher und nach Überführung ihrer Betriebe in die Hände des Volkes in der sowjetischen Besatzungszone zu verwirklichen.
Kundgebung für die Einheit der Arbeiterklasse auf dem Burgplatz in Essen, Juli 1946
Mit dem Befehl Nr.97 verfügte die SMAD zugleich die Bildung der Zentralen Deutschen Kommission für Sequestrierung und Beschlagnahme. Die ZDK nahm am 1. April 1946 unter der Leitung von Friedrich Lange, der zuvor in Sachsen maßgeblich an der Sequestrierung von Vermögen der Naziund Kriegsverbrecher mitgewirkt hatte, ihre Tätigkeit auf. Sie war von der SMAD mit wesentlichen Kompetenzen gegenüber den Landesund Provinzialverwaltungen ausgestattet. Das ermöglichte es nun, den Sequestrierungsprozeß in den Ländern und Provinzen, vor allem aber in den Kreisen, in denen die Hauptarbeit zu leisten war, nach einheitlichen Gesichtspunkten zu gestalten. Dabei galt es vor allem, die Treuhänder, von deren Leitungstätigkeit die Nutzung der sequestrierten Vermögen in erster Linie abhing, anzuleiten und einheitliche Entscheidungen der Sequesterkommissionen über die Enteignung von Naziund Kriegsverbrechern oder über die Rückgabe von unter Sequester stehenden Kleinbetrieben an die Eigentümer, bei denen sich der. Verdacht auf faschistische Aktivitäten nicht bestätigte oder deren Belastung sich als geringfügig erwies, vorzubereiten.
Die ZDK griff den von einer aus Vertretern aller Parteien bestehenden Kommission bei der Landesverwaltung Sachsen am 30. April 1946 unterbreiteten Vorschlag auf, die unter Sequester stehenden Industriebetriebe in drei Gruppen zu ordnen und auf gesonderten Listen zu verzeichnen. Sie wies die Sequesterkommissionen in den Ländern und Provinzen an, auf einer Liste A all jene industriellen Produktionsstätten zu erfassen, die zur Enteignung vorgesehen waren; auf einer Liste B alle die Betriebe, die an solche Eigentümer zurückgegeben werden sollten, die sich in den Jahren des Faschismus nicht oder nur unerheblich belastet hatten; auf einer Liste C schließlich alle jene Unternehmen, auf die die sowjetische Besatzungsmacht aus unterschiedlichen Gründen Ansprüche erhob oder bei denen die Untersuchung über die faschistische Vergangenheit ihrer Eigentümer noch nicht abgeschlossen werden konnte.
Die Sequesterkommissionen standen nun vor der Aufgabe, zu entscheiden, welcher Industriebetrieb zu enteignen war. Das erwies sich vor allem dann als schwierig, wenn es sich um Betriebe handelte, deren Eigentümer sich am Rüstungsgeschäft bereichert bzw. Kriegsgefangene und deportierte Zivilisten ausgebeutet hatten, dabei aber nicht zur Monopolbourgeoisie
Die Ersten. Gemälde von Herbert Stockmann, 1946. Staatliche Galerie Moritzburg, Halle
gehörten und keine aktiven, sondern nur nominelle Mitglieder der NSDAP bzw. faschistischer Organisationen gewesen waren oder diese finanziell unterstützt hatten. In diesen Fällen zeigte sich oftmals, daß Kommissionsmitglieder mit bürgerlicher oder kleinbürgerlicher Denkweise eine ungerechtfertigte Nachsicht gegenüber schuldig gewordenen kleinen und mittleren Unternehmern übten. Dem konsequenten und umsichtigen Wirken der Vertreter der Arbeiterparteien gelang es in der Regel auch in solchen Fällen schließlich, einheitliche Festlegungen der Kommissionen über die Enteignung der fraglichen Unternehmer zu erreichen.
In dem von der ZDK inhaltlich mit vorbereiteten Befehl Nr. 154/181 vom 21.Mai 1946 wies der Oberste Chef der SMAD im einzelnen an, welche Eigentumskategorien in die Verfügung der Landesund Provinzialverwaltungen übergehen sollten. Die Präsidenten der Landesund Provinzialverwaltungen wurden zu einer erneuten genauen Prüfung des gesamten beschlagnahmten und sequestrierten Vermögens angehalten und verpflichtet, Vermögenswerte, die durch eine unkorrekte Anwendung des Befehls Nr. 124 unter Sequester gestellt worden waren, an die Eigentümer zurückzugeben.
Mit der Ausführung des Befehls Nr. 154/181 veränderte sich der Inhalt des Sequestrierungsprozesses dahingehend, daß nun die unmittelbare Vorbereitung der Enteignung der Vermögen von Naziaktivisten und Kriegsverbrechern durch die demokratischen Verwaltungsorgane bzw. die Rückgabe der Vermögenswerte an gar nicht oder nur geringfügig belastete Eigentümer in den Vordergrund traten.
Der Volksentscheid in Sachsen
Unmittelbar nach ihrer Gründung rückte die SED die Enteignung der Naziund Kriegsverbrecher in das Zentrum des Kampfes der Arbeiterklasse und ihrer Verbündeten. Es galt, die tiefe Krise, in der sich der deutsche Imperialismus immer noch befand, zur endgültigen Beseitigung seiner sozialen Wurzeln und Machtgrundlagen zu nutzen. Die Zeit war dafür auch insofern reif, als die intensive Aufklärung über das Wesen des Faschismus in seinem Zusammenhang mit dem deutschen Monopolkapital, über dessen Schuld am zweiten Weltkrieg, seine aus Profitstreben erwachsenen Kriegsziele und seine Kriegsverbrechen weitreichende Wirkung zeitigte. Der 1. Mai 1946 stand ganz im Zeichen der Entschlossenheit der Werktätigen, das Monopolkapital und die anderen Naziund Kriegsverbrecher zu enteignen. In machtvollen Kundgebungen forderten in Berlin, Chemnitz, Dresden, Halle, Leipzig und vielen anderen Städten der Ostzone Millionen Werktätige die Bestrafung und Enteignung der Naziund Kriegsverbrecher. Die SED verband diese Forderung mit der traditionellen, wirkungsvollen Arbeiterlosung: „Was des Volkes Hände schaffen, soll des Volkes eigen sein!“
Schon Anfang 1946 war auf Initiative der KPD und nach Zustimmung der SMAD den Parteien des antifaschistisch-demokratischen Blocks und dem FDGB in Sachsen der Vorschlag unterbreitet worden, in diesem Land einen Volksentscheid zur Enteignungsfrage durchzuführen, dem für alle Länder und Provinzen er Ostzone eine beispielgebende und repräsentative Bedeutung zukommen sollte. Der Vorschlag hatte am 29.März 1946 zu einem gemeinsam erarbeiteten „Entwurf einer Verordnung über die Enteignung von Naziverbrechern“ geführt. Am 4. April 1946 nahm das Präsidium der Landesverwaltung Sachsen die „Verordnung über Volksbegehren und Volksentscheide“ an, die einen Volksentscheid zur Bestrafung und Enteignung der Naziund Kriegsverbrecher ermöglichte.
Plakat zum 1. Mai 1946 von Arno Mohr. Akademie der Künste der DDR, Plakatsammlung der SPD und KPD für die Sozialistische Einheltspartei Deutschlands
In der CDU und der LDPD war es über einen solchen Volksentscheid zu heftigen Diskussionen und Auseinandersetzungen gekommen. Die Mehrheit der Funktionäre und Mitglieder, von denen nicht wenige an den Überprüfungen durch die Sequesterkommissionen teilgenommen hatten, traten ebenfalls für die Enteignung der Monopolherren als Naziund Kriegsverbrecher ein und unterstützten den Volksentscheid. Einer Überführung der enteigneten Betriebe in Volkseigentum standen sie jedoch oft noch zwiespältig gegenüber. Einflußreiche reaktionäre Führungskräfte in der LDPD, vor allem im Industrieund Wirtschaftsausschuß beim Parteivorstand konzentriert, hatten schon Ende 1945/Anfang 1946 in ihrem Industrieprogramm und im „Programm einer deutschen Wirtschaftspolitik“ eine konterrevolutionär-restaurative Plattform entwickelt. Davon ausgehend, unterstellten sie der SED, daß diese mit dem Volksentscheid eine allgemeine „Sozialisierung“ bzw. eine generelle Verstaatlichung der Wirtschaft anstrebe.
Die SED begegnete diesen Unterstellungen auf wirkungsvolle Weise mit der von ihr unternommenen breiten Aufklärung über die Ziele des Volksentscheids. Zugleich bestimmten die vom antifaschistisch-demokratischen Block in Sachsen und der sächsischen Landesverwaltung gemeinsam erarbeiteten und am 30. April 1946 beschlossenen Richtlinien für die Einstufung als Kriegsinteressent, aktivistischer Nazi und Kriegsverbrecher in aller Klarheit, wer durch den Volksentscheid enteignet werden sollte. Außerdem kam es auf Initiative der SED zu dem am 27.Mai 1946 bekanntgegebenen Beschluß der Landesverwaltung Sachsen zur Rückgabe von 1931 sequestrierten Unternehmen an deren Eigentümer, nachdem sich diese als nicht in erheblichem Maße belastet erwiesen hatten. Diese Maßnahme entzog dem Sozialisierungsgerede vollends den Boden. Am 13.Juni 1946 erklärte der Parteivorstand der LDPD: „Die LDP erkennt an, daß die SMA dem sächsischen Volke.die beschlagnahmten Betriebe zurückgibt, und ist damit einverstanden, daß die Betriebe von Kriegsschuldigen, Kriegsverbrechern, Kriegsinteressenten und aktivistischen Nazis in das Eigentum des Volkes durch Volksentscheid überführt werden. Die LDP stellt mit Befriedigung fest, daß die anderen Betriebe ihren Eigentü-
Die Länder und Provinzen der sowjetischen Besatzungszone 1946
Staatsgrenzen Grenzen Deutschlands nach dem Potsdamer Abkommen Halle Landeshauptstädte, jeweils Sitzvon Landesregierung Landtag Grenzen der Länder und Provinzen bzw. Stadtgrenze von Berlin Landesgericht Landesblockausschuß Grenzen der Landkreise SMA Kreisstädte Grenze der sowjetischen Besatzungszone zu den Westzonen Grenzen der Stadtkreise Grenzen der Sektoren in Berlin sowjetischer Sektor artierikanischerscktör Landtagsmandate nach den Wahlen 1946 britischer Sektor französischer Sektor mern zurückgegeben werden und in Zukunft vor Beschlagnahme geschützt werden sollen.“ ”
Der politische Hauptwiderstand gegen den Volksentscheid ging von Führungskräften der CDU aus, so von Jakob Kaiser und Ernst Lemmer als den beiden Vorsitzenden der Partei in der Ostzone und von Hugo Hickmann als dem Vorsitzenden des Landesvorstandes Sachsen der CDU. Mit dem Verweis auf eine vorgeschützte oder auch wirkliche Sorge um eine einheitliche Regelung im „Reichsmaßstab“ wandten sie sich im zentralen Blockausschuß gegen den sächsischen Volksentscheid. Sie erklärten außerdem, der Landesverwaltung Sachsen fehle zur Durchführung des Volksentscheids die Legitimation; für eine solche Entscheidung sei eine gewählte parlamentarische Körperschaft erforderlich. Doch erwies sich diese Position als unhaltbar — nicht zuletzt deshalb, weil die Ziele des Volksentscheids mit dem korrespondierten, was auch in den Westzonen von der Mehrheit der Arbeiterklasse und anderen antifaschistisch-demokratischen Kräften deutlich gefordert wurde. Die „Reichseinheit“ wurde vielmehr durch das Blockieren antifaschistischdemokratischer Veränderungen und das Vordringen restaurativer, partikularistischer Kräfte und Tendenzen in den Westzonen gefährdet. Das beispielgebende Vorangehen auf dem antifaschistisch-demokratischen Weg in einer Besatzungszone konnte, wenn es in Übereinstimmung mit dem Potsdamer Abkommen erfolgte, der demokratischen Einheit Deutschlands nur förderlich sein. Mehr noch — unter den eingetretenen Umständen war ein solches Vorgehen geradezu geboten und nicht zu umgehen.
Da die Ablehnung bzw. das Hinauszögern des Volksentscheids weder bei der Mehrheit der Mitglieder noch bei den potentiellen Wählern der CDU einen Rückhalt fanden, unterzeichnete Hickmann am 25.Mai 1946 den gemeinsamen „Aufruf der SED, der LDPD, der CDU und des FDGB des Landes Sachsen an die sächsische Bevölkerung zum Volksentscheid über die Übergabe von Betrieben von Kriegsund Naziverbrechern in das Eigentum des Volkes“. Mit der Veröffentlichung dieses Aufrufs richtete der Block an die Landesverwaltung zugleich den Antrag, die Volksabstimmung am 30. Juni 1946 durchzuführen, und reichte bei ihr dazu einen Gesetzentwurf ein. Letzterer war eine konkretisierte Fassung des Entwurfs vom 29. März 1946. Noch am 25. Mai beschloß das Präsidium der Landesverwaltung einstimmig diesen Entwuıf „Über die Übergabe von Betrieben von Kriegsund Naziverbrechern in das Eigentum des Volkes“ als Gesetz.
Dies bildete den Auftakt für eine Welle von Versammlungen und Kundgebungen in Betrieben, Städten und Ortschaften, für eine sich über das ganze Land ausbreitende Massenbewegung zur Vorbereitung des Volksentscheids für die Enteignung der Naziund Kriegsverbrecher. Die SED mobilisierte, vor allem unterstützt vom FDGB, von der FDJ und vom Kulturbund, die ganze Kraft ihrer Parteiorganisation. Auf unzähligen Kundgebungen sprachen führende Vertreter der antifaschistisch-demokratischen Parteien und Organisationen: Wilhelm Pieck, Otto Grotewohl, Max Fechner, Wilhelm Koenen, Fritz Selbmann, Rudolf Friedrichs und Kurt Fischer (SED), Otto Freitag und Ruth Matthes (CDU) sowie Johannes Dieckmann (LDPD) und andere. Sie erläuterten Ziele, Charakter und Inhalt des Volksentscheids. In zahlreichen Schriften, in der Presse und auf Flugblättern wurden die Fragen der Bevölkerung beantwortet. Der Volksentscheid wurde als eine antifaschistisch-demokratische, antiimperialistische Strafmaßnahme gekennzeichnet, die Enteignung der Betriebe der Naziund Kriegsverbrecher und deren Überführung in die Hände des Volkes als wichtiger Schritt begründet, der der Sicherung des Friedens und eines demokratischen Neuaufbaus im Interesse der werktätigen Massen diene.
Der Parteivorstand der SED rief die sächsische Bevölkerung am 14. Juni 1946 dazu auf, ihre Stimme für die Entmachtung der Naziund Kriegsverbrecher abzugeben. In diesem Aufruf hieß es unter anderem: „Alle Völker blicken auf das Ergebnis des Volksentscheides in Sachsen. Aus der Stimmbeteiligung und der Zahl der Ja-Stimmen ist für alle Völker erkennbar, ob das Volk jetzt ernste Anstrengungen unternimmt, den Frieden zu sichern.“
Die Belegschaften Tausender Betriebe Sachsens sowie anderer Länder und Provinzen der Ostzone und eine Vielzahl von Delegierten auf Gewerkschaftskonferenzen stellten sich geschlossen hinter die Ziele des Volksentscheids. In der Resolution der sächsischen Landesdelegiertenkonferenz der IG Eisen und Metall vom 4. Juni 1946 zum Volksentscheid beispielsweise hieß es: „Niemals dürfen uns die Kriegstreiber in unserem demokratischen Aufbau stören. Der Volksentscheid wird ihnen den Boden entziehen … Der Volksentscheid ist ein Bekenntnis, den Frieden zu sichern.“
Im gemeinsamen Ringen um den Volksentscheid festigte sich das Bündnis der Arbeiterklasse mit der Bauernschaft, der Intelligenz, den Handwerkern und den Gewerbetreibenden sowie mit kleinen und mittleren kapitalistischen Unternehmern. Aus den Dörfern gingen Tausende Zustimmungserklärungen von werktätigen Bauern zum Volksentscheid ein, und auch von über 150000 Handwerkern und Einzelhändlern Sachsens kamen entsprechende Schreiben.
So wurde in der Stellungnahme der Handwerkskammer des Landes Sachsen zum Volksentscheid vom 13. Juli 1946 formuliert: „Vergessen wir nie …, daß es die Kriegsund Naziverbrecher waren, … die gerade Euch schaffende, friedliiebende Handwerker und Gewerbetreibende zu Tausenden und aber Tausenden in die Rüstungsindustrie gezwungen haben“, die „Eure Betriebe und Geschäfte schlossen … Wenn Ihr wollt, daß das Handwerk und Gewerbe wieder einen goldenen Boden bekommt, stimmt am 30.Juni für die Übergabe der Betriebe der Kriegsund Naziverbrecher in die Hände des Volkes.“
Eine beträchtliche Resonanz fand der sächsische Volksentscheid auch unter den fortschrittlichen Kräften der Intelligenz. Lehrer von Volksund Hochschulen setzten sich für den Volksentscheid ein. Führende Repräsentanten der künstlerischen Intelligenz, wie Johannes R. Becher, Bernhard Kellermann, Erich Weinert, Willi Bredel, der Schauspieler Paul Wegener und andere, erklärten, daß sie mit ihrer Stimme für den Volksentscheid die Forderung verbänden, mit dem faschistisch-imperialistischen Regime auch auf geistigkulturellem Gebiet konsequent abzurechnen.
Bedeutsam war, daß sich auch kirchliche Kreise Sachsens und anderer Länder öffentlich zum Volksentscheid bekannten, darunter die Superintendenten von Kirchbach aus Freiberg und Lösch aus Auerbach im Vogtland sowie die evangelisch-reformierten Gemeinden von Dresden und von Leipzig. In der Stellungnahme der Evangelisch-lutherischen Landeskirche Sachsens hieß es: „Wenn in diesen Wochen das sächsische Volk dazu aufgerufen wird, durch einen Volksentscheid dazu beizutragen, daß unser Vaterland nicht noch einmal in einen Krieg gestürzt wird und daß Arbeit und Wirtschaft wieder in den Dienst am Nächsten und an der Gemeinschaft zurückgeführt werden, so kann die Kirche daran nicht schweigend vorübergehen. Auch ihre Glieder sind damit zur Entscheidung gerufen.“
Die SMA des Landes Sachsen betrachtete es — wie der Stellvertreter des Chefs für Zivilangelegenheiten D.G.Dubrowski gegenüber der „Sächsischen Zeitung“ betonte — „als Sache der Deutschen“ !%!, über die der Landesverwaltung Sachsen zur Verfügung gestellten Betriebe zu entscheiden. Die SMA Sachsen stellte sich gleichzeitig mit ihrer ganzen Autorität hinter den Volksentscheid als eine mit den Potsdamer Beschlüssen übereinstimmende, demokratische Willensbekundung des deutschen Volkes und unterstützte ihn aktiv, damit die Positionen der Arbeiterparteien bzw. der SED sowie der progressiven Kräfte in CDU und LDPD stärkend.
Gestützt auf die Massenstimmung und auf das Drängen vieler Funktionäre und Mitglieder von CDU und LDPD in Sachsen und in den anderen Ländern bzw. Provinzen, gelang es am 21. Juni 1946 auch im zentralen Blockausschuß in Berlin mit den Unterschriften der SED, der. CDU und der LDPD einen Beschluß zur Durchführung des Volksentscheids anzunehmen. Damit erlitten in der CDU und in der LDPD die reaktionären Politiker eine Niederlage.
Der Volksentscheid am 30. Juni 1946 wurde zu einem denkwürdigen Höhepunkt des politischen Lebens in der Ostzone. Auch die Bevölkerung der anderen Länder und Provinzen richtete ihr Augenmerk gespannt auf Sachsen, wo die Abstimmungsberechtigten eine der wichtigsten und weitreichendsten Entscheidungen der deutschen Nachkriegsgeschichte trafen. Die sächsische Bevölkerung rechtfertigte die in sie gesetzten Erwartungen vollauf. In geheimer Abstimmung gab die überwältigende Mehrheit der Abstimmungsberechtigten ihre Stimme für das Gesetz zur Enteignung der Naziund Kriegsverbrecher und engagierte sich damit verantwortungsbewußt für Faschismusbewältigung, Friedenssicherung, Demokratie und sozialen Fortschritt. Über die monopolkapitalistischen Naziund Kriegsverbrecher, deren Enteignung und Bestrafung im Mittelpunkt des Volksentscheids stand, wurde ein vernichtendes Urteil gefällt. Der 30. Juni 1946 wurde zu einem „schwarzen Tag“ für das deutsche Monopolkapital und zu einem Tag der Hoffnung für das deutsche Volk in seinem Streben nach geschichtlicher Wende und gesicherter friedlicher Zukunft.
Das Ergebnis des Volksentscheids war ein deutliches Indiz dafür, daß die antifaschistisch-demokratische Umwälzung und Erneuerung in der Ostzone bereits wichtige Ergebnisse erreicht und spürbare Wirkungen erzielt hatten. Das wurde auch in der Sowjetunion und in den volksdemokratischen Ländern sowie von demokratischen Kräften in kapitalistischen Ländern als ein ermutigendes Zeichen für eine demokratische Entwicklung auf deutschem Boden registriert.
Von den 3 693 511 stimmberechtigten Männern und Frauen ab dem 21. Lebensjahr hatten 3461095 (93,71 Prozent) an der Volksabstimmung teilgenommen und 2 686 477 (77,62 Prozent) für das Gesetz zur Übergabe der Betriebe der Naziund Kriegsverbrecher in das Eigentum des Volkes gestimmt. Ungültig waren die Stimmen von 5,82 Prozent der Abstimmungsberechtigten. 16,56 Prozent hatten sich gegen die Enteignung ausgesprochen. 14228 Personen waren als Kriegsverbrecher, ehemalige Angehörige der SS oder anderer faschistischer Unterdrückungsinstrumente, als Funktionäre der NSDAP und ihrer Gliederungen von der Abstimmung ausgeschlossen gewesen. Noch am 30.Juni 1946 wurde das Gesetz über die Übergabe von Betrieben von Kriegsund Naziverbrechern in das Eigentum des Volkes in Sachsen rechtskräftig.
Auf der Grundlage des Volksentscheids wurden in Sachsen 1760 Betriebe und Unternehmen vollständig und 101 zu Teilen entschädigungslos enteignet. Von den vollständig enteigneten gingen 1002 in landeseigene Verwaltung. 278 wurden an die kommunalen Verwaltungsorgane der Kreise und kreisfreien Städte übereignet. Letztere waren überwiegend kleinere Unternehmen, die der unmittelbaren Versorgung der Bevölkerung des jeweiligen Territoriums dienten (darunter Kliniken, Autoreparaturwerkstätten, Baubetriebe, Lichtspieltheater und andere Kulturstätten). Die Konsumgenossenschaften erhielten 73 Unternehmen; 28 weitere wurden anderen demokratischen Organisationen zugesprochen. 379 Betriebe, die wirtschaftspolitisch eine untergeordnete Rolle spielten, wurden an Privatpersonen verkauft. Über etwa 600 sequestrierte Betriebe war noch keine Entscheidung gefallen.
Stimmschein für den Volksentscheid in Sachsen
Die Enteignung der Nazi- und Kriegsverbrecher in Mark Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, der Provinz Sachsen und Thüringen. Die Beseitigung des Monopolkapitals in der Ostzone
Die Vorbereitung und Durchführung des Volksentscheids in Sachsen fand in allen anderen Ländern und Provinzen der Ostzone breite mehrheitliche Zustimmung und Unterstützung. Angesichts dessen gelang es der SED auch hier gemeinsame Erklärungen der Landesbzw. Provinzialblockausschüsse für eine gesetzliche Regelung der Enteignung der Naziund Kriegsverbrecher herbeizuführen.
Unmittelbar nach dem Volksentscheid in Sachsen orientierte der Parteivorstand der SED darauf, die Enteignung der Naziund Kriegsverbrecher in den anderen Ländern und Provinzen beschleunigt durchzuführen. In einem Rundschreiben des Zentralsekretariats an die Provinzialvorstände Sachsen und Mark Brandenburg sowie an die Landesvorstände Thüringen und Mecklenburg-Vorpommern der Partei vom 7.Juli 1946 wurde die Aufgabe gestellt, schnellstens die Listen der zur Enteignung bzw. zur Rückgabe vorgesehenen Betriebe fertigzustellen und nach Unterzeichnung durch die Parteien und den FDGB über Presse, Rundfunk und auf andere Weise bekanntzugeben.
Diese Aufgabe war nur in Zusammenarbeit mit breiten Kreisen der Bevölkerung zu lösen. Tausende Arbeiter, Betriebsräte, Funktionäre der SED, des FDGB, der FDJ, der Frauenausschüsse sowie Mitglieder der CDU und der LDPD in den beschlagnahmten dem Gesetz über die Übergabe von Beiriebenvon Kriegsund Naziverbrechern in das Eigentum des Volkes
Betrieben halfen den Mitgliedern der Sequesterkommissionen auch in diesen Territorien noch einmal, eine große Anzahl von Unternehmen und Vermögenswerten zu überprüfen. Die betroffenen Unternehmer versuchten mit allen Mitteln und auf vielfältige Weise — auch durch Beeinflussung von Betriebsangehörigen und Betriebsräten -, ihrer Enteignung zu entgehen. Nicht selten gelang es ihnen, Sequesterkommissionen zu täuschen, so daß es zu Beschlüssen über die Rückgabe von Betrieben an belastete Nazis kam, die jedoch vielfach schon auf Grund der Proteste von SED-Betriebsgruppen, Gewerkschaftsorganisationen und Belegschaften wieder korrigiert wurden.
Die Präsidien der Landesbzw. Provinzialverwaltungen beschlossen Gesetze oder Verordnungen zur Enteignung der Naziaktivisten, Kriegsschuldigen und Kriegsverbreoher für das Land Thüringen am 24. Juli, für die Provinz Sachsen am 30. Juli, für die Provinz Mark Brandenburg am 5. August und für das Land Mecklenburg-Vorpommern am 16. August 1946. Auf dieser Gesetzesgrundlage wurden 1946 bereits die meisten dazu vorgesehenen Objekte, Vermögenswerte, Unternehmen usw. enteignet. In der Provinz Sachsen betraf das von den etwa 30000 überprüften Objekten 2396. Davon überführte die Provinzialverwaltung 691 Industriebetriebe in das Eigentum der Provinz. 1705 Betriebe gingen zumeist in das Eigentum von Kommunalverwaltungen der Kreise und Städte bzw. von Genossenschaften über. In Thüringen wurden von etwa 11000 sequestrierten Objekten 1000 Industriebetriebe enteignet und von diesen 286 vollständig und 39 anteilmäßig in Landeseigentum übernommen. Rund 600 Betriebe erhielten die Kommunalverwaltungen oder gesellschaftliche Organisationen. In Mecklenburg-Vorpommern und in Mark Brandenburg waren es 605 bzw. 1371 Betriebe, die enteignet wurden. Bereits vor der Annahme der entsprechenden Gesetze und Verordnungen waren in Mark Brandenburg 573, in Mecklenburg-Vorpommern 451, in der Pfovinz Sachsen 2436 und in Thüringen etwa 3000 Unternehmen an ihre früheren Besitzer zurückgegeben worden, nachdem sich deren Nichtbzw. geringfügige Belastung erwiesen hatte. Die Unternehmen, die außerdem in allen Ländern und Provinzen an private Besitzer verkauft wurden, waren, wie auch jene, die an Kommunalverwaltungen, Parteien, gesellschaftliche Organisationen bzw. Genossenschaften übergingen, kleinere Betriebe. Über einen Teil der sequestrierten Betriebe blieb auch hier die Entscheidung noch offen.
Obwohl sich die Enteignung der Naziund Kriegsverbrecher über einen längeren Zeitraum erstreckte, von heftigen Klassenkämpfen und politischen Auseinandersetzungen begleitet war und erst im Frühjahr 1948 abgeschlossen wurde, fiel doch bis Herbst 1946 die Hauptentscheidung. Die Mehrzahl der größten Betriebe wurden im 2. Halbjahr 1946 enteignet. Darunter waren vor allem Werke solcher großen Kriegsverbrecherkonzerne wie IG Farben, Mannesmann, Flick, Siemens, AEG, Krupp, Salzdetfurth, Wintershall, Henkel, Vereinigte Stahlwerke, Thyssen, Borsig und anderer. Sie waren in Landeseigentum oder in staatliches sowjetisches Eigentum übergegangen.
Im Ergebnis einer antifaschistisch-demokratischen, revolutionären Massenbewegung wurden — anknüpfend an die Traditionen des Kampfes der revolutionären Arbeiterbewegung sowie anderer Klassen und Schichten bzw. politischer Kräfte gegen Imperialismus und Krieg — mit der Enteignung der Naziund Kriegsverbrecher die entscheidenden gesellschaftlichen Grundlagen und Wurzeln für imperialistischen Krieg und Faschismus beseitigt, die dafür hauptund mitverantwortlichen gesellschaftlichen Kräfte entmachtet und wesentliche Grundlagen für einen antiimperialistisch-demokratischen deutschen Friedensstaat gelegt. Ein Vermächtnis des deutschen antifaschistischen Widerstandskampfes wurde erfüllt und eines der wichtigsten Ziele der Antihitlerkoalition verwirklicht.
Die Enteignung der monopolkapitalistischen Naziund Kriegsverbrecher bildete den Angelpunkt beim Vollzug der geschichtlichen Wende auf deutschem Boden und bei der Entstehung eines neuen, demokratischen, dem Frieden verpflichteten fortschrittlichen Deutschlands. Sie erfolgte auf deutschem Boden dort, wo es der Arbeiterklasse gelungen war, ihre Hegemonie zu errichten, und wo die Besatzungsmacht die konsequente Bestrafung der Naziund Kriegsverbrecher mit allen Mitteln förderte.
Unter Hegemonie der Arbeiterklasse mit radikaler Konsequenz vollzogen, erhielt die Enteignung der Naziund Kriegsverbrecher einen revolutionären Inhalt, verband sie sich aufs engste mit Aufgaben, die die Arbeiterklassse im Sinne ihrer historischen Mission zu lösen hat, reichte sie in ihrer gesellschaftlichpolitischen Dimension weit über die antifaschistischdemokratische Motivation und Zielstellung hinaus.
Die Enteignung der Naziund Kriegsverbrecher und die Überführung ihrer Betriebe in gesellschaftliches Eigentum entsprachen im wesentlichen den in den europäischen volksdemokratischen Ländern durchgeführten Nationalisierungen der Großindustrie. Die Machtgrundlagen des Imperialismus wurden beseitigt und die kapitalistischen Produktionsverhältnisse in der Großindustrie aufgehoben.
Die Vernichtung des industriellen Rüstungspotentials und die Leistungen zur Wiedergutmachung
Die SMAD führte die in den Grundsätzen des Potsdamer Abkommens enthaltene Bestimmung, die gesamte für den Krieg nutzbare Industrie Deutschlands auszuschalten oder zu überwachen, in ihrer Zone sorgfältig und konsequent aus. In Übereinstimmung mit den alliierten Beschlüssen wurden in der Ostzone bis Ende 1946 676 Rüstungswerke demontiert.!” Darunter befanden sich unter anderem 311 Flugzeugwerke, 140 Munitions-, 129 Waffenund 14 Panzerfabriken. Die unverzügliche Beseitigung der ausgesprochenen Rüstungskapazitäten entzog der Monopolbourgeoisie die Möglichkeit, diese unter dem Vorwand der Reorganisation zu erhalten, und schwächte die ökonomische Position der Monopolunternehmen.
In Erwägung, daß Deutschland nicht im Stande sein werde, die ihr im zweiten Weltkrieg zugefügten Kriegsschäden in Höhe von insgesamt 485 Milliarden Dollar zu Vorkriegspreisen jemals begleichen zu können, hatte die UdSSR ihre Reparationsforderungen gegenüber Deutschland auf 10 Milliarden Dollar zu den Preisen von 1933 beziffert. Die Siegermächte hatten sich im Februar 1945 in Jalta darauf geeinigt, daß die Reparationen vornehmlich in Sachund Arbeitsleistungen zu erbringen waren.
Gemäß der von den Westmächten auf der Potsdamer Konferenz maßgeblich beeinflußten Reparationsregelung war die Sowjetunion darauf angewiesen, die ihr zuerkannten Reparationsansprüche fast ausschließlich aus ihrer Besatzungszone zu befriedigen. Die vereinbarten ergänzenden Lieferungen aus Demontagen in den Westzonen waren relativ gering; eine Einigung über die dafür auszusuchenden Objekte erwies sich als schwierig, und die Realisierung erfolgte schleppend oder gar nicht.
Die Reparationen aus Deutschland waren für den wirtschaftlichen Wiederaufbau der von den faschistischen Okkupanten verwüsteten Gebiete und für die Festigung der internationalen Position der UdSSR unerläßlich. Dabei erwuchs für diese aus der politischen Gesamtsituation der Zwang, in kurzer Zeit die hauptsächlichsten Wiedergutmachungsleistungen aus der eigenen Besatzungszone zu entnehmen. Damit waren ökonomische, soziale und auch politisch-ideologische Wirkungen verbunden, die das Tempo und in einer gewissen Weise auch den Verlauf der antifaschistischdemokratischen Umgestaltung und des Wirtschaftsaufbaus beeinflußten.
Die Sowjetunion ließ sich in ihrer Demontagepolitik von dem im März 1946 angenommenen Reparations-Industrieplan des Alliierten Kontrollrates leiten. Umfang und Struktur der in diesem Plan festgelegten deutschen Industrieproduktion entsprachen allerdings weder den Entwicklungsbedürfnissen einer deutschen Friedenswirtschaft noch den realen weltwirtschaftlichen Gegebenheiten der Nachkriegszeit.
Die UdSSR schloß in ihrer Besatzungszone die Demontagen im wesentlichen bis zum Frühjahr 1947 ab.
Insgesamt wurden ca. 1700 industrielle Objekte vollständig oder zu Teilen demontiert. Die abgebauten Produktionsstätten hatten zu 36 Prozent ihren Standort in Sachsen, zu je 17,5 Prozent in Mark Brandenburg und in Mecklenburg-Vorpommern und zu 15 bzw. 14 Prozent in Thüringen und in der Provinz Sachsen (ab 1. März 1947 Land Sachsen-Anhalt). Der Umfang des demontierten Anlagevermögens war in den einzelnen Industriezweigen sehr unterschiedlich. Nach den Angaben einer Reihe von zentralen Vereinigungen Volkseigener Betriebe aus dem Jahre 1948 waren in deren Bereich Demontagen in folgendem Umfang erfolgt: In der Reifenindustrie waren alle Produktionsmittel abgebaut. Die Demontage des Anlagevermögens belief sich beim Schienenfahrzeugbau auf 80 Prozent, im polygrafischen Maschinenbau auf zwischen 95 und 60 Prozent, im Werkzeugmaschinenbau auf 55 Prozent, in der Strickund Wirkwarenindustrie auf 43 und in den Spinnereien auf 10,6 Prozent.
Die Produktionsstätten der Schwarzmetallurgie waren mit Ausnahme der Maximilianhütte in Unterwellenborn vollständig demontiert worden. Zumeist erstreckte sich der Abbau von Produktionsmitteln nur auf einzelne Betriebsabteilungen bzw. auf ausgewählte Maschinen und Anlagen; nur ein begrenzter Teil der Betriebe wurde vollständig demontiert. Die sowjetischen Demontagekommandos führten ihre Arbeiten meist so aus, daß die Arbeiter und Ingenieure unmittelbar nach ihrem Abrücken mit dem, wenn auch zunächst provisorischen Wiederausstatten der Arbeitsräume beginnen konnten. Sie hatten dabei die Unterstützung der sowjetischen Dienststellen. Im Jenaer Zeiss-Werk zum Beispiel, wo ab Ende Oktober 1946 94 Prozent der Produktionseinrichtungen demontiert wurden, hatte eine Kommission der SMAD vor Beginn der Demontage geprüft, welche Produktionsmittel als Rekonstruktionsmuster im Werk bleiben müssen. Noch während des Abbaus traf die SMAD gemeinsam mit der Landesverwaltung Thüringen und den Zeiss-Ingenieuren und -arbeitern die notwendigen Vorbereitungen für die technische Wiederausstattung des Werkes. Anfang 1947 konnte die Produktion wieder aufgenommen werden.
Die Demontagen beeinträchtigten das Wirtschaftsleben in der sowjetischen Besatzungszone unterschiedlich stark. Bedeutungslos blieb der Abbau von Überkapazitäten, die aus kriegswirtschaftlichen Gründen vornehmlich in der metallverarbeitenden Industrie entstanden waren oder die es in der Leichtindustrie gab. Anders verhielt es sich mit der Demontage von Produktionsanlagen in der chemischen Industrie, in der Schwarzmetallurgie und in einigen Zweigen der elektrotechnischen Industrie. Durch sie wurde der Wirtschaftsaufbau empfindlich beeinträchtigt, weil in diesen Produktionsstätten Erzeugnisse hergestellt wurden, von denen ganze Industriezweige und Wirtschaftsbereiche abhingen.
Die UdSSR traf ihre Demontageentscheidungen unter der Annahme, daß die Wirtschaftseinheit Deutschlands und damit die industrielle Arbeitsteilung und Verflechtung aufrechterhalten bzw. wiederhergestellt werden könnten. Mit dem Übergang der westlichen Besatzungsmächte zum kalten Krieg und mit der beginnenden Spaltung Deutschlands blieben die entsprechenden Lieferungen aus den Westzonen jedoch weitgehend aus. Es bedurfte einer längeren Zeit, bis die dadurch erforderlich werdenden Produktionskapazitäten in der Ostzone geschaffen waren.
Verschiedenlich folgten die mit der Demontage beauftragten Dienststellen auch Einsprüchen und Alternativvorschlägen, die seitens der SED und demokratischer Verwaltungsorgane, unterstützt von sachkundigen sowjetischen Fachleuten, unterbreitet wurden, und beließen bestimmte Anlagen an ihren Standorten.
Neben industriellen wurden auch ausgewählte Objekte des Verkehrswesens demontiert. Der Abbau des zweiten Gleises führte zu einschneidenden Veränderungen im Streckennetz der Deutschen Reichsbahn. In ihrem Ergebnis verringerte sich die Kilometerzahl der zweiund mehrgleisigen Strecken auf dem Gebiet der Ostzone von 6081,27 im Jahre 1944 auf 1063,09 im Jahre 1948.
Die Haltung der deutschen Bevölkerung zu den Demontagen und anderen Formen der Wiedergutmachung der vom faschistischen deutschen Imperialismus in den von ihm okkupierten Ländern verursachten materiellen Schäden war außerordentlich widersprüchlich. Aus der Betroffenheit über die brutale faschistische Kriegführung war die Einsicht entsprungen, daß das deutsche Volk für die in seinem Namen angerichteten Schäden aufkommen müsse. Mit den einsetzenden Demontagen und den immer spürbarer werdenden Folgen des faschistischen Krieges begann sich allerdings eine Stimmung zu entwickeln, die diese Einsicht bei vielen zu verdrängen drohte. Das zeigte sich vor allem in den Belegschaften, deren Produktionsstätten der Demontage unterlagen und die um ihre materielle Existenz bangten. Es bedurfte des kompromißlosen Bekenntnisses der SED, der Gewerkschaften und anderer Demokraten zur Wiedergutmachungspflicht der Deutschen, der unermüdlichen Aufklärung über die vom Faschismus begangenen Verbrechen und der praktischen Erfahrung, daß die Zukunft des deutschen Volkes durch seine demokratische Wiederaufbauarbeit garantiert war, um gegen diese Stimmung anzugehen. Diese Diskussion wurde durch die Mitte 1946 von der Sowjetregierung getroffene Entscheidung erleichtert, 213 Großbetriebe der Energiewirtschaft, der Brennstoffindustrie, der Metallurgie, der chemischen und elektrotechnischen Industrie, des Maschinenund Fahrzeugbaus, der Baumaterialienund der Konsumgüterindustrie nicht zu demontieren, sondern als staatliches sowjetisches Eigentum in Gestalt der Sowjetischen Aktiengesellschaften (SAG) in der sowjetischen Besatzungszone und im sowjetischen Sektor Berlins zu nutzen.
Demontiertes zweites Gleis auf dem Streckenabschnitt Bahnsteighaus Leipzig-Mölkau, 1947
Eine besondere Stellung nahm das sowjetische Unternehmen ein, dem es oblag, die sächsischen Uranerzvorkommen auszubeuten. Die sowjetischen und deutschen Bergleute der SAG Wismut, die unter außerordentlich schwierigen Bedingungen arbeiteten, ermöglichten es mit, daß es der UdSSR in kurzer Zeit gelang, das amerikanische Kernwaffenmonopol zu brechen und als erste in der Welt die Kernkraft für friedliche Zwecke zu nutzen.
Die Entscheidung, wichtige Produktionsstätten in der sowjetischen Besatzungszone zu belassen, war von einer außerordentlichen und weitreichenden politischen, ökonomischen, wissenschaftlich-technischen and sozialen Bedeutung für den weiteren Vollzug der antifaschistisch-demokratischen Umgestaltung. Sie erleichterte es, den Reparationsverpflichtungen nachzukommen. Die in den SAG-Betrieben erzielten Produktionsergebnisse wurden auf dem Reparationskonto verrechnet, und die im Laufe der Jahre zunehmende Produktion dieser Betriebe, die der sowjetischen Besatzungszone zur Verfügung stand, erleichterte es den deutschen Betrieben, die Reparationsaufträge auszuführen.
Die Reparationsleistungen aus der laufenden Produktion wurden zur Hauptform der Wiedergutmachung. Sie hatten im Jahre 1946 den entscheidenden Anteil an der Aufwärtsbewegung der Industrieproduktion und an der Erweiterung der Produktionssortimente. Bis in das Jahr 1947 hinein absorbierten die Reparationsaufträge weitgehend den Gesamtumfang der Industrieproduktion, zumal auch die Lebensmittelkredite, die aus den Beständen der sowjetischen Truppen zur Verfügung gestellt wurden, in industriellen Sachwerten zu begleichen waren. Die 1945 und 1946 in der sowjetischen Besatzungszone erbrachten außerordentlich hohen Reparationsleistungen erleichterten es der UdSSR, ihre Volkswirtschaft zügig wiederherzustellen und weiterzuentwickeln.
Eine dritte Form der Wiedergutmachung stellte die wissenschaftlich-technische Arbeit dar, zu der deutsche Wissenschaftler, Ingenieure und Facharbeiter von Ministerien der UdSSR verpflichtet wurden. Sie arbeiteten in der UdSSR oder im sowjetischen Besatzungsgebiet in speziell dafür eingerichteten wissenschaftlichen Instituten, Forschungsund Entwicklungsstellen sowie Produktionsstätten. Die in die UdSSR verpflichteten Naturwissenschaftler, Ingenieure und Facharbeiter setzten in sowjetischen Forschungsinstituten ausgewählte naturwissenschaftlichtechnische Arbeiten fort oder arbeiteten gemeinsam mit sowjetischen Fachleuten am Aufbau von Produktionsstätten für Erzeugnisse, die den wissenschaftlichtechnischen Fortschritt repräsentierten.
Der Physiker und Nobelpreisträger des Jahres 1926 Gustav Hertz richtete beispielsweise bei Suchumi ein Institut für Kernforschung ein, in dem ein industrielles Verfahren zur Trennung von Uran-Isotopen entwickelt wurde. Manfred von Ardenne siedelte mit seinem Berliner Forschungsinstitut in die UdSSR über und half ebenfalls mit, das amerikanische Atombombenmonopol zu brechen. Chemiker und Techniker aus Schwarza und Wolfen, den beiden Zentren der deutschen Synthesefaserstofforschung und -produktion, unter ihnen Hermann Klare, unterstützten mit ihrem Wissen und ihren praktischen Erfahrungen den Aufbau einer Kapronfabrik in der Sowjetunion.
In der sowjetischen Besatzungszone und im sowjetischen Sektor Berlins wurden im Sommer 1945 in den Zentren der Wissenschaft und der Technik die Technischen Büros geschaffen, die für eine Reihe von sowjetischen Ministerien wissenschaftliche Forschungen betrieben, betriebstechnische Arbeiten ausführten sowie verschiedene Projekte, technische Beschreibungen und Übersichten erarbeiteten. Diese unter Leitung sowjetischer Fachleute stehenden Einrichtungen waren großzügig angelegt, gut ausgestattet, und sie boten vielen in der sowjetischen Besatzungszone und in Berlin beheimateten Wissenschaftlern und Ingenieuren ein interessantes Arbeitsfeld. Das bewahrte diese vor der durch die Nachkriegssituation gegebenen Gefahr, eine Tätigkeit ausführen zu müssen, die ihrem Wissen und Können nicht entsprach. Die Technischen Büros erlangten für die wissenschaftlich-technische Entwicklung und auch für das wissenschaftliche Leben in der sowjetischen Besatzungszone und in Berlin vor allem perspektivisch eine große Bedeutung.
Die Konstituierung der landeseigenen Unternehmen
Im 2. Halbjahr 1946 begannen sich in den Ländern und Provinzen landeseigene Industrieunternehmen zu konstituieren. Die Landesund Provinzialverwaltungen formierten das ehemalige Monopoleigentum bzw. Eigentum von Kriegsverbrechern und Naziaktivisten, ehemals staatskapitalistisches und anderes nunmehr herrenloses Eigentum sowie einige andere Eigentumsarten zu einem einheitlichen Landeseigentum. Dabei bedienten sie sich verschiedener Formen bürgerlichen Wirtschaftsrechts. Einige Landesund Provinzialverwaltungen übernahmen dieses industrielle Vermögen direkt, andere bildeten daraus ein Sondervermögen. In Sachsen erhielt die Hauptverwaltung Landeseigene Betriebe die juristische Form einer Anstalt des öffentlichen Rechts. In den anderen Ländern und Provinzen wurden landeseigene Unternehmen als Körperschaften des Öffentlichen Rechts etabliert. Die Organisation der landeseigenen Industrie wies somit anfangs auch eine Reihe von Unterschieden auf. Diese resultierten vor allem aus einer verschiedenartigen Struktur der in Landeseigentum übergegangenen Vermögen sowie aus der recht unterschiedlichen Vorbereitung der Landesund Provinzialverwaltungen auf die Aufgabe, landeseigene Industrieunternehmen funktionstüchtig zu gestalten.
Das Präsidium der Landesverwaltung Sachsen hatte, auf die in den Ämtern für Betriebsneuordnung und in den landeseigenen Bergbauunternehmen bereits gesammelten Erfahrungen gestützt, schon am 28. Juni 1946 einen „Plan zur Verwertung der durch den Volksentscheid vom 30.Juni 1946 enteigneten Betriebe und Geschäftsanteile“ verabschiedet, in dem die Prinzipien fixiert waren, nach denen das künftige Landeseigentum an industriellen Produktionsmitteln organisiert und geleitet werden sollte. Nach diesen Prinzipien erfolgte auch der organisatorische Aufbau der landeseigenen Industrie Sachsens. Federführend bei der Erarbeitung des Plans war der Bergmann und erfahrene Kommunist Fritz Selbmann, der nach seiner Befreiung aus faschistischer Kerkerhaft als Leiter des Leipziger Arbeitsamtes maßgeblich zur Wiederaufnahme der Produktion in der Stadt und in den Bergbaubetrieben ihrer Umgebung beigetragen hatte und nach seiner Berufung zum Vizepräsidenten der Landesverwaltung Sachsen mit großer Entschiedenheit die Enteignung der Naziund Kriegsverbrecher organisierte und für den Wirtschaftsaufbau wirkte.
Die sächsische Landesverwaltung legte außerordentlichen Wert auf eine sachkundige und politisch klare Leitung der landeseigenen Industrie. Sie wählte sorgfältig umsichtige und prinzipienfeste Führungskräfte für die Hauptverwaltung Landeseigene Betriebe, für die Industrieverwaltungen und für die Betriebsdirektionen aus. Dabei fand sie die volle Unterstützung der Landesparteiorganisation der SED, die kampferprobte Parteimitglieder in diese Leitungsgremien delegierte. Am 2. August 1946 waren von den 1092 Direktoren landeseigener Betriebe in Sachsen 60,6 Prozent Mitglieder der SED, 8,5 Prozent Mitglieder bürgerlich-demokratischer Parteien und 30,9 Prozent parteilos.
Beim Konzipieren der Leitungsprinzipien für die landeseigene Industrie achtete die Landesverwaltung darauf, daß die in deren Betrieben beschäftigten Arbeiter, Angestellten, Ingenieure und Wissenschaftler auf die Führung der Unternehmen und Betriebe Einfluß ausüben konnten. Bei den Unternehmensleitungen wurden entsprechende Gremien gebildet.
Zugleich sicherte die sächsische Landesverwaltung den demokratischen Verwaltungsorganen die ihnen gebührende Position im Leitungsprozeß. Sie gestaltete den Leitungsund Organisationsaufbau der landeseigenen Industrie so, daß deren einheitliche Führung möglich wurde. Die Hauptverwaltung Landeseigene
Nach der Konstituierung als landeseigener Betrieb
Betriebe hatte die Aufgabe, die Industrieverwaltungen und die ihnen jeweils angehörenden Niederlassungen in ihrer Wirtschaftstätigkeit anzuleiten und zu kontrollieren. Die 65 Industrieverwaltungen, in denen die landeseigenen Betriebe entsprechend ihrem Produktionsprogramm bzw. nach ihrem Standort zusammengefaßt waren, bildeten das Herzstück der landeseigenen Industrie. Sie waren mit den Rechten von selbständigen Wirtschaftsunternehmen ausgestattet. Sie planten die Produktion ihrer Betriebe, setzten sich für die Versorgung mit Rohstoffen und Produktionsmitteln ein. In ihrer Hand lag die gesamte Finanzwirtschaft der ihnen zugeordneten landeseigenen Betriebe, und sie waren für die Sozialpolitik in diesen Betrieben verantwortlich.
An diesem Herangehen der Landesverwaltung Sachsen orientierten sich bei der Konstituierung ihrer landeseigenen Industrie zunehmend auch die anderen Landesund Provinzialverwaltungen. Sie wurden dabei vom Parteivorstand der SED, bei dem im Herbst 1946 mehrere Beratungen über die zweckmäßigste Leitung und Organisation der landeseigenen Industrie geführt wurden, unterstützt. Die Organisation und die Leitung der landeseigenen Industrie gemäß dem Charakter dieses Eigentums stellten zwei der wichtigsten Momente ihres Konstituierungsprozesses dar. Sie bildeten zugleich die Voraussetzung dafür, daß, abhängig vom Fortschreiten der Hegemonie der Arbeiterklasse in den demokratischen Verwaltungsorganen, auch andere Momente Geltung erlangen konnten, wie die Planung des Reproduktionsprozesses, die Einführung von Prinzipien der wirtschaftlichen Rechnungsführung, das Entstehen einer neuen Einstellung der in den landeseigenen Betrieben Beschäftigten zu den vergesellschafteten Produktionsmitteln und zur Arbeit sowie von Beziehungen der kameradschaftlichen Unterstützung und der gegenseitigen Hilfe. In dem Maße, wie diesen Momenten Rechnung getragen wurde, vermochte die in allen Zweigen präsente landeseigene Industrie ihrer politischen und wirtschaftlichen Stellung gerecht zu werden. Das traf insbesondere auf die landeseigenen Betriebe im Bergbau, in der Energiewirtschaft, in der Metallurgie, im Maschinenbau, in der elektrotechnischen Industrie und in der Textilindustrie zu.
Insgesamt entstand in der Ostzone eine neue, das gesellschaftliche Eigentum an industriellen und agrarischen Produktionsmitteln, das staatliche Verkehrswesen, das demokratische Finanzsystem und das Landesbzw. Provinzeigentum in der Zirkulationssphäre umfassende Wirtschaftsform. Ihr Rückgrat bildeten die landesbzw. provinzeigenen Unternehmen und die SAG, in denen die Möglichkeit für das Herausbilden einer Produktionsweise sozialistischen Typs angelegt war.
Die ersten demokratischen Wahlen in der Ostzone
Inhaltsverzeichnis
- 1 Die ersten demokratischen Wahlen in der Ostzone
- 1.1 Die zweite zentrale Beratung der deutschen Verwaltungsorgane mit dem Obersten Chef der SMAD. Die Schaffung beratender Versammlungen
- 1.2 Die Bewährung der Blockpolitik in den Wahlvorbereitungen
- 1.3 Die Wahlen zu den Volksvertretungen in den Gemeinden, Kreisen, Ländern und Provinzen der Ostzone und in Berlin
- 1.4 Ergebnisse der Volksund Berufszählung im Herbst 1946
- 1.5 Umsiedler und Kriegsgefangene
- 1.6 Die wirtschaftlichen Ergebnisse des Jahres 1946
Die zweite zentrale Beratung der deutschen Verwaltungsorgane mit dem Obersten Chef der SMAD. Die Schaffung beratender Versammlungen
Am 28. Mai 1946 fand beim Obersten Chef der SMAD, Armeegeneral W. D. Sokolowski, in BerlinKarlshorst die zweite Beratung mit den Präsidenten und 1. Vizepräsidenten der Landesund Provinzialverwaltungen und führenden Repräsentanten der deutschen Zentralverwaltungen statt. Alle fünf Präsidenten — Wilhelm Höcker (Mecklenburg-Vorpommern), Karl Steinhoff (Mark Brandenburg), Erhard Hübener (Provinz Sachsen), Rudolf Paul (Thüringen) und Rudolf Friedrichs (Land Sachsen) legten Rechenschaft über die von ihren Verwaltungen geleistete Arbeit ab, charakterisierten differenziert den Stand der antifaschistisch-demokratischen Umwälzung und des Neuaufbaus in ihren Territorien und verwiesen auf aufgetretene Schwierigkeiten bzw. Probleme. Schwerpunkte der Berichte und Aussprachen waren Fortschritte und Schwächen der ökonomischen Entwicklung, die komplizierten Bedingungen bei der Versorgung der Bevölkerung, die Reparationsleistungen, sozialpolitische Fragen, Entnazifizierung und Demokratisierung sowie vor allem die Tätigkeit der Verwaltungsorgane.
In seinem Schlußwort stellte Armeegeneral Sokolowski fest, daß seit der ersten Beratung in diesem Kreis vom November 1945 „eine große und positive Arbeit geleistet worden sei“.!® Die Aufmerksamkeit auf künftige Wahlen lenkend, betonte er, wie „diese Wahlen vorbereitet werden, davon wird die Wiederherstellung Deutschlands abhängen“.!
Nach Ausführungen zur Entwicklung von Industrie und Landwirtschaft, zur besseren Versorgung mit Rohstoffen, Halbfabrikaten und Ersatzteilen durch die Hilfe der SMAD und zur Notwendigkeit der Reparationsleistungen an die UdSSR schloß der Armeegeneral mit dem Dank an die deutschen Vertreter für deren unermüdliches Wirken. „Ich und die Sowjetische Militär-Administration werden alles tum, um die Demokratisierung Deutschlands zu Ende zu führen. Wir werden alle Fragen, die hier gestellt wurden, sehr aufmerksam beraten … Mit gemeinsamen Kräften werden wir für die sowjetische Zone die Fragen lösen!“
Die Beratung mit dem Obersten Chef der SMAD beförderte das vertrauensvolle Zusammenwirken zwischen der SMAD und den deutschen Verwaltungsorganen. Entgegen der Ankündigung wurden solche Beratungen jedoch nicht zu einer ständigen Einrichtung.
Um die Mitarbeit aller Parteien des antifaschistisch-demokratischen Blocks in den Verwaltungsorganen zu sichern und auszubauen, schlug der Parteivorstand der SED am 14. Mai 1946 vor, bis zu den Wahlen von Vertretungskörperschaften auf Gemeinde-, Kreisund Landesebene beratende Versammlungen zu bilden. Bei der Beratung dieses Vorschlages in den Ausschüssen des antifaschistisch-demokratischen Blocks und im zentralen Blockausschuß zeigten sich zunächst Unverständnis und Widerstände auf seiten der bürgerlich-demokratischen Parteien in bezug auf die Mitwirkung von Vertretern der demokratischen Massenorganisationen in den beratenden Versammlungen, die ihren bürgerlich-parlamentarischen Auffassungen widersprach und von der sie nicht zu Unrecht — befürchteten, daß sie den Einfluß der proletarischen Kräfte verstärken würde. Letztlich setzte sich jedoch in beiden Parteien die Bereitschaft zur Mitarbeit in den beratenden Versammlungen auch unter diesen Bedingungen durch. Es gelang, bei allen Landesund Provinzialverwaltungen und bei den kommunalen Verwaltungen bis zum Juni 1946 beratende Versammlungen zu bilden. Den beratenden Versammlungen in den Ländern bzw. Provinzen gehörten jeweils 70 Personen an: je zehn Vertreter der SED, der CDU, der LDPD und des FDGB, je fünf der VdgB und je drei der FDJ, der Frauenausschüsse, der Industrieund Handelssowie der Handwerkskammern. Außerdem wurden von den Präsidenten der Landesbzw. Provinzialverwaltungen jeweils etwa zehn Einzelpersönlichkeiten in diese Körperschaften berufen. Bei den Verwaltungen der Stadtund der Landkreise arbeiteten in diesen Organen 30 und bei den Gemeindeverwaltungen je nach Größe 10 bis 20 Mitglieder.
In Gemeinden, wo es noch keine Ortsgruppe der SED oder wie das noch häufiger der Fall war keine Parteiorganisationen der CDU bzw. der LDPD gab, traten Schwierigkeiten bei der Bildung der beratenden Versammlungen auf, so daß in deren Zusammensetzung erhebliche Unterschiede entstanden.
Im „Gesetz über die Bildung beratender Körperschaften bei der Selbstverwaltung im Lande Thüringen“ vom 12.Juni 1946 wurden als Aufgaben der beratenden Landesversammlung umrissen, „die Tätigkeit der Landesverwaltung zu unterstützen, zu fördern und dem gesamten Volke verständlich zu machen, die Landesverwaltung bei der Ausarbeitung von Gesetzen und Verordnungen zu beraten sowie auf eine ordnungsmäßige und volksnahe Durchführung dieser Aufgaben auf allen Gebieten des öffentlichen Lebens zu achten“.!% Zur Lösung dieser Aufgaben wurden bei allen beratenden Versammlungen Ausschüsse gebildet, zum Beispiel für allgemeine und kommunale Verwaltung, für wirtschaftspolitische Angelegenheiten, Finanzen und Steuern, Kultur und Erziehung, Justiz, Arbeit und Sozialfürsorge, Gesundheitswesen.
Obwohl die beratenden Versammlungen nur vom Juni bis September/Oktober 1946 existierten, konnten bei ihrer Schaffung und in ihrer Tätigkeit eine Vielzahl von Erfahrungen gewonnen werden, die später die Gestaltung der erweiterten Zusammenarbeit der Blockparteien in den gewählten Volksvertretungen erleichterten.
Die Bewährung der Blockpolitik in den Wahlvorbereitungen
Nach einem Jahr antifaschistisch-demokratischer Umgestaltung und erfolgreicher Aufbauarbeit waren in der Ostzone Bedingungen entstanden, die eine demokratische Entscheidung der Bevölkerung in Wahlen ermöglichten. Von den Wahlen konnte erwartet werden, daß sie den tatsächlich erreichten Stand von Faschismusund Militarismusbewältigung und Demokratisierung sichtbar machen und dokumentieren würden, in welchem Maße der in der Ostzone beschrittene Weg von der Bevölkerung mitgetragen bzw. bejaht wurde. Für die SED bildeten die Wahlen nach dem Volksentscheid in Sachsen und dem Ringen um die Enteignungsgesetze in den anderen Ländern und Provinzen eine weitere große Bewährungsprobe, die es in enger Wechselwirkung mit der Lösung jener Aufgaben zu bestehen galt, die nach dem Vereinigungsparteitag hinsichtlich des einheitlichen Aufund Ausbaus der Parteiorganisation und vor allem auch eines Bildungsund Schulungssystems entstanden. Der Zustrom von 169.945 neuen Mitgliedern allein im Zeitraum von April bis Juli 1946 war ein Indiz für die politische Ausstrahlungskraft der SED, stellte aber auch zusätzliche Anforderungen an ihre marxistisch-leninistische Entwicklung und an die Gewährleistung ihres einheitlichen und geschlossenen Handelns.
Die am 19. Juni 1946 von der SMAD bestätigten Wahlordnungen, denen auf Initiative der SED von der Provinzialverwaltung Mark Brandenburg erarbeitete Vorschläge zugrunde lagen, gewährleisteten das demokratische Wahlrecht für freie, gleiche und geheime Wahlen. Wahlberechtigt waren alle Frauen und Männer, die das 21. Lebensjahr vollendet, wählbar alle, die das 23. Lebensjahr abgeschlossen hatten. Kein aktives und passives Wahlrecht hatten Naziund Kriegsverbrecher, ehemalige Angehörige der SS, Mitglieder der NSDAP bzw. ihrer Gliederungen, die verantwortliche Funktionen bekleidet hatten. Ehemalige nominelle Mitglieder der Nazipartei waren nur vom passiven Wahlrecht ausgeschlossen. Entsprechend den Wahlordnungen vereinbarten SED, CDU und LDPD im antifaschistisch-demokratischen Block, daß jede Partei eigene Wahllisten aufstellt.
Die Wahlordnungen gewährten neben den Parteien auch den demokratischen Massenorganisationen das Recht, eigene Kandidatenlisten für die Wahl aufzustellen. Diese Bestimmung war in den Ausschüssen des Blocks der antifaschistisch-demokratischen Parteien äußerst umstritten. Während sich die SED konsequent dafür einsetzte, wandten sich viele Funktionäre der CDU und der LDPD unter Berufung auf Prinzipien des bürgerlich-demokratischen Wahlrechts, nach denen nur Parteien Träger der Wahl und der Demokratie sein durften, dagegen. Die Auseinandersetzungen in den Blockausschüssen führten zu dem Ergebnis, daß bei den Gemeindewahlen die VdgB und die Frauenausschüsse in allen Ländern und Provinzen kandidieren konnten, während dies für den FDGB und die FDJ nur zum Teil möglich war. Bei den Kreistagsund den Landtagswahlen war die Kandidatur mit eigenen Listen der VdgB und in Sachsen auch dem Kulturbund und den Frauenausschüssen gestattet.
Mitte Juni 1946 veröffentlichte der Parteivorstand der SED einen Wahlaufruf und ein „Programm zu den Gemeindewahlen“.!” Ausgehend von ihrem „Willen zur Errichtung einer antifaschistisch-demokratisch-parlamentarischen Republik“! und unter Verweis auf die in der Ostzone dafür bereits verwirklichten Umwälzungen und erreichten Aufbauerfolge entwickelte die SED ihre Vorstellungen zur Gemeindeverfassung bzw. zur Schaffung einer demokratischen Gemeindeverwaltung, zu Wirtschafts-, Landwirtschafts-, Finanzund Steuerfragen, zur Wohnungsund Ernährungsproblematik, zu Fragen des Gesundheitswesens und des Arbeitsrechts, von Kunst und Kultur. Gesondert sprach sie Frauen, Jugendliche, Kriegsgefangene, Heimkehrer und Umsiedler an.
Die SED ging mit dem Ziel in den Wahlkampf, ihren Einfluß als machtausübende Partei zu verstärken, die Mehrheit der Wähler zu gewinnen und in den demokratischen Neuaufbau einzubeziehen. Gleichzeitig hielt die Partei an der Blockpolitik fest und orientierte darauf, daß trotz „der Verschiedenheit der Weltanschauungen und der Wahlprogramme“ auch „in Zukunft die erfolgreiche Fortführung des schweren Aufbauwerkes nicht nur die Aufgabe einer Partei, sondern aller Parteien, des ganzen Volkes“ sein müsse. Der Parteivorstand der SED forderte die CDU und die LDPD auf, den Wahlkampf im Geiste gemeinsamer Arbeit zu gestalten, eine „Verschärfung der Gegensätze zwischen den Parteien … zu vermeiden“.! Dem stimmten CDU und LDPD am 22. Juni 1946 in einem gemeinsamen Wahlaufruf mit der SED zu. Bei den bevorstehenden Wahlen ging es, wie Wilhelm Pieck auf einer Wahlversammlung im August in Riesa betonte, um „die große Bewährungsprobe“ des deutschen Volkes, aus der ersichtlich sein werde, „ob es aus der Vergangenheit etwas gelernt hat …, ob es entschlossen ist, die Kräfte der Reaktion niederzuringen und durch die Demokratie die Garantien zu schaffen, daß niemals mehr die anderen Völker durch eine Aggression von deutscher Seite bedroht werden“.
In dem vom Parteivorstand der SED herausgegebenen „Handbuch zur Duchführung der Gemeindewahlen 1946“ hieß es: „Die Stoßrichtung des Wahlkampfes hat sich deshalb nicht gegen die anderen Parteien, sondern gegen den Nazismus und die wiedererstarkende Reaktion in Deutschland zu richten.“!!! Dementsprechend wies der Parteivorstand auch unkorrektes Handeln von Vertretern der eigenen Partei gegenüber Funktionären der CDU und der LDPD zurück und hob hervor, daß die Blockpolitik keine Angelegenheit bloßen Taktierens sei. Auf Initiative der SED wurde die Wahlvorbereitung zu einer eindrucksvollen Rechenschaftslegung der Bürgermeister, der Landräte sowie vieler anderer Funktionäre der demokratischen Verwaltungsorgane und zu einer breiten Volksaussprache. In Sachsen informierten bis Ende August 2579 Bürgermeister — bei etwa 2800 Gemeinden Öffentlich über ihre Tätigkeit.
CDU und LDPD maßen den Wahlen ebenfalls große Bedeutung zu und unternahmen vielfältige Anstrengungen, um die höchstmögliche Zahl an Wählerstimmen zu erlangen. Dabei blieb nicht aus, daß der eigene Beitrag zu den Ergebnissen der antifaschistisch-demokratischen Umwälzung oft überhöht, für Schwierigkeiten und Probleme aber einseitig die SED verantwortlich gemacht wurde. Doch setzten die Mitverantwortung, die CDU und LDPD im Rahmen der Blockpolitik trugen, und der gemeinsame Wahlaufruf derartigen Verzerrungen Grenzen. Beide Parteien gingen als Mitvollstrecker der in der Ostzone vollzogenen antifaschistisch-demokratischen Umwälzungen in den Wahlkampf und bekannten sich zu deren Ergebnissen. Sie unterschieden sich aber deutlich nicht nur von der SED, sondern auch untereinander in bezug auf die Interpretation dieser Umgestaltungen und ihres historischen Platzes im Kontext eines „christlichen“ bzw. „liberalen“ Gesamtkonzepts.
CDU wie LDPD nutzten ihre jeweils ersten Parteitage, die sie im Vorfeld der Wahlen durchführten, um sich als Parteien nicht nur selbst, sondern auch für ihre potentiellen Wähler zu profilieren.
Die LDPD führte ihren 1. Parteitag vom 6. bis 8. Juli 1946 in Erfurt durch. Obwohl die reaktionären Kräfte in ihren Reihen, besonders im Landesverband Berlin, über starke Positionen verfügten, konnten sie sich auf dem Parteitag nicht entscheidend durchsetzen. „Der Parteitag bestätigte die Politik des Vorstandes unter Führung von Wilhelm Külz seit Beginn der antifaschistisch-demokratischen Umwälzung. Er billigte die Blockpolitik …, die Bodenreform, die Demokratisierung der Justiz und die Erneuerung der Volksbildung und des Hochschulwesens in der sowjetischen Besatzungszone Die Bemühungen der reaktionären Kräfte, gegen die Einheitsfront aller Antifaschisten, den Demokratischen Block, eine Front aller Privateigentümer aufzubauen, vermochten den Kurs der Partei nicht zu verändern.“! Großen Anteil hieran hatten progressive Politiker wie Johannes Dieckmann, Wilhelmine Schirmer-Pröscher und Walter Thürmer, die auf dem Parteitag stark beachtete Reden hielten.
Gemäß dem vom Parteitag abgesteckten Kurs bekannte sich der Parteivorstand der LDPD in seinem Wahlaufruf vom 26. September und in seiner Erklärung vom 29. September 1946 zu der Aufgabe, „den Militarismus und Nationalsozialismus restlos auszurotten“. Er befürwortete „die entschädigungslose. Enteignung der Kriegsschuldigen, der Kriegsverbrecher, der aktiven Nazis und derjenigen, die sich am Kriege der Nazis auf Kosten des deutschen Volkes bereichert haben. Daß darunter die monopolistischen Großkonzerne und das Finanzkapital der Großbanken zu rechnen sind, bedarf keiner besonderen Betonung.! Zugleich trat die LDPD prononciert für die Erhaltung des Privateigentums ein und lehnte mit deutlicher, wenngleich unausgesprochener antisozialistischer Akzentuierung „die Vergesellschaftung aller Produktionsmittel“ ab.
Hier setzten die reaktionären Kräfte — die verbal den Festlegungen des 1. Parteitages zustimmten — mit dem Ziel an, im Ergebnis der Wahlen die Blockzusammenarbeit aufzukündigen und die LDPD unter dem Tarnschild einer bürgerlichen „Volkspartei“ in eine Unternehmerpartei zu verwandeln. Doch sie konnten sich in den Landesbzw. Provinzialund den Kreisvorständen während des Wahlkampfes nicht entscheidend durchsetzen.
Erster Parteitag der LDPD in Erfurt, 6. bis 8. Juli 1946. Delegierte vor dem Tagungsgebäude
Der 1. Parteitag der CDU, der vom 15. bis 17. Juni 1946 in Berlin abgehalten wurde, stand unter dem Leitwort „Sozialismus aus christlicher Verantwortung“, an dem das Referat des Parteivorsitzenden, Jakob Kaiser, ausgerichtet war. Dem Anschein und dem Verständnis der Mehrheit der Delegierten und Mitglieder der CDU nach entwickelte dieser ein Konzept, das sich weit stärker an den Interessen werktätiger Schichten orientierte als das der LDPD und nicht nur antimonopolistisch, sondern sogar antikapitalistisch akzentuiert war. Die von der Führungsspitze der CDU bei der Vorbereitung des Volksentscheids praktizierte Torpedierungstaktik tendierte jedoch in eine andere Richtung, warf die Frage nach der Ernsthaftigkeit dieses Konzepts und seiner politischen Praktizierbarkeit auf. Deshalb opponierten auch die Exponenten bzw. Interessenvertreter des Monopolkapitals in den Führungsgremien der CDU nicht offen dagegen. Sie begrüßten, daß Kaiser seinem Konzept eines „dritten Weges“ zwischen Kapitalismus und marxistischem Sozialismus, zwischen „Ost und West“ eine eindeutig gegen die SED zielende Stoßrichtung gab und vor allem, daß er mit der Losung „Christentum oder Marxismus“ einen gefährlichen, die Blockpolitik untergrabenden Weltanschauungskampf zu entfesseln trachtete.
Konzepte eines „dritten Weges“ zwischen Monopolkapitalismus und Sozialismus, die auf einen Kapitalismus ohne Monopole und einen bürgerlich-sozialen Rechtsstaat hinausliefen, fungierten in der CDU und der LDPD als Bindeglieder zwischen den in der Mehrzahl werktätigen Mitgliedern, in deren Verständnis sie eine eindeutig antiimperialistische Ausrichtung hatten, den bürgerlich-demokratischen Kräften und den mehr Konservativen, denen die antifaschistisch-demokratische Umwälzung schon zu weit gegangen oder zu gehen im Begriff war. An diesem Punkt setzten wiederum die reaktionären, konterrevolutionären Kräfte mit dem Ziel an, die antifaschistisch-demokratischen Errungenschaften rückgängig zu machen und die Länder und Provinzen der Ostzone in den westzonalen Prozeß restaurativer Neuordnung „einzubringen“.
Beiden bürgerlich-demokratischen Parteien standen somit noch schwierige Entwicklungs-, Auseinandersetzungs- und Klärungsprozesse bevor. Wesentlich war, daß sie sich vor den Wählern als Parteien profilierten, die die antifaschistisch-demokratischen Umgestaltungen mittrugen und mitverantworteten. Diese Position unterschied sie bereits sehr weitgehend von den christlich-demokratischen bzw. den liberal-demokratischen Parteien in den Westzonen.
Bei den Wahlvorbereitungen gingen von Jakob Kaisers weltanschaulich akzentuiertem Konfrontationskurs die größten Gefährdungen für die Blockpolitik aus. Die SED setzte sich daher im Wahlkampf im besonderen Maße mit der Losung „Christentum oder Marxismus“ auseinander. In einer vom Zentralsekretariat am 27. August 1946 dazu veröffentlichten Stellungnahme verwies die SED darauf, daß sich der Sozialismus schon immer dazu bekannt habe, daß der Glaube „eine persönliche Angelegenheit des einzelnen Menschen“ sei.‘!° Abschließend stellte sie in dieser Stellungnahme klar: „Nicht von uns droht dem Christentum Gefahr, wohl aber von jenen Kreisen, die es jetzt wieder in den politischen Tagesstreit zerren wollen. Es geht also nicht um eine Kampffrage: Christentum oder Marxismus, sondern um die gemeinsame Verantwortung (von Christen und Marxisten — d. V.) gegenüber der Zukunft Deutschlands.“ 17
Ausgelöst durch die Rede von US-Außenminister Byrnes am 6. September 1946 in Stuttgart, in der dieser die deutsch-polnische Grenze an Oder und Neiße in Frage stellte, kam es in den Westzonen verstärkt zu nationalistisch motivierten Angriffen gegen die OderNeiße-Grenze, die auch auf das Wahlgeschehen in der Ostzone nicht ohne Einfluß blieben. Die SED stellte sich solchen Umtrieben verantwortungsbewußt und überlegt entgegen. In seinem Beschluß „Die SED zur Grenzfrage“ vom 19. September 1946 wies der Parteivorstand nach, daß der „Versuch bestimmter reaktionärer Kreise, die Frage der Ostgrenze zur Entfachung einer neuen nationalistisch-chauvinistischen Hetze auszunützen, dem deutschen Volke bei der Gestaltung des Friedensvertrages und auch in bezug auf die künftigen deutschen Grenzen nur schweren Schaden zufügen kann“.1!8
Die Wahlvorbereitungen in den Ländern und Provinzen der Ostzone waren außerordentlich umfangreich und intensiv und drückten dem Öffentlichen Leben für Wochen und Monate deutlich ihren Stempel auf. Sie zeichneten sich vor allem dadurch aus, daß die Grundfragen von Faschismusund Militarismusbewältigung und demokratischem Aufbau im Mittelpunkt standen, daß ihnen sachliche Auseinandersetzungen um substanzielle Probleme und nicht die politische Stimmungsmache das Gepräge gaben.
Die Wahlen zu den Volksvertretungen in den Gemeinden, Kreisen, Ländern und Provinzen der Ostzone und in Berlin
Das Ergebnis der Gemeindewahlen, die am 1.September im Land Sachsen, am 8. September in der Provinz Sachsen und im Land Thüringen und am 15. September 1946 in der Provinz Mark Brandenburg und in Mecklenburg-Vorpommern mit einer Wahlbeteiligung von durchschnittlich etwa 90 Prozent der Stimmberechtigten stattfanden, zeigte, daß die Mehrheit der Bevölkerung die Politik des antifaschistisch-demokratischen Blocks unterstützte.
Die Arbeiterpartei ging aus den Wahlen als wählerstärkste Partei hervor. Sie gewann von den etwa 9 Millionen gültigen Stimmen über 5 Millionen bzw. 57,1 Prozent. Von besonderer Bedeutung war, daß es der SED gelang, auch in den ländlichen Territorien einen hohen Stimmenanteil zu erreichen. Die Mehrheit der Neubauern und der landarmen Bauern, die durch die Bodenreform Land, Arbeit und Brot erhalten hatten, stimmten für die SED. Die bürgerlichdemokratischen Parteien hatten vielfach noch keine eigenen Kandidaten für die Gemeindevertretungen aufstellen können, da sie im Gegensatz zur SED in vielen kleineren Gemeinden noch keine festen Parteiorganisationen besaßen. Zu Buche für die SED schlug auch, daß sie Vertretern des FDGB und der FDJ, die zumeist noch nicht mit eigenen Listen an der Wahl teilnehmen durften, auf ihren Listen Plätze einräumte und so deren Mitwirkung ermöglichte.
Der Ausgang der Gemeindewahlen bestärkte die SED, ihren Kurs auch in bezug auf die Kreistagsund die Landtagswahlen fortzusetzen. Am 7. Oktober 1946 veröffentlichte die SED ihren Aufruf zu den Kreistagsund den Landtagswahlen. Darin wandte sie sich verstärkt gesamtgesellschaftlichen und nationalen Aufgaben zu. Erneut die zunehmenden separatistischen und förderalistischen Vorstöße in den Westzonen verurteilend, erklärte sich die SED als „die Partei des Kampfes um die ungeteilte Einheit Deutschlands“. Sie forderte „einen gesamtdeutschen Volksentscheid über die zukünftige staatsrechtliche Gestaltung Deutschlands“ und „die rasche Bildung deutscher Zentralverwaltungen als ersten Schritt zu einer deutschen Staatsregierung“.!!? In diesem Zusammenhang verwies sie auf den Entwurf für das Dokument „Die Grundrechte des deutschen Volkes“ 120, das sie am 19. September 1946 der Öffentlichkeit zur Diskussion unterbreitet hatte.
Die Wahlen zu den Kreistagen und zu den Landtagen am 20. Oktober 1946 brachten ebenfalls ein eindeutiges Votum für die Blockpolitik und die antifaschistisch-demokratischen Umgestaltungen. Die Arbeiterpartei erhielt 50,3 Prozent aller Stimmen bei den Kreistagsund 47,5 Prozent bei den Landtagswahlen. Von den 6045 Volksvertretern in den Kreisen waren
Gemeindewahlen in der Ostzone im September 1946. Vor einem Potsdamer Wahllokal
3.124 (51,7 Prozent) Mitglieder der SED. 24,7 Prozent gehörten der CDU und 17,4 Prozent der LDPD an.
Wenn die SED bei den Kreistagsund den Landtagswahlen auch ihr Wahlziel nicht ganz erreichte und in allen Ländern und Provinzen knapp unter der absoluten Mehrheit blieb, so stellte doch dieses Ergebnis einen großen Erfolg dar. Es festigte ihre Position als stärkste und maßgebende Kraft in Politik und Verwaltung. Die bürgerlich-demokratischen Parteien erzielten mehr Wählerstimmen als bei den Gemeindewahlen und errangen teilweise zusammen die Mehrheit, wie zum Beispiel in den Stadtkreisen Chemnitz und Leipzig oder in 5 von 23 Kreisen Thüringens. Bei den Landtagswahlen erhielten CDU und LDPD in den Provinzen Mark Brandenburg und Sachsen mehr Stimmen als die Arbeiterpartei.
Ein wichtiges Ergebnis der Wahlen war, daß progressive liberal-demokratische und christlich-demokratische Funktionäre ihre Positionen in den Vorständen und Leitungen ihrer Parteien auf Kreisund Landesbzw. Provinzebene festigten. Viele von ihnen begannen gerade in den Wahlkämpfen zu erkennen, daß es zur Koalitionspolitik der Weimarer Republik kein Zurück mehr geben durfte. Insgesamt bestand die Blockpolitik eine weitere Bewährungsprobe und wurde gefestigt. Etwa 85 Prozent der Wahlberechtigten, die bei den Kreistagsund den Landtagswahlen für die Kandidaten der drei Parteien und der Massenorganisationen ihre Stimme abgaben, hatten sich damit für ein Deutschland ohne Monopolkapitalisten und Großgrundbesitzer ausgesprochen, hatten für eine geschichtliche Wende votiert.
Die Wahlen zu den Berliner Bezirksverordnetenversammlungen und zur Stadtverordnetenversammlung von Groß-Berlin im Oktober 1946 verliefen gegenüber denen in der Ostzone nicht nur komplizierter, sondern führten auch zu grundsätzlich anderen Ergebnissen mit verhängnisvollen Folgen. Nach dem Einzug der Westmächte in ihre Sektoren und im Ergebnis der dort betriebenen restriktiven Politik waren die in Berlin begonnenen antifaschistisch-demokratischen Umgestaltungen steckenbzw. hinter denen in den Ländern und Provinzen der Ostzone weit zurückgeblieben. Die Betriebe von Naziund Kriegsverbrechern, darunter solche Monopolbetriebe wie AEG, Siemens und Telefunken, waren noch nicht enteignet worden; das Unternehmertum hatte seine Positionen in den Westsektoren festigen und ausbauen können. Besonders gravierend wirkte es sich aus, daß der von der einheitsfeindlichen Fraktion innerhalb der SPD-Organisation gebildete Berliner Bezirksverband der SPD eine antikommunistische Kampagne gegen die SED und den ersten demokratischen Magistrat entfesselt hatte. Außerhalb jeder Verantwortung schob er ihnen die Schuld an allen Schwierigkeiten und Problemen zu und machte selber weitgehende und — wie sich später herausstellte — nicht einzulösende Versprechungen in bezug auf eine Verbesserung von Ernährung und Versorgung der Berliner Bevölkerung. Auf ideologischem Gebiet rückte er die Totalitarismusdoktrin in den Mittelpunkt seiner Wahlpropaganda. So hieß es im Wahlaufruf der SPD an die Berliner Bevölkerung im August 1946: „Am 20. Oktober muß sich der Berliner entscheiden, ob er, wie im vergangenen Jahr und in den letzten zwölf Jahren, weiter diktatorisch regiert werden will oder mit der Sozialdemokratie eine neue Zukunft auf dem Boden der Demokratie und des Sozialismus wünscht.“!?* Diese Gleichsetzung der SED und des demokratischen Magistrats mit den faschistischen Machthabern war infam, blieb aber offensichtlich nicht ohne Wirkung. Nach den Jahren des Faschismus konnte keine Unterstellung einer Partei oder einer politischen Kraft so sehr schaden wie die des angeblichen Strebens nach „Diktatur“.
Die Wahlen brachten der SPD 48,7, der CDU 22,2 und der LDPD 9,3 Prozent der Stimmen. Die SED erhielt 19,8 Prozent (im Ostsektor 29,9, in den Westsektoren 13,7 Prozent) der Stimmen.
Obwohl der Magistrat von allen vier in der Stadtverordnetenversammlung vertretenen Parteien gebildet wurde, formierten sich SPD, CDU und LDPD zu einer antikommunistischen, gegen die SED gerichteten, den Block auseinanderbrechenden Front.
Ergebnisse der Volksund Berufszählung im Herbst 1946
Am 29. Oktober fand die vom Alliierten Kontrollrat für alle Besatzungszonen angeordnete Volksund Berufszählung in Deutschland statt.!?° Sie vermittelte die erste umfassende Übersicht über die seit 1939 eingetretenen Veränderungen im Bevölkerungsstand. Wenn auch die durch den faschistischen Aggressionskrieg verursachte Bevölkerungsbewegung zu diesem Zeitpunkt zwar stark abgeschwächt, aber doch noch nicht zum Stillstand gekommen war, so ließ diese statistische Erhebung doch die Grundkonturen der Bevölkerungsstruktur in den Ländern und Provinzen sowie in Groß-Berlin erkennen.
Für die Ostzone ergaben sich folgende Fakten: Am Stichtag der Volksund Berufszählung lebten in ihren fünf Ländern bzw. Provinzen 17313 734 Personen, da von 57,4 Prozent weiblichen und 42,6 Prozent männli chen Geschlechts. Von dieser Gesamtbevölkerung der Ostzone waren 133 327 bzw. 0,8 Prozent in Umsiedler-, Durchgangsund Kriegsgefangenenlagern unter gebracht. Diese — verglichen mit der in der Folgezeit — niedrig liegende Zahl erklärte sich daraus, daß es weitgehend gelungen war, die erste Welle der Umsiedler in den noch vorhandenen Wohnraum einzuweisen. Das war später nicht mehr in gleichem Maße möglich.
Das Land und die Provinz Sachsen hatten mit 32,1 Prozent bzw. 24,0 Prozent den größten Anteil an der Wohnbevölkerung der Ostzone. Der Anteil von Mark Brandenburg, Thüringen und Mecklenburg-Vorpommern lag zwischen 16,9 Prozent und 12,4 Prozent. Das Land Sachsen war mit 327,1 Einwohnern pro Quadratkilometer am dichtesten besiedelt. Der unterschiedliche Besiedelungsgrad war die Ursache dafür, daß die in den letzten Kriegsjahren Evakuierten und später dann die Umgesiedelten vornehmlich nach Mecklenburg-Vorpommern, der Provinz Sachsen und Thüringen gelenkt wurden. Das führte zu einer Zunahme der Einwohnerzahl pro Quadratkilometer im
Vergleich zu 1939 in Mecklenburg-Vorpommern um 34,4 Prozent, in der Provinz Sachsen um 77,1 Prozent und in Thüringen um 21,3 Prozent. In Mark Brandenburg und im Land Sachsen erhöhte sich die Zahl der Einwohner lediglich um 4,3 bzw. 1,5 Prozent.
Von der am Stichtag erfaßten Bevölkerung der Ostzone hatten 75,6 Prozent schon vor dem 1. September 1939 in diesem Gebiet, 3,3 Prozent in Berlin und im Gebiet der späteren Westzonen gelebt. 13,1 Prozent der Bevölkerung waren im ersten Kriegsjahr in den östlich der Oder-Neiße-Grenze liegenden Gebieten des Deutschen Reiches beheimatet gewesen. In der Tschechoslowakei hatten am 1. September 1939 4,8 Prozent und in Polen 1,4 Prozent der Bevölkerung der Ostzone gelebt. 0,4 Prozent stammten aus dem Freistaat Danzig. Ein geringer Prozentsatz hatte 1939 in der UdSSR, in baltischen Staaten, in Rumänien und in anderen Staaten gewohnt.
Im Gefolge des faschistischen Krieges waren wesentliche Veränderungen im Altersaufbau der Bevölkerung zu verzeichnen. Der Anteil älterer und jüngerer Menschen war stark angewachsen. Lag der Anteil der Altersgruppen von 40 bis 65 Jahren und von 65 und mehr Jahren 1939 bei 28,9 bzw. 8,6 Prozent, so belief er sich 1946 auf 33,4 bzw. 10,0 Prozent. Der Anteil der Jugendlichen unter 18 Jahren lag wesentlich höher als 1939. Das galt vornehmlich für die Sechs- bis Zehnjährigen. Diese Altersgruppe wies um über 715 Prozent mehr Zugehörige auf als im ersten Kriegsjahr. Die produktivste Altersgruppe, die der 18bis 40jährigen, die 1939 18,3 Prozent der Bevölkerung ausgemacht hatte, stellte 1946 nur noch 9,1 Prozent der Bevölkerung. Viele Männer dieser Altersgruppe waren auf den Schlachtfeldern des faschistischen Krieges gefallen oder befanden sich noch in Kriegsgefangenschaft.
Die Volkszählung wies aus, daß in der Ostzone — von einer Reihe kleinerer Religionsgemeinschaften abgesehen — 81,6 Prozent der Bevölkerung evangelisch, 12,2 Prozent römisch-katholisch und 5,5 Prozent konfessionslos waren. 2094 Menschen waren jüdischen Glaubens.
Von der Bevölkerung der Ostzone — ausgenommen jener Teil, der noch in Lagern lebte — waren 47,4 Prozent erwerbstätig, 13,0 Prozent Selbständige ohne Beruf, das heißt Personen, die ein Einkommen bezogen, ohne berufstätig zu sein, und 26,6 Prozent Familienangehörige, die keinen Beruf ausübten. 13 Prozent der Bevölkerung standen nicht im erwerbsfähigen Alter. Den höchsten Prozentsatz an Erwerbstätigen verzeichneten das Land Sachsen und Mark Brandenburg mit 49,1 bzw. 48,7 Prozent. Die wenigsten Erwerbstätigen wiesen Mecklenburg-Vorpommern und die Provinz Sachsen mit 45,1 bzw. 45,5 Prozent auf.
Die Volkszählung vermittelte ein Bild von der soziologischen Grundstruktur der Bevölkerung in der Ostzone. Mit 54,2 Prozent Arbeitern und einem großen Teil der 17,1 Prozent Angestellten bildete die Arbeiterklasse die soziale Hauptgruppe der Bevölkerung. Von den Arbeitern waren 58 Prozent in der Industrie und im Handwerk, 21,4 Prozent in der Landund Forstwirtschaft, 9,6 Prozent im Handel und im Verkehrswesen, 6,2 Prozent im Öffentlichen Dienst und in der privaten Dienstleistung beschäftigt. Die restlichen 4,8 Prozent arbeiteten in Haushalten.
Die Selbständigen machten 15,5 Prozent und die mithelfenden Familienmitglieder 12,8 Prozent der Gesamtbevölkerung aus, davon waren 44,4 Prozent in der Landund, Forstwirtschaft tätig, 31,1 Prozent unterhielten einen Handwerksoder Industriebetrieb, 17,9 Prozent ein Handelsoder Fuhrgeschäft und 6,6 Prozent ein Geschäft im Bereich der häuslichen Dienstleistung. Zu den Selbständigen zählten sowohl die Angehörigen der sozialen Gruppe der einfachen Warenproduzenten als auch die kleinen und mittleren Industrieund Handelskapitalisten sowie die Großbauern.
Entsprechend der volkswirtschaftlichen Grundstruktur der Ostzone waren 42 Prozent der Erwerbstätigen in der Industrie und im Handwerk, 29,2 Prozent in der Landund der Forstwirtschaft, 14,6 Prozent im Handel und im Verkehrswesen, 11,2 Prozent im öffentlichen Dienst sowie in der privaten Dienstleistung und 3 Prozent im häuslichen Dienst beschäftigt.
Von besonderer Wichtigkeit für die Wirtschaftsentwicklung in der Ostzone war die mit der Erhebung vom 29. Oktober 1946 gewonnene Übersicht über die berufliche Struktur der Erwerbstätigen. Den Angaben zufolge, die die Befragten machten, hatten 35,2 Prozent einen Beruf, der sich mit der Stofferzeugung und -verarbeitung befaßte, 29,1 Prozent einen landwirtschaftlichen oder gärtnerischen Beruf, 12,7 Prozent Berufe der Güterverteilung oder des Verkehrswesens, 6,6 Prozent Berufe der Haushalts-, Gesundheitsund Volksfürsorge, 6,5 Prozent solche der Verwaltung und des Rechtswesens, 2,2 Prozent des Geistesbzw. des Kunstlebens und 1,8 Prozent der Technik. 5,9 Prozent der Befragten konnten keinen bestimmten Beruf angeben. Unter den Verhältnissen des Jahres 1946 war der erlernte Beruf oft nicht mit dem ausgeübten identisch.
Das traf auf Arbeiter und Angestellte, die in den demokratischen Verwaltungen ihre Tätigkeit aufgenommen hatten, ebenso zu wie auf Personen, die aus sehr unterschiedlichen Gründen ihren Beruf nicht ausüben konnten. Viele ehemalige NSDAP-Mitglieder standen nicht mehr in ihrem Beruf.
Die Struktur der Berufstätigen mit ausgesprochen industriellen und handwerklichen Berufen — ausgenommen die Bauberufe — war von den Metall- und Textilberufen geprägt. Diese wurden von 25,2 bzw. 26,2 Prozent der Angehörigen dieser Berufsgruppe ausgeübt. Einen noch größeren Anteil hatten die holzbarbeitenden Berufe mit 10,1 Prozent und die Berufe des Nahrungsund Genußmittelgewerbes mit 9,3 Prozent. Der Anteil anderer Berufe lag zwischen 5,2 Prozent bei denen der Lederverarbeitung und 1,4 Prozent bei den Berufen im Bergbau. Diese berufliche Struktur der in der Industrie und im Handwerk Tätigen bot insgesamt gute Voraussetzungen für den wirtschaftlichen Neuaufbau in der Ostzone.
Umsiedler und Kriegsgefangene
Zu den spezifischen Nachkriegsproblemen, deren Lösung hohe politische, organisatorische und menschliche Qualitäten erforderte, zählten die Integration der Umsiedler und die Wiedereingliederung der heimkehrenden Kriegsgefangenen.
Umsiedler werden vom Güterbahnhof Berlin-Pankow aus mit der Eisenbahn weiterbefördert, 1946
Die ersten Umsiedler aus den Gebieten östlich der Oder-Neiße-Grenze sowie aus der Tschechoslowakei
waren schon im August 1945 in der sowjetischen Besatzungszone eingetroffen. Ende 1945 sollen sich hier zwischen 5 Millionen und 6 Millionen umherwandernde Menschen aufgehalten haben, wozu beitrug, daß die westlichen Besatzungsmächte zeitweilig ihre Zonengrenzen für Umsiedler gesperrt hatten. Eine große Zahl der über 10 Millionen deutschen Kriegsgefangenen war von den Alliierten relativ bald nach Kriegsende entlassen worden. Millionen Heimkehrende und Heimatlose befanden sich somit im 2. Halbjahr 1945 auf Wanderschaft, bevölkerten die Straßen, Bahnhöfe und Eisenbahnzüge. Sie mußten ernährt sowie medizinisch und sanitär betreut werden, bedurften nächtlicher Unterkünfte und brauchten schließlich alle eine ständige Wohnung und Arbeit.
In der ersten Zeit war eine wohlüberlegte Lenkung der Umsiedlertransporte nicht gewährleistet. In der Hoffnung auf baldige Rückkehr in ihre alte Heimat Heimkehrer auf dem Leipziger Hauptbahnhof, 1947 steuerten viele Umsiedler aus eigenem Antrieb neben Berlin vor allem die östlichen Gebiete Mecklenburg-Vorpommerns, Mark Brandenburgs und des Landes Sachsen als Aufenthaltsorte an. Obwohl die Ausgesiedelten mit Plakaten dazu aufgefordert wurden, das überfüllte und lebensmittelarme Berlin zu meiden, hatte die Hauptstadt im August und September 1945 durchschnittlich 17000 durchreisende Personen pro Tag zu beherbergen und zu beköstigen. Der Richtsatz für die Verpflegung betrug 100 Gramm Brot, 1 Dreiviertelliter Suppe und ein warmes Getränk. Das war nicht viel, mußte aber erst einmal aufgebracht werden.
Die Seuchengefahr wuchs. Waren zu Beginn der Umsiedlungen 20 Prozent der Umsiedler verlaust, so erhöhte sich dieser Anteil später auf 50 Prozent. Fleckfiebererkrankungen traten auf, Ruhrund Ty phusfälle häuften sich. Geschlechtskrankheiten gras sierten in besorgniserregender Weise. Die körperliche Schwäche von Kindern und alten Menschen machte besondere soziale und medizinische Maßnahmen nötig.
Der Zustand der ersten Heimkehrer erwies sich oft als katastrophal. Sie waren physisch und psychisch er schöpft. Ihre abgerissenen Sachen und ihre oft völlig unzureichende Fußbekleidung machten Abhilfe drin gend erforderlich. Sie brauchten finanzielle Unterstützung. Vor allem die heimatlosen Heimkehrer ohne Angehörige befanden sich in der gleichen bedrücken den Lage wie die Ausgesiedelten.: Kriegsversehrte be durften der Hilfe. Das Gesundheits-und Sozialwesen war durch diesen Ansturm von Krankheit und Elend in seinen Möglichkeiten zunächst völlig überfordert. Um die schwierige Aufgabe der Umsiedlung besser zu meistern, wurde im September 1945 die Zentralver waltung für deutsche Umsiedler unter dem Präsiden ten Rudolf Engel geschaffen, die in erster Linie für die zügige Seßhaftmachung der Ausgesiedelten zu sorgen hatte. Später gehörten zu ihren Aufgaben auch die Rückführung der Kriegsgefangenen und die Arbeit des zentralen Suchdienstes zur Zusammenführung von Familieangehörigen, die durch Krieg und Umsiedlung getrennt worden waren. Die Zentralverwaltung rief bereits im Oktober 1945 zur Gründung von Umsiedlerausschüssen auf, in denen Umsiedler und Einheimische gemeinsam für eine Verbesserung der Lage arbeiten sollten.
Dem selbstlosen Einsatz zahlreicher Ärzte, Schwe stern und anderen Pflegepersonals war es zu danken, daß Seuchen und Infektionskrankheiten, die eine akute Bedrohung der physischen Existenz großer Teile der Bevölkerung darstellten, trotz der zu geringen Zahl von Medizinern und trotz eines bis zur Unkennt lichkeit zerstörten Krankenhauswesens relativ bald be herrscht wurden. Notkrankenhäuser und Sanitätsstel len entstanden, erste Impfaktionen vor allem gegen Typhus wurden durchgeführt und insgesamt das Ge sundheitswesen mit großer Unterstützung von seiten der SMAD, die beispielsweise Impfstoffe zur Verfü gung stellte, reorganisiert.
Das Gros der in die sowjetische Besatzungszone Umgesiedelten traf bereits Ende 1945 hier ein. Von den insgesamt 4312 700 aufgenommenen Umsiedlern befanden sich bis Ende Dezember 1945 schon 53 Prozent in den einzelnen Ländern und Provinzen.!?‘ Bis Oktober 1946 erhöhte sich die Zahl der Aufgenommenen auf 3.642.007.
Noch nicht einmal die Hälfte der Umsiedler konnte als arbeitsfähig eingestuft werden. Von den aus Polen eintreffenden Neubürgern kam ein erheblicher Pro zentsatz aus ländlichen Berufen. Aus Gründen der Unterbringung und wegen der großen Nahrungssorgen arbeiteten ein Großteil — 43,8 Prozent der erwerbs tätigen Umsiedler in der Landwirtschaft und nur 19,5 Prozent in der Industrie. In den jeweiligen Auf nahmegebieten mußte ein Teil der Facharbeiter oft erst einmal berufsfremd in Arbeit gebracht werden. Nur durch komplizierte Umverteilungsaktionen von Land zu Land konnten massenhafte berufliche Fehleinweisungen korrigiert und Umsiedler entspre chend ihren Arbeitsfertigkeiten und -fähigkeiten an sässig gemacht und eingesetzt werden.
Als günstig für eine relativ zügige Integration der Umsiedler erwies es sich, daß diese in eine dynamische Phase antifaschistisch-demokratischer Umwälzungen hineingerieten, die mit tiefgreifenden sozialen Um-und Neuschichtungen verbunden waren. Dadurch konnten viele Ausgesiedelte bald einen geachteten Platz in der neuen Gesellschaft finden. Immerhin gingen 43 Prozent der Neubauernstellen an Umsiedler und wurde dadurch die Existenz von insgesamt 350.000 Menschen gesichert. Andere Umsiedler nutzten die Möglichkeit, als Neulehrer zu arbeiten oder in antifaschistischen Verwaltungen und Organisationen tätig zu werden. Hier fanden insbesondere die ca. 43.000 freiwilligen antifaschistischen Umsiedler aus der Tschechoslowakei Betätigungsfelder und Einsatzmöglichkeiten. Umsiedler arbeiteten als Kreis-, Stadtund Gemeinderäte, wurden in Volksvertretungen gewählt und wirkten auch als Bürgermeister ihrer neuen Heimatorte. Im Land Mecklenburg-Vorpommern stellten sie 741 Bürgermeister und 69 Kreisräte, im Land Sachsen 135 Bürgermeister und 29 Kreisräte.
Durch die Gründung von Umsiedlergenossenschaften, die unter anderem Glaswaren, Holzpantoffeln, Strohschuhe und andere Bedarfsgüter produzierten, sowie durch die Bereitstellung von Heimarbeit wurden Arbeitsplätze geschaffen. Dennoch hatten alle Umgesiedelten schwierige Daseinsprobleme zu lösen. Sie mußten nicht nur mit dem Verlust ihrer Heimat fertigwerden, sondern sahen sich auch mit der Tatsache konfrontiert, daß es mehr als großer Anstrengungen bedurfte, sie in ihrer neuen Lebenswelt mit Wohnraum, Hausrat und anderen Voraussetzungen der menschlichen Existenz zu versorgen. Den Neubauern fehlten oft die nötigen bäuerlichen Arbeitsgeräte und vor allem Vieh und Saatgut. Bei entsprechenden von den Umsiedlerämtern vorgenommenen Befragungen erklärten viele Umsiedler, daß sie am meisten unter der Wohnungsnot und unter Verständnislosigkeit von seiten der Altbevölkerung litten.
Der Krieg hatte zu einer Verminderung des be wohnbaren Wohnraumes geführt. Nach Überschlags rechnungen fehlten 1946 1,3 Millionen Wohnungen. Dabei ist jedoch zu berücksichtigen, daß zu diesem Zeitpunkt auch Räume als Wohnungen galten, die früher aus sozialen und kulturellen Gründen nicht zum Wohnraum zählten, darunter unbeheizbare und schlecht belichtete Zimmer. Standen zunächst im Durchschnitt 10 Quadratmeter Wohnfläche pro Ein wohner zur Verfügung, so waren es bald nur noch 9 bis 7 Quadratmeter. Da jedoch vor allem die Einhei mischen in Zimmern von 10 bis 12 Quadratmetern und mehr lebten, blieben für Umsiedler und Ausge bombte oft nur 4 Quadratmeter und weniger. Beson ders hart war das Leben und Überleben in den zer bombten Großstädten. Hier fehlten nicht nur eine besonders große Zahl von Wohnungen, sondern gab es oft auch beträchtliche Schäden an den Kanalisations anlagen und anderen für städtische Siedlungen uner läßlichen Einrichtungen. So konnte eine noch nicht intakte Müllabfuhr ebenso zum sanitären Problem werden wie eine noch nicht wieder funktionierende Wasserleitung.
Wohnen in Ruinen, 1946
Die Einwohnerzahlen der Großstädte sanken daher nach dem Krieg, zumal Wohnen in Kleinund Mittel städten oder auf dem Dorf günstigere Ernährungsaus sichten versprach. Angenehmer und reichhaltiger wa ren jedoch die Wohnmöglichkeiten hier meist auch nicht. Vor allem in Mecklenburg-Vorpommern mit seiner zurückgebliebenen Wohnkultur war die Lage zunächst mehr als trostlos. 1946/47 kamen hier auf 100 Einwohner durchschnittlich 93,7 Umsiedler. Sie wurden bei Altund bei Neubauern, in geeigneten Gutshäusern und Schlössern, in Pensionen und Kur häusern an der Ostsee, in geschlossenen Gaststätten und Friseurläden, ja sogar in Waschküchen unterge bracht. Ähnlich wurde auch in den anderen Ländern und Provinzen verfahren.
Nach ihrer Ankunft mußten alle Umsiedler und Heimkehrer zunächst Desinfektionsund Entlau sungsanstalten durchlaufen und eine gewisse Zeit in Durchgangsund Quarantänelagern verbringen. Be sonders bekannt geworden ist das 1946 eröffnete Heimkehrerlager Gronenfelde bei Frankfurt an der Oder.
Bei all dem ging das Bestreben der antifaschistisch demokratischen Verwaltungen immer dahin, Umsied lern möglichst bald eine Dauerwohnung zu verschaf fen. Das hieß allerdings in den meisten Fällen, sie als Teilmieter in eine bereits bewohnte Wohnung einzu weisen. Oft genug waren Wohnungszuweisungen aber nur mit polizeilicher Gewalt durchzusetzen, und ent sprechend schwierig gestaltete sich dann das Mitein anderwohnen, zumal die Neubürger auf vielerlei Hilfe angewiesen waren. Am 15. Oktober 1946 erließ die SMAD den Befehl Nr. 304, der einmalige finanzielle Hilfen für bedürftige Umsiedler vorsah. Sie betrugen für Erwachsene 300 Mark und für Kinder 100 Mark. Ab November 1946 erhielten insgesamt 2 Millionen Umsiedler 403 Millionen Mark zur Verfügung gestellt. Die Mehrzahl der Umsiedler arbeitete zäh an der Wiederherstellung ihrer Existenz. Ihre mit Hilfe anti faschistischer Verwaltungen vollzogene Eingliederung verhinderte, daß sie sich zu einem erneut den Frieden bedrohenden revanchistischen Potential formierten.
Die Familie hatte sich in Krieg und Nachkrieg als eine lebenswichtige Größe erwiesen. Aber in dieser engen Gemeinschaft gab es auch viele Konfliktsituationen. Die aus der Kriegsgefangenschaft heimkehren den Männer hatten sich oftmals ihren Familien ent fremdet oder konnten sich mit der neuen Selbständig keit ihrer Ehefrauen nicht abfinden. Nicht wenige suchten entstehenden Eheproblemen durch Trennung von ihrer Familie aus dem Weg zu gehen. Aber auch Frauen waren oft nicht mehr gewillt, gewonnene Frei heiten wieder aufzugeben. Eheund Kindschaftssa chen — im wesentlichen also Ehescheidungsverfah ren — beliefen sich 1946 auf 45000 und wuchsen 1947 auf 62.000 an.
Umschulung von Kriegsversehrten
Die Heimkehrer wurden von der Gesellschaft und von ihren Familien zumeist aber sehnlichst erwartet. Die Wirtschaft brauchte Facharbeiter, und vollstän dige Familien hatten es leichter, ihr Dasein zu fristen. Der Parteivorstand der SED drang daher immer wie der mit Nachdruck auf eine zügige Rückführung aller Kriegsgefangenen. Die Nachkriegsgesellschaft unter nahm viel, um die zurückkehrenden Kriegsgefangenen zu versorgen und, sofern nötig, wieder zu Kräften zu bringen. So verfügte das Land Sachsen über drei Heimkehrersanatorien. Von großer Bedeutung für den Fortgang der antifaschistisch-demokratischen Umwäl zung war die Ankunft und Wiedereingliederung sol cher Heimkehrer, die sich bereits in Antifalagern und Antifaschulen der Sowjetunion intensiv mit dem Fa schismus auseinandergesetzt hatten und zu antifaschi stisch-demokratischen Standpunkten, aber auch zu neuem Arbeitsverhalten gelangt waren. Einige von ihnen kamen sogar mit Aktivistenauszeichnungen zu rück.
Die wirtschaftlichen Ergebnisse des Jahres 1946
Bei der Normalisierung des wirtschaftlichen Lebens gelang es im Laufe des Jahres 1946, einen beachtli chen Schritt voranzukommen. Die Industrie erzeugte 42 Prozent der industriellen Bruttoproduktion des Jah res 1936. Zu diesem guten Ergebnis gegenüber 1945 trugen unter den gegebenen Umständen vornehmlich die Grundstoffund die Konsumgüterindustrie bei. Das Handwerk vermochte sogar 80 Prozent der Um satzhöhe von 1936 zu erreichen. Dabei war allerdings in Rechnung zu stellen, daß Industrie und Handwerk 1946 noch auf die von der faschistischen Kriegswirt schaft angelegten Vorräte an Rohstoffen zurückgreifen konnten. Die Landwirtschaft erreichte 50 Prozent des Produktionsniveaus von 1936. Daran war hauptsäch lich die Pflanzenproduktion beteiligt. Die Eisenbahn transportierte 1946 55 Millionen Tonnen Güter und 692 Millionen Personen.
Zu dieser Aufwärtsbewegung in allen Wirtschaftsbereichen trug die im Verlauf des Jahres enger gewor dene und besser funktionierende Zusammenarbeit zwischen den Dienststellen der SMAD, den Parteior ganisationen der SED, den Gewerkschaften, den de mokratischen Verwaltungsorganen und den Werktäti gen entscheidend bei. Das zeigte sich vor allem seit Mitte 1946 im schrittweisen Ausbau der Wirtschafts planung und des Bewirtschaftungssystems.
Der Gegenstand der Planung wurde erweitert. Zur Produktionsplanung gesellte sich die Verteilungspla nung, die sich auf ein Bewirtschaftungssystem grün dete, das die Rohund Brennstoffe sowie wichtige in dustrielle Erzeugnisse erfaßte. Die Planung der Produktion wurde verfeinert. Wirtschaftsplan und Be wirtschaftungssytem erhielten mit dem Entstehen der landeseigenen Industrie und der SAG das sozialöko nomische Fundament.
Die bei der Aufstellung der Wirtschaftspläne erziel ten Fortschritte blieben aus sehr unterschiedlichen Gründen noch begrenzt. Zum einen ließen sich die Folgen der Demontagen für den industriellen Repro duktionsprozeß erst bestimmen, nachdem die von der SMAD für den 1. Oktober 1946 angeordnete Inventur der gesamten Industrie in der sowjetischen Besat zungszone stattgefunden hatte. Zum anderen war eine solche Erhebung auch deshalb nötig, weil die der Pro duktionsplanung zugrunde liegenden Angaben über die Kapazitäten, Vorräte und Arbeitskräfte bisher nicht zuverlässig genug waren. Die Planung wurde au Berdem auch durch die im Laufe des Jahres mehrfach veränderten Forderungen in bezug auf Umfang und materielle Struktur der Reparationsleistungen beeinträchtigt.
Nachteilig wirkte sich ferner aus, daß das Wirt schaftsleben fast ausschließlich auf die einzelnen Län der und Provinzen beschränkt blieb bzw. die her kömmlichen Produktionsbeziehungen zwischen den Betrieben innerhalb der gesamten Ostzone nur mit einem großen Aufwand wieder geknüpft werden konn ten. Das Bewirtschaftungssystem, das alle wesentli chen Industriegüter und die wichtigsten Konsumtions mittel erfaßte, war im Rahmen der Länder und Provinzen organisiert. Das schloß ein, daß sich die Länder und Provinzen in erster Linie selbst mit den in ihren Gebieten erzeugten knappen Industrieerzeugnissen versorgten und nur den von der SMAD festgeleg ten Teil an die anderen Länder und Provinzen lieferten.
Es waren aber nicht nur die Unzulänglichkeiten im Bewirtschaftungssystem, die die Wirkung der Wirt schaftsplanung beeinträchtigten. Störungen gingen auch von der Zirkulationssphäre aus, die ausschließ lich vom kapitalistischen Großhandel und vom priva ten Einzelhandel beherrscht wurde. Die Verteilung der Produktionsmittel und Konsumgüter unterlag darum in der ersten Hälfte des Jahres 1946 nur in einem sehr geringen Maße der Kontrolle durch die demokratischen Verwaltungen. Das ermöglichte den pri vatkapitalistischen Großhändlern, die Warenbewe gung weitgehend in ihrem Interesse zu lenken.
1. Leipziger Messe vom 8. bis 12. Mai 1946
Um die Zirkulationsprozesse kontrollieren zu kön nen, gründeten die Landesund Provinzialverwaltun gen halbstaatliche Großhandelsgesellschaften für den Produktionsmittelhandel und den Handel mit gewerb lichen Gebrauchsgütern. Diese Gesellschaften mit be schränkter Haftung, an denen sich die Landesund Provinzialverwaltungen sowie Handelskapitalisten und Genossenschaften beteiligten, verfügten über keine eigenen Handelseinrichtungen, sondern ließen den gesamten Warenverkehr durch private Leitund Mitarbeiterfirmen realisieren. Die erste Gesellschaft dieser Art entstand im Juli 1946 im Land Sachsen. Zur Bildung der halbstaatlichen Großhandelsgesell schaften trug auch die Notwendigkeit bei, die Lager und Transportkapazitäten, über die die einzelnen Handelsfirmen verfügten, besser zu nutzen.
Dieser Gesichtspunkt war es auch, der die Landes und Provinzialverwaltungen veranlaßte, Transportge sellschaften zu gründen. Im Kraftverkehr und in der Binnenschifffahrt organisierten sie kooperative Formen der Zusammenarbeit, die einen konzentrierten Einsatz der sehr zersplitterten Transportkapazitäten er möglichten; die zumeist privaten Fuhrunternehmer führten sie in Autotransportgemeinschaften zusam men. Durch die Transportgemeinschaften konnten der Güter- und der Personenverkehr besser auf den Vor und Nachverkehr der Eisenbahn abgestimmt werden. In der Binnenschiffahrt, deren Transportkapazität zu 90 Prozent Familienbetrieben gehörte, wurde im Frühjahr 1946 durch die DZV des Verkehrs eine Ar beitsgemeinschaft Binnenschiffahrt gebildet, die den verfügbaren Transportraum disponierte. Die Vorteile der Arbeitsgemeinschaft zeigten sich vor allem beim ° Transport von Kohle, Baustoffen und anderen Mas sengütern.
Im Ergebnis des Normalisierungsprozesses in der Wirtschaft war es 1946 in der Ostzone gelungen, 46 Prozent des Nationaleinkommens von 1936 zu er zeugen. Allerdings konnte davon nur ein geringer Teil in der sowjetischen Besatzungszone verbraucht wer den, da der auf Grund der Wiedergutmachungsver pflichtungen aus der laufenden Produktion entnom mene Anteil an Industrieerzeugnissen 1946 noch sehr hoch lag. In der materiellen Struktur der Reparations leistungen dominierten die Konsumgüter. Im Land Sachsen zum Beispiel belief sich der Anteil der Er zeugnisse der Leichtund Textilindustrie auf 46,3 Pro zent und der des Maschinenbaus auf 13,1 Prozent des Gesamtvolumens der zu eerbringenden Leistungen.
Gegen Ende des Jahres 1946 gab es erste Anzeichen für eine sich verlangsamende Entwicklung der indu striellen Produktion. Die Gründe dafür lagen in der allmählichen Erschöpfung der Rohstoffund Material vorräte, in den beginnenden Auswirkungen der Demontagen und in den zunehmenden Folgen einer durch Materialmangel bedingten unzureichenden In standhaltung des Produktionsapparates.
Anti-Hitler-Koalition und deutsches Volk am Scheideweg
Inhaltsverzeichnis [verstecken]
- 1 Anti-Hitler-Koalition und deutsches Volk am Scheideweg
- 1.1 Widersprüche in der westalliierten Besatzungspolitik und die Tendenzen restaurativer Neuordnung
- 1.2 Der beginnende Kurswechsel der britischen und der amerikanischen Deutschlandpolitik und die Pariser Konferenz des Rates der Außenminister
- 1.3 Das Urteil im Nürnberger Prozeß gegen die deutschen Hauptkriegsverbrecher
- 1.4 Der Kurs auf die Bildung der Bizone
- 1.5 Die gesellschaftlich-politische Polarisierung auf deutschem Boden im Herbst 1946
Widersprüche in der westalliierten Besatzungspolitik und die Tendenzen restaurativer Neuordnung
Die eigenständigen Konturen, die die amerikanische, die britische und die französische Besatzungspolitik jeweils aufwiesen, hoben deren weitgehend übereinstimmende bzw. angenäherte Klassenlinie keineswegs auf. Das Schwergewicht ihrer Maßnahmen zur Verwirklichung der Potsdamer Beschlüsse in dieser oder jener Form konzentrierte sich weiterhin auf die Beseitigung des Faschismus als politisches System, das Verbot faschistischer Gesetze, Publikationen und Umtriebe, die Aufdeckung faschistischer Verbrechen und die Aufklärung breiter Kreise der Bevölkerung darüber, auf Bemühungen um eine spezifische Form der Entnazifizierung und langfristigen „re-education“ der Deutschen und auf die Einführung bürgerlich-parlamentarischer Institutionen. Die Entwicklung des politischen Lebens wurde von den Militärregierungen mittels einer gezielten Zulassungs-, Kontrollund Lizenzpolitik beeinflußt. Sie förderten — unter dem Leitmotiv von „law and order“ — einen administrativen Weg vom Faschismus zur bürgerlichen Demokratie „westlichen Stils“. Eigenständige Aktionen der antifaschistisch-demokratischen Kräfte des deutschen Volkes vor allem solche, die auf die Veränderung von Machtverhältnissen und gesellschaftlichen Strukturen zielten — wurden niedergehalten.
Die im Auftrag der westalliierten Militärbehörden und unter deren Kontrolle tätigen deutschen Verwaltungen und Landesregierungen arbeiteten gemäß ihrer Kompetenz sowie von ihrer Zusammensetzung und von der Einstellung der Mehrheit ihrer Repräsentanten her nicht auf die Durchführung grundlegender antifaschistisch-demokratischer Umgestaltungen hin. Ganz im Gegenteil suchte die traditionelle Verwaltungsbürokratie solche mit allen Mitteln zu verhindern. Darüber hinaus sabotierte sie oft auch alle ihr „zu weit gehenden“ westalliierten Maßnahmen, wie solche zur Entnazifizierung bzw. zur Säuberung der Verwaltungen von ehemaligen Nazis und die auf dem Felde der Beamtenund Bildungsreform.
Im Laufe des Jahres 1946 erfolgten weitere personelle Veränderungen im Apparat der westalliierten Militärregierungen. Progressive, radikaldemokratische oder auch linksliberale Offiziere und Angestellte schieden in größerer Zahl -— zum Teil auf eigenen Wunsch aus, wurden entlassen oder auch auf andere Posten versetzt und in der Regel durch prononciert konservative Kräfte ersetzt.
Im Kontext tendenzieller Veränderungen in der Außen- und Deutschlandpolitik der USA, Großbritanniens und Frankreichs sowie innerer Spannungen bot die westalliierte Besatzungspolitik 1946 ein zunehmend widersprüchliches Bild. Die Durchführung von Maßnahmen zur Verwirklichung der Potsdamer Beschlüsse wurde von gegenläufigen Tendenzen beeinflußt und zum Teil blockiert.
Nachdem die Westalliierten bereits 1945 einen gröBeren Kreis faschistisch stark belasteter Personen interniert hatten, unternahmen die amerikanischen und die britischen Militärbehörden 1946 verstärkte Anstrengungen, um Entnazifizierungsmaßnahmen in ihren Besatzungszonen durchzuführen. Weit weniger ausgeprägt waren die entsprechenden Bemühungen der französischen Militärbehörden. Das von OMGUS initiierte Entnazifizierungsverfahren schien das rigoroseste zu sein. In Durchführung des am 5. März 1946 erlassenen „Gesetzes zur Befreiung von Nationalsozialismus und Militarismus“‘?’ mußten rund 12 Millionen Bewohner der amerikanischen Besatzungszone einen umfangreichen Fragebogen ausfüllen. Da die herrschenden Kreise der USA, ebenso wie die Großbritanniens und Frankreichs von einer kleinen Minderheit abgesehen -, immer ungenügend zwischen dem deutschen Faschismus und seinen Hintermännern auf der einen Seite und den deutschen Werktätigen auf der anderen unterschieden hatten, glaubten sie, das ganze deutsche Volk entnazifizieren zu müssen. Diese Ausweitung der Entnazifizierung — die mit einer ungenügenden Konzentration auf die Erfassung und Bestrafung von aktiven Nazis bzw. Naziund Kriegsverbrechern einherging — programmierte deren letztlichen und folgenreichen Fehlschlag vor. Das traf auch auf die in einigem andere Wege gehende britische Entnazifizierungspolitik zu.
Die Tätigkeit der deutschen für die Entnazifizierung eingesetzten Spruchkammern, deren Beschlüsse der Bestätigung durch die Militärbehörden unterlagen, geriet immer mehr unter Kritik — berechtigte und unberechtigte. „Die Kleinen henkt man, die Großen läßt man laufen“, wurde zum geflügelten Wort. Schon 1946 zeichnete sich ab, daß diese Art der Entnazifizierung den Zweck verfehlte und daß ihr kein nachhaltiger Erfolg beschieden sein würde. Sie wirkte außerdem dahingehend, das Anliegen der Entnazifizierung überhaupt ins Zwielicht zu rücken. Das wiederum begünstigte die restaurativen Kräfte, Trends und Bestrebungen.
Dem äußeren Anschein nach fand auch in den westlichen Besatzungszonen eine rigorose Entlassung von in Verwaltungen und Geschäftsleitungen tätigen Nazis und Militaristen statt. Dies geschah jedoch nicht mit dem Effekt einer wirklichen Säuberung und Demokratisierung der Verwaltungen. Der Verwaltungsapparat auf allen Ebenen und in allen Ländern der Westzonen blieb eine Domäne der traditionellen, faschistisch stark kompromittierten bzw. auch weiterhin vorwiegend zumindest konservativ profilierten Verwaltungsbürokratie. So boten die Zentralämter der britischen Zone dem Personal ehemaliger Reichsbehörden ein neues Betätigungsfeld. Oftmals fanden die wegen ihrer nazistischen Vergangenheit entfernten Beamten in anderen Ländern oder Zonen wieder Verwendung und wurden zudem von Gesinnungsgenossen ersetzt. Ehemalige Beamte aus Umsiedlerkreisen, deren Vergangenheit weniger bekannt war, standen reichlich zur Verfügung. Die Neueinstellung erwiesener Antifaschisten und Demokraten bildete eine seltene Ausnahme. Den Eingaben und Protesten der KPD, von Gewerkschaftsorganisationen und Betriebsräten gegen die Weiterbeschäftigung belasteter Nazis in verantwortlichen Positionen trugen die Militärbehörden nur selten Rechnung. Als Hauptargument zugunsten der Weiterbeschäftigung wurde immer wieder das vom unentbehrlichen Fachmann strapaziert. Das rief auch außerhalb der Arbeiterbewegung massive Kritik hervor, wie die von Erik Reger, Chefredakteur des im amerikanischen Sektor von Berlin erscheinenden „Tagesspiegel“: „Mit dem Fachmann ist in Deutschland schon immer Unfug getrieben worden, jetzt aber dient das Argument einfach der Restauration. Nicht, daß man den Nationalsozialismus wieder herstellen wollte. Natürlich nicht. Alle diese Industriellen, diese Syndici, diese Prokuristen, diese Beamten wollen die Wiederherstellung ihrer anonymen politischen Macht …?
Die Westalliierten nahmen es hin, daß in den Verwaltungen, besonders auch in der Justiz, belastete Nazis in hoher Zahl weiterbeschäftigt wurden, und sie unternahmen auch nichts gegen die weithin geübte Praxis, in den Privatunternehmen belastete leitende Angestellte und Direktoren, abgedeckt durch ein Scheinarbeitsverhältnis — beispielsweise als Pförtner —, weiterzubeschäftigen.
Die USA, Großbritannien und Frankreich hielten 1946 in ihrer Deutschlandund Besatzungspolitik offiziell noch an den Potsdamer Beschlüssen fest, die deutschen Monopolvereinigungen zu beseitigen. Hierzu setzten sie ihre Beschlagnahmemaßnahmen 1946 vor allem mit solchen in der Eisenund Stahlindustrie fort. Das Personal der Konzernleitungen und deren Geschäftstätigkeit wurden davon allerdings nur wenig tangiert, die Eigentumsverhältnisse nicht verändert, sondern lediglich eingefroren. An der Spitze der von der Militärregierung eingesetzten Treuhandverwaltung für die in der britischen Zone beschlagnahmten Stahlkonzerne stand der bisherige Direktor der Vereinigten Stahlwerke, Heinrich Dinkelbach, und mit der Leitung der beschlagnahmten Kohlenbergwerke beauftragten die britischen Militärbehörden den Konzerndirektor Heinrich Kost. Im Laufe des Jahres 1946 traten die Unterschiede zwischen den Sequestrierungsmaßnahmen der SMAD und den Beschlagnahmemaßnahmen der Westalliierten zunehmend zutage. Letztere fungierten immer eindeutiger als Schutzschild gegen antifaschistisch-demokratische Enteignungsforderungen und solche zur Veränderung gesellschaftlicher Strukturen.
Entsprechend gegensätzliche Entwicklungen von Ostzone und Westzonen gab es auch in bezug auf die Maßnahmen gegenüber dem Großgrundbesitz. In britischen Regierungskreisen waren im Herbst 1945 in Reaktion auf die demokratische Bodenreform in der Ostzone Pläne für eine Bodenreform auch in der britischen Zone erörtert worden. Das Londoner Kontrollamt hatte im November 1945 sogar den britischen Oberbefehlshaber angewiesen, den Großgrundbesitz zu beschlagnahmen, wenig später aber diese Anordnung mit dem Hinweis auf die Gefahr negativer Auswirkungen auf die Ernährungssituation widerrufen. Mit unterschiedlicher Motivation und Begründung schoben die westalliierten Militärregierungen die Entscheidung über eine Bodenreform hinaus. Dies korrespondierte mit Bestrebungen der Spitzen der bürgerlichen Parteien und der Verwaltungsbürokratie, diese zu verhindern. Wenngleich die Forderung nach einer Bodenreform — am konsequentesten von der KPD erhoben nicht verstummte: der Großgrundbesitz blieb erhalten und die Großgrundbesitzer konnten ihre wirtschaftlichen Positionen unter Ausnutzung der Arbeitskräfteund Ernährungssituation sogar stärken.
Auch die Beseitigung des kriegswirtschaftlichen Potentials durch die Westalliierten ging nur schleppend voran. Dies wiederum beeinträchtigte die Erfüllung der Reparationsansprüche der Sowjetunion. Demontagen erfolgten zunehmend mehr aus Konkurtenzals aus Sicherheitsmotiven.
Die westalliierte Reeducationpolitik, die einer Faschismusbewältigung durch längerfristige „Umerziehung“ der Deutschen dienen sollte — weg von Geist und Traditionen des „deutschen Sonderweges“, hin zu den Idealen und Leitbildern „westlicher Demokratie und Kultur“ -—, war mit Vorstellungen von einem Bruch mit der bisherigen Geschichte verbunden und stark davon geprägt, daß man 1945 einfach „bei Null“ beginnen könne. Die „Umerziehung“ sollte durch Einführung und Verbreitung „westlicher“ bildungspolitischer und geistig-kultureller Leitbilder sowie kultureller Produkte befördert werden. Einen Schwerpunkt der Reeducationpolitik bildeten Konzepte und Bestrebungen, die deutschen Schulen und Hochschulen zu reformieren und reaktionäre Traditionen zurückzudrängen. Zu Recht sah man in der Demokratisierung des Schulwesens einen wichtigen Bestandteil für Faschismusbewältigung und demokratische Entwicklung. Doch man ließ sich auch hier Zeit, begnügte sich mit Halbheiten und ging nicht entschlossen gegen die Kräfte vor, die sich einer durchgreifenden Reform von Schulen und Hochschulen entgegenstemmten.
So driftete die Schulentwicklung wieder in die Bahnen bürgerlicher Schultraditionen. Das dreigliedrige Schulsystem als Instrument zur Durchsetzung des bürgerlichen Bildungsprivilegs blieb weitgehend erhalten. In Bayern und anderen Ländern der Westzonen wurde die reaktionäre Idee der Konfessionsschule durchgesetzt und die Koedukation untersagt. Die weitgehend nur formale Demokratisierung der Bildungsinhalte wurde mit der — bereits 1946 einsetzenden – massenhaften Rückkehr suspendierter Vertreter der traditionellen Lehrerschaft, die in ihrer Mehrheit die Kontinuität reaktionären Gedankengutes verkörperten, stark eingeschränkt.und in Frage gestellt.
Im Hochschulwesen zielte die alliierte Reeducationpolitik nicht nur darauf ab, die Lehrinhalte und die Lehrkörper zu demokratisieren, sondern auch darauf, die Hochschulen aus ihrem „Elfenbeinturm“ herauszuführen und sie stärker mit dem gesellschaftlichen und politischen Leben bürgerlicher Provenienz zu verbinden. Doch auch diese relativ begrenzten Reformabsichten stießen auf den geschlossenen Widerstand des besitzund bildungsbürgerlichen Lagers, zu dessen Sprecher sich CSU und CDU, die Kirchen und die Mehrheit der Hochschullehrer machten. Das demonstrierten bereits deren erste öffentliche Auftritte anläßlich der feierlichen Wiederaufnahme der Lehrtätigkeit an zahlreichen Universitäten. Die meisten Hochschullehrer bekannten sich zur traditionellen, angeblich unpolitischen Hochschule. An die Stelle einer Abrechnung mit dem Faschismus trat dessen einfache Verdrängung, das verbale Bekenntnis zu „abendländischen Kulturwerten“, die Reinwaschung der deutschen Wissenschaft und der persönlichen Vergangenheit. Als wichtigste „Lehre“ für die Hochschulen wurde deren angeblich notwendige Autonomie von den staatlichen Interessen formuliert. Politisch engagierte Hochschullehrer bildeten eine seltene Ausnahme. Selbst die Berufung von Sozialdemokraten zu Honorarprofessoren führte zu heftigen Protesten unter der Hochschullehrerschaft. Die Beibehaltung der traditionellen Zulassungsordnungen für die Universitäten und Hochschulen garantierte die Kontinuität in der Zusammensetzung der Studentenschaft und damit das Dominieren konservativ geprägter Einstellungen und Denkhaltungen bei deren Mehrheit. Von bestimmten Gruppen nazistisch belasteter Studenten abgesehen, konnten die schon vor 1945 Studierenden ihr Studium fortsetzen oder wieder aufnehmen. Ein Viertel der Studenten der Göttinger Universität rekrutierte sich aus ehemaligen Offizieren. Diese bildeten aus der Sicht der britischen Erziehungsoffiziere den „harten Kern“ derjenigen, die Vorlesungen störten, wenn darin die Kritik an der faschistischen Vergangenheit nicht auf die NSDAP beschränkt, sondern die „Wehrmacht“ einbezogen oder gar von einer Mitschuld desdeutschen Volkes gesprochen wurde. Nach alter bürgerlicher Universitätspraxis wurden auch jetzt noch Frauen bei der Immatrikulation benachteiligt. Die Universität Tübingen beispielsweise ließ zunächst überhaupt keine Frauen mehr zu. Möglichkeiten studentischer Organisation räumten die westlichen Militärbehörden erst im Herbst 1946 ein. Als erster Verband entstand der Sozialdemokratische Studentenbund (SDS), insgesamt aber sammelten sich vor allem traditionell rechtsstehende Studentenverbände.
Die westalliierte Reeducationpolitik verfehlte somit an den Universitäten und Hochschulen nicht nur ihr Hauptanliegen; sie erzielte auch keine durchgreifende Entnazifizierung der Lehrkörper. Zwar erfolgten zunächst Entlassungen oder Nichteinstellungen in größerer Zahl, aber diese Amtsenthebungen von Parteigängern des Nationalsozialismus waren im allgemeinen nicht von langer Dauer. Vakante Lehrstühle und Dozenturen wurden meist mit Hochschullehrern besetzt, die sich von den entfernten nur wenig unterschieden. Die umgesiedelte Hochschullehrerschaft der Universitäten östlich von Oder und Neiße bot ein Reservoir, das zur Disposition stand.
Seit 1945 waren auch schon wieder Professoren an die Universitäten gelangt, die dem Faschismus als „Ostkundeexperten“, Polizeiund Militärstrafrechtler und dergleichen ihre Dienste erwiesen hatten. Nicht wenige westalliierte Kommissionen bzw. Politiker drückten Ende 1946 bereits ihre große Besorgnis über den Zustand der Schulen und Hochschulen und über den dort herrschenden Geist aus und gaben das Versagen des Reeducationprogramms offen zu. Der Hochschulbereich hatte sich im Herbst 1946, als in der westzonalen Wirtschaft und Politik noch antifaschistisch-demokratische Veränderungen möglich schienen, bereits konservativ stabilisiert. So blieb letztlich die „re-education“ über Presse, Rundfunk, Theater und Film, die mit der Verbreitung „westlicher“ Demokratievorstellungen und „westlichen“ Gedankenguts Erfolge erzielte. Vor allem über Hollywoodfilme, die zunehmend den Kinobetrieb dominierten, wurde der „american way of life“ wirksam propagiert. In gewisser Weise geschah das auch durch die importierte Jazzmusik, die die deutsche Jugend in allen Besatzungszonen begeisterte. Nur wenig trug diese „Umerziehung“ allerdings zur Faschismusbewältigung bei.
Der beginnende Kurswechsel der britischen und der amerikanischen Deutschlandpolitik und die Pariser Konferenz des Rates der Außenminister
Der Kurs der Truman-Administration gegenüber der Sowjetunion hatte sich seit Beginn des Jahres 1946 weiter verhärtet. Am 22. Februar 1946 sandte der Geschäftsträger der amerikanischen Botschaft in Moskau, George F. Kennan, sein „Langes Telegramm“! nach Washington, in dem er — die alte Bedrohungslüge aufwärmend -, ausgehend von einem angeblich aggressiven und expansiven Charakter der sowjetischen Politik, eine antisowjetische „Politik der Stärke“ forderte. Er erzielte mit seinen Darlegungen in Washington große Wirkung und Beachtung. Am 5. März hielt Winston S. Churchill, nunmehr britischer Oppositionsführer, in Fulton (Missouri) im Beisein von USPräsident Truman eine im gleichen Sinne angelegte Rede, die gezielt und mit propagandistischem Aufwand in großen Teilen der Welt verbreitet wurde. Churchill bezichtigte die Sowjetunion einer expansionistischen Politik, sprach von einem „Eisernen Vorhang“, der in Europa niedergegangen sei, von den kommunistischen Parteien als von „fünften Kolonnen Moskaus“ in der ganzen Welt, behauptete, daß die Sowjetunion die „westliche Welt“ bedrohe, und forderte deren engen Zusammenschluß gegen diese „Bedrohung“, ihren wirksamen Schutz durch Hütung des Atombombenmonopols bzw. durch militärische Überlegenheit.!
Das waren deutliche Indizes für einen im Gang befindlichen oder in Gang gesetzten westalliierten Kurswechsel, mit dem die deutsche Frage aus einem Gegenstand der Kooperation der Hauptmächte der Anti-Hitler-Koalition zu einem Feld der Konfrontation zwischen ihnen zu werden drohte. Noch aber rangen diese beiden Tendenzen miteinander. Im State Department und im Foreign Office setzte sich zunehmend die Tendenz durch, der UdSSR zu unterstellen, ganz Deutschland „sowjetisieren“ bzw. unter ihren Einfluß bringen zu wollen. Die antifaschistisch-demokratischen Umgestaltungen in der Ostzone wurden — wenn auch zunächst nicht öffentlich statt als die legitimen Ergebnisse einer am Potsdamer Abkommen orientierten Politik zunehmend als bloßes Vehikel kommunistischer bzw. sowjetischer Machtausbreitung interpretiert. Die mögliche Errichtung einer deutschen Zentralregierung in Berlin — für die Öffentlichkeit als Ziel der britisch-amerikanischen Deutschlandpolitik ausgegeben -, wurde insgeheim — wie die geheimen Kabinettsvorlagen des britischen Außenministers Ernest Bevin vom Frühjahr 1946 belegen — aus antisowjetischen Motiven abgelehnt. So hieß es in einer dieser Kabinettsvorlagen vom 15. April 1946: „… wenn Berlin wieder Sitz einer deutschen Regierung ist, wird diese unter starken Druck der Kommunisten und Sowjets geraten. Die Kommunisten werden sich im Osten fest etabliert haben und ihre Offensive gegen die Parteien im Westen fortsetzen. Denn ich befürchte, wir müssen weiter von der Annahme ausgehen, daß die sowjetische Regierung auch in Zukunft alles daransetzen wird, um sicherzustellen, daß die künftige deutsche Regierung kommunistisch sein und von ihr kontrolliert wird … Unter diesen Umständen, so denke ich, sollten wir klug sein und die gegenwärtige Zoneneinteilung zunächst beibehalten und die Errichtung einer Zentralregierung mit Sitz in Berlin verzögern.“ 1?! Im Resümee der Vorlage wurden als im britischen Interesse liegend „ein demokratisches und nach Westen orientiertes Deutschland“ und „Beschränkung des sowjetischen Herrschaftsbereiches so weit östlich wie möglich“ genannt.Und in Bevins Kabinettsvorlage vom 3. Mai 1946 erfolgte — gewissermaßen weiterführend — folgende grundlegende Positionsbestimmung: „… die russische Gefahr ist inzwischen mit Sicherheit genauso groß, möglicherweise aber noch größer als die Gefahr eines wiedererstarkten Deutschland. Die schlimmste Situation würde aus einem wiedererstarkten Deutschland in Verbindung mit oder beherrscht von Rußland erwachsen.“
Immer klarer schälte sich als das aus britischer Sicht einzig mögliche neue Konzept heraus, die Länder der Westzonen auf die eine oder andere Weise zusammenzuschließen und in einen Westblock zu integrieren.
Demgegenüber entwickelte der Stellvertreter des amerikanischen Militärgouverneurs, General Lucius D. Clay, in einem umfassenden Bericht an das Kabinett in Washington vom 28.Mai 1946 noch Vorschläge zur baldigen Einsetzung einer provisorischen deutschen Regierung und zur Einführung eines ExportImport-Planes sowie für eine Regelung der Reparationen, die allerdings die von der UdSSR praktizierte Entnahme von Reparationslieferungen aus der laufenden Produktion ausschloß. In Washington hatte man sich jedoch bereits von solchen Positionen weit entfernt. Wenn man hier — unter anderem um der Sowjetunion nicht das Feld als Anwalt für ein einheitliches, demokratisches Deutschland zu überlassen — nach außen hin noch an Vorstellungen über die Errichtung eines westlich orientierten, bürgerlich-kapitalistischen Deutschland festhielt, so dominierten doch auch in der amerikanischen Deutschlandpolitik letztlich immer mehr solche Überlegungen, wie sie Kennan am 6.März 1946 entwickelte: „Ich bin sicher, daß die Russen davon überzeugt sind, in einem unter einer einzigen Administration geeinten Rumpfdeutschland westlich der Oder/Neiße werde es keine einzige politische Kraft geben, die gegen den von Rußland unterstützten Linksblock aufstehen kann.“ Deshalb gelte es, „den Prozeß der Teilung, der im Osten begonnen worden ist, zu einem logischen Ende zu führen und sich um die Rettung der westlichen Zonen zu bemühen, indem man sie gegen östliche Durchdringung abschließt und sie statt in ein geeintes Deutschland in die westeuropäische Region integriert“.?* Auch die französischen Gaullisten und andere bürgerliche Kreise mit Außenminister Georges Bidault sowie die Sozialisten motivierten ihre deutschlandpolitische Haltung, insbesondere ihren Widerstand gegen deutsche Zentralverwaltungen und andere Zentralisierungsmaßnahmen, immer stärker antisowjetisch. Über einen zentralen deutschen Staat würde der Einfluß der Sowjetunion schließlich bis an die französische Westgrenze vordringen.
In dem Maße, wie seit Frühjahr 1946 in der Außenpolitik der Westmächte die Bildung eines antisowjetischen Westblocks, verbunden mit Anstrengungen zur „Wiedergesundung“ Westeuropas, Priorität erlangte, erschien eine Regelung der deutschen Frage gemeinsam mit der Sowjetunion nicht mehr sinnvoll. Die Westzonen sollten auf jeden Fall in die Westblockbildung einbezogen werden. Der von amerikanischer Seite am 4. Mai 1946 im Alliierten Kontrollrat angekündigte Demontagestopp für Reparationslieferungen an die Sowjetunion war ein deutliches Signal für den Übergang von einer kooperativen zu einer konfrontativen Politik in der deutschen Frage. Am 20. Juli 1946 schlugen die USA den separaten Zusammenschluß der britischen und der amerikanischen Besatzungszone zur Bizone vor. Dieser Vorschlag der USA sowie die Zustimmung Großbritanniens zur Bildung der Bizone sollten der bis dahin folgenschwerste Schritt zur Untergrabung der Viermächteverwaltung werden.
Der Kurswechsel der USA und Großbritanniens in der Deutschlandfrage zeigte sich auch darin, daß von westlicher Seite für eine vorgeblich angestrebte Viermächteregelung der deutschen Frage Vorschläge unterbreitet wurden, die auf eine Revision der Potsdamer Beschlüsse hinausliefen und von denen man wußte, daß sie für die Sowjetunion unakzeptabel waren.
Typisch dafür waren das Vorgehen der Westmächte auf der Pariser Konferenz des Rates der Außenminister im Sommer 1946, speziell der von USA-Außenminister James F. Byrnes vorgelegte Plan einer 25jährigen Entmilitarisierung und Kontrolle Deutschlands. Dieser Plan zielte darauf, eine Viermächteregelung der deutschen Frage zu amerikanischen Bedingungen und Vorstellungen durchzusetzen, die entscheidende Bestandteile der Potsdamer Beschlüsse ausklammerte und diese auf eine Entmilitarisierung reduzierte. Er zielte auf ein keinerlei wirtschaftlichen und politischen Friedensgarantien unterworfenes, kapitalistisches, westlich orientiertes Deutschland, in dem die gesellschaftlichen Grundlagen von Militarismus und Aggression nicht beseitigt, reaktionäre und revanchistische Kräfte nicht definitiv entmachtet gewesen wären und das keine Garantien für die Erfüllung der deutschen Reparationsverpflichtungen bot.
Die französische Regierung unterbreitete auf der Pariser Außenministerkonferenz zudem Forderungen nach Internationalisierung und Losreißung des Rheinund Ruhrgebietes von Deutschland sowie nach Einbeziehung des Saargebietes in den französischen Zollverband.
Der sowjetische Außenminister W.M. Molotow wies all diese Pläne zurück und erklärte dazu unter anderem, daß Deutschland ohne das Ruhrgebiet nicht lebensfähig sei. Ihrerseits schlug die sowjetische Seite die Bildung einer gesamtdeutschen Regierung, die Demokratisierung Deutschlands, eine Viermächtekontrolle über die Ruhrindustrie und die Vorbereitung des Abschlusses eines Friedensvertrages auf der Grundlage des Potsdamer Abkommens vor. Außerdem trat sie für eine Anhebung des vierseitig festgelegten deutschen Industrieniveaus ein.
In der Frage der zukünftigen deutschen Staatsorganisation suchte die UdSSR, die im Prinzip für die Errichtung eines zentralen deutschen Staates eintrat, eine Verständigung mit den Westmächten herbeizuführen, indem sie deren Widerständen gegen eine zu starke Zentralisierung mit dem Konzept eines dezentralisierten Einheitsstaates Rechnung trug. Sie erklärte sich darüber hinaus bereit, den auf eine Förderalisierung zielenden Vorstellungen der Westmächte noch weiter entgegenzukommen, wenn diese von einer Mehrheit des deutschen Volkes unterstützt würden, und schlug vor, das deutsche Volk in einem Volksentscheid über dezentralisierten Einheitsstaat, Bundesstaat oder Staatenbund entscheiden zu lassen. Dazu jedoch waren die Westmächte nicht bereit.
Wie ursprünglich vorgesehen, wurde beschlossen, die deutsche Frage zum Hauptgegenstand der Moskauer Tagung des Rates der Außenminister Anfang 1947 zu machen.
Anklagebank im Nürnberger Kriegsverbrecherprozeß, 1946. In der ersten Reihe v.I.n.r.: Göring, Hess, Ribbentrop, Keitel; in der zweiten Reihe v.I.n.r.: Dönitz, Raeder, Schirach, Saukel, Speer (stehend)
Das Urteil im Nürnberger Prozeß gegen die deutschen Hauptkriegsverbrecher
Zur gleichen Zeit, als die Westmächte bereits auf Konfrontationskurs gegenüber der Sowjetunion gingen, führte die bisherige Zusammenarbeit noch zu zahlreichen bedeutsamen Ergebnissen. So bahnte sich vor allem ein erfolgreicher Abschluß der Ausarbeitung der Friedensverträge für die ehemaligen Satelliten Hitlerdeutschlands durch den Rat der Außenminister an. Zu den wichtigsten Ergebnissen gehörte auch die Urteilsverkündung im Nürnberger Prozeß gegen die deutschen Hauptkriegsverbrecher am 1.Oktober 1946.
Der Nürnberger Prozeß hatte am 20. November 1945 begonnen. Seine Grundlage bildete das Statut des Internationalen Militärgerichtshofes. Im Prozeßverlauf hatten die Ankläger ein erdrückendes Beweismaterial über Verbrechen gegen den Frieden bzw. Vorbereitung und Führung eines Angriffskrieges und Kriegsverbrechen bzw. Verbrechen gegen die Menschlichkeit, wie Mißhandlung von Zivilpersonen und Kriegsgefangenen, Massenmorde an der Zivilbevölkerung, speziell der jüdischen, bis hin zur fabrikmäßigen Tötung in Konzentrationslagern und Massenvernichtungsstätten, Euthanasieaktionen, Tötung von Kriegsgefangenen, Hinrichtung von Geiseln, Verschleppung zur Zwangsarbeit, Beschießung unverteidigter Orte, vorgelegt. Mit den 22 vor Gericht gestellten Angeklagten als den höchsten Repräsentanten der NSDAP, des faschistischen Staates und der deutschen Wehrmacht — Gustav Krupp von Bohlen und Halbach war wegen Krankheit von der Anklageliste dieses Prozesses gestrichen, Martin Bormann in Abwesenheit angeklagt worden sollten die jeweiligen Institutionen bzw. Organisationen — das Führerkorps der NSDAP, die Gestapo, der SD, die SS, die SA, die Reichsregierung, der Generalstab und das OKW als verbrecherisch verurteilt werden.
Der Internationale Militärgerichtshof erachtete im Ergebnis der Verhandlungen und der Beweisführung die Angeklagten und in ihrer Person den deutschen Faschismus und Militarismus des Verbrechens gegen den Frieden durch Vorbereitung und Entfesselung eines Angriffskrieges, der Kriegsverbrechen und der Verbrechen gegen die Menschlichkeit als überführt. Martin Bormann (in Abwesenheit), Hans Frank, Wilhelm Frick, Hermann Göring, Alfred Jodl, Hermann Kaltenbrunner, Wilhelm Keitel, Joachim von Ribbentrop, Alfred Rosenberg, Fritz Sauckel, Artur Seyß-Inquart und Julius Streicher wurden zum Tode durch den Strang, Walther Funk, Rudolf Heß und Erich Raeder zu lebenslänglich, Baldur von Schirach und Albert Speer zu 20 Jahren, Konstantin von Neurath zu 15 Jahren und Karl Dönitz zu 10 Jahren Gefängnis verurteilt. Franz von Papen, Hjalmar Schacht und Hans Fritzsche wurden freigesprochen. Das Korps der politischen Leiter der NSDAP, die Gestapo, der SD und die SS wurden zu verbrecherischen Organisationen erklärt. Das sowjetische Mitglied des Gerichtshofes legte gegen die Nichteinbeziehung von Reichsregierung, Generalstab und OKW sowie SA in den Kreis der verbrecherischen Organisationen, gegen die Verhängung der Haftstrafen statt von Todesstrafen und gegen die Freisprüche Einspruch ein.
Insgesamt kam in der Urteilsverkündung ein neues, demokratisches Völkerrecht zum Tragen. Der Verurteilung der faschistischen Verbrechen sowie derjenigen, die sie begangen hatten — auch wenn diese sich darauf beriefen, sich auf „gesetzliche Bestimmungen“ oder auf „geltendes Recht“ gestützt zu haben — kam ebenso wie der Verurteilung der Vorbereitung und Entfesselung eines Angriffskrieges als Verbrechen gegen den Frieden eine große Bedeutung für den Kampf der Völker gegen faschistische Terrorregime und gegen jede Art Kriegsbrandstifter, für die Erhaltung des Weltfriedens zu. Der Krieg hörte endgültig auf, als eine bloße und legitime Fortsetzung der Politik nur mit anderen Mitteln zu gelten. Im Urteil von Nürnberg verschaffte sich die Stimme der friedliebenden Völker der Anti-Hitler-Koalition Gehör, all denen zur Warnung, die da bereits wieder Kriegspläne gegen die Sowjetunion in ihr Kalkül aufnahmen. Von den antifaschistisch-demokratischen Kräften des deutschen Volkes wurde das Nürnberger Urteil mit Genugtuung aufgenommen, wenngleich die Freisprüche und andere Inkonsequenzen Befremden erregten. Das Urteil von Nürnberg wurde von den antifaschistisch-demokratischen Kräften in allen Besatzungszonen in ihrem Ringen um Faschismusbewältigung wirksam genutzt.
Der Kurs auf die Bildung der Bizone
Am 6.September 1946 hielt der amerikanische Außenminister James F. Byrnes in Stuttgart eine programmatische Rede, die mit großem Propagandaaufwand vorbereitet worden war und verbreitet wurde. In dieser Rede, in der Fragen der wirtschaftlichen und der politischen Einheit Deutschlands einen breiten Raum einnahmen, wurde der Vorschlag zur Schaffung der „Vereinigten Staaten von Deutschland“ unterbreitet.!?° Die Realisierung dieses Vorschlages hätte bedeutet, ohne irgendwelche wirklichen Friedensgarantien einen von den Ländern der Westzonen bzw. von deren Regierungen dominierten deutschen Staatenbund oder Bundesstaat zu errichten und auf diese Weise den Zustand der Nichterfüllung der Potsdamer Beschlüsse in den Ländern der Westzonen nicht nur zu legitimieren, sondern auch zur normativen Grundlage für den zu errichtenden deutschen Staat zu machen. Damit wäre kein demokratischer deutscher Staatsverband entstanden und auch kein neutralisierter. Denn es bestand die Absicht, diesen in den angestrebten Westblock einzubeziehen. Daß eine solche Perspektive für die Sowjetunion unannehmbar war, lag auf der Hand; der Byrnes-Plan widersprach aber auch den Interessen der antifaschistisch-demokratischen Kräfte des deutschen Volkes und dem Gebot wirksamer Friedenssicherung auf deutschem Boden.
Der Vorschlag war jedoch keineswegs als das Hauptanliegen der Rede zu werten, wie denn seine Ernsthaftigkeit überhaupt bezweifelt werden mußte. Quintessenz und entscheidendes Anliegen der Byrnes-Rede, mit der nunmehr auch eine offizielle Neubestimmung der amerikanischen Außenund Deutschlandpolitik — entgegen dem Potsdamer Abkommen mit unverkennbar antisowjetischer Ausrichtung erfolgte, lagen darin, die Öffentlichkeit auf die separate Entwicklung der Westzonen im Rahmen einer anderen als der in Potsdam beschlossenen Politik zu orientieren, sie auf den Zusammenschluß der amerikanischen und der britischen Zone zur „Bizone“ vorzubereiten und dabei zugleich die Perspektive einer Einbeziehung der Westzonen in einen antisowjetischen Westblock anzudeuten. Byrnes ließ durchblicken, daß mit der Bildung der Bizone ein stärkeres Engagement der USA, eine gewisse Wende in deren Politik verbunden sein werde; die USA würden ihre militärische Präsenz in Deutschland und in Europa in absehbarer Zeit keinesfalls beenden. Er gab zu verstehen und wurde von westzonalen Politikern auch so verstanden, daß die USA eine Parteinahme der Deutschen in den Westzonen für den Westblock und gegen die Sowjetunion zu honorieren “gedachten. Auf dieser Linie lag es, wenn Byrnes in seiner Rede die prinzipielle Endgültigkeit der Potsdamer Grenzregelung entlang von Oder und Neiße verneinte.
Die Byrnes-Rede wurde von einem „Report of the Secretary’s Policy Committee on Germany“‘?° des State Department vom 15. September 1946 flankiert. Dabei handelte es sich um eine Analyse der langfristigen und der kurzfristigen Ziele der amerikanischen Deutschlandpolitik in ihrem Verhältnis zur Deutschlandpolitik Großbritanniens, Frankreichs und insbesondere der UdSSR. Der „Report“ vertiefte die Grundgedanken der Byrnes-Rede bzw. des Byrnes-Planes. Er schloß die Möglichkeit, sich mit der Sowjetunion über ein einheitliches Deutschland bzw. ein Länderdeutschland zu verständigen, nicht völlig aus, band dies aber an deren Verzicht auf Reparationen aus der laufenden Produktion und an andere Bedingungen zugunsten der Westmächte. Der Grundtenor des Berichtes, der noch eine gewisse Unentschiedenheit angesichts der Situation im Vorfeld der Moskauer Konferenz des Rates der Außenminister widerspiegelte und verbal an Zielsetzungen der Potsdamer Beschlüsse anknüpfte, lag eindeutig darauf, ein kommunistisches oder kommunistisch stark beeinflußtes einheitliches Deutschland zum Ziel der sowjetischen Deutschlandpolitik zu erklären und davon ausgehend kategorisch festzustellen: „Die USA können kein möglicherweise kommunistisch beherrschtes Deutschland hinnehmen, und das Ziel eines neutralen Deutschlands würde durch einen vorherrschenden kommunistischen Einfluß ernstlich in Frage gestellt.“
Mit dem am 2. Dezember 1946 in New York unterzeichneten britisch-amerikanischen Abkommen über die Bildung der Bizone wurde von seiten der beiden Signatarmächte ein schwerer Schlag gegen die Viermächteverwaltung Deutschlands geführt und Kurs auf separate Westzonenregelungen genommen. Zwar versuchten die USA und Großbritannien im Vorfeld der Moskauer Konferenz des Rates der Außenminister den Eindruck zu erwecken, daß auch sie an einer Viermächteregelung der deutschen Frage und an der Herstellung der wirtschaftlichen und politisch-staatlichen Einheit Deutschlands interessiert seien, und betonten deshalb den angeblich rein wirtschaftlichen Charakter des Zusammenschlusses ihrer Zonen. Es mußte jedoch jedem klar sein, daß sie hiermit Grundlagen und Ausgangspositionen für eine einseitige Westzonenregelung der deutschen Frage für den Fall schufen, daß es ihrfen auf der Moskauer Konferenz nicht gelingen werde, eine Regelung der deutschen Frage in ihrem Sinne durchzusetzen.
US-Außenminister James F. Byrnes (rechts) bei der Abreise aus Stuttgart, 11. September 1946. V.I.n. r.: die Ministerpräsidenten
Wilhelm Hoegner (Bayern), Reinhold Maier berg-Baden), Karl Geiler (Hessen)
Die Regierung der UdSSR kritisierte die Bildung der Bizone scharf, warnte vor den damit verbundenen Folgen und wies in einer Erklärung vom 16. September 1946 das Infragestellen der Oder-Neiße-Grenze durch die USA scharf zurück.
Die gesellschaftlich-politische Polarisierung auf deutschem Boden im Herbst 1946
Mit den Maßnahmen zur Bildung der Bizone, wie sie schon im September 1946 ergriffen wurden, verstärkten sich die Positionen derjenigen wirtschaftlichen und politisch-staatlichen Mächte und Kräfte wesentlich, die erklärte Gegner der Potsdamer Beschlüsse und der antifaschistisch-demokratischen Umwälzungen im Osten Deutschlands waren und auf eine restaurative Neuordnung im Rahmen der Westzonen hinwirkten.
Die deutsche Monopolbourgeoisie hatte sich im Laufe des Jahres 1946 unter dem Regime der westalliierten Militärregierungen zunehmend erholt. Sie hatte ihre Kräfte gesammelt und reorganisiert und — aus der Defensive heraus — ihre restaurativen Bestrebungen zunehmend zur Geltung gebracht. Ihre Konzepte liefen korrespondierend mit denen herrschender Kreise der Westmächte — auf eine bloße Ablösung des Faschismus durch bürgerlich-parlamentarische Herrschschaftsformen und darauf hinaus, die Faschismusbewältigung nicht als gesellschaftlich-politische Aufgabe, sondern durch „Umerziehung“ oder bloße Umorientierung, durch „Anderswerden“ im Sinne „christlicher“ oder „liberaler“ Politik zu bewerkstelligen. Anknüpfend an Konzepte, die teilweise in Opposition zur faschistischen Herrschaft, teilweise in deren Schoß entwickelt worden waren, sollte in den Westzonen nunmehr ein reformiertes, mehr liberal bzw. sozial drapiertes System des staatsmonopolistischen Kapitalismus errichtet werden — außenund gesellschaftspolitisch „westorientiert“ und auf einen antisowjetischen Westblock bzw. westeuropäischen Zusammenschluß ausgerichtet. Mittels seiner wirtschaftlichen Positionen, seines Einflusses auf Regierungen, Verwaltungen und Wirtschaftsämter, auf Industrieund Handelskammern sowie auf neugegründete Unternehmerverbände, seiner Beziehungen und Verbindungen zu den Besatzungsbehörden und internationalen Finanzkreisen dominierte das Monopolkapital die westzonale Wirtschaft. Unter diesen Umständen und Bedingungen bewirkten der wirtschaftliche Wiederaufbau bzw. die Wiederbelebung der Wirtschaft zugleich die Restauration monopolkapitalistischer Macht. Auch der — unangetastet gebliebene — Großgrundbesitz hatte seine Positionen gestärkt und übte zunehmend wieder politischen Einfluß auf dem Lande aus.
Bei allen Unterschieden zwischen der amerikanischen, der britischen und der französischen Zone wiesen diese doch — unter den Aspekten sozialökonomische Verhältnisse, Kontinuität der traditionellen Herrschaftseliten, Charakter der Verwaltungsorgane, Klassencharakter der jeweiligen Besatzungspolitik, Blockierung antifaschistisch-demokratischer, antimonopolistischer Umgestaltungen deutliche Übereinstimmungen untereinander und grundlegende Unterschiede zur Ostzone aus. Die reale Entwicklung in den Ländern der Westzonen, der immer deutlicher werdende Kurswechsel der Westmächte und besonders die Bizonenbildung gaben den restaurativen Kräften und Mächten weiteren Auftrieb, trugen aber auch zur stärkeren Mobilisierung eines antifaschistisch-demokratischen Alternativpotentials bei.
CDU und CSU gelang es in besonderem Maße, sich auf die neue, in sich widersprüchliche Situation einzustellen. Sie entwickelten sich zu bürgerlichen Sammelparteien mit mehreren hunderttausend Miitgliedern — darunter auch ein beträchtlicher Anteil von Arbeitern. Beide Parteien artikulierten sich auf eine bestimmte, praxisunwirksame, aber einprägsame Weise antimonopolistisch und propagierten eine sozial gerechte Gemeinwirtschaft, mit der die Gebrechen des Kapitalismus beseitigt und der „kollektivistische Sozialismus“ vermieden werden könnten. Auch von einem „christlichen Sozialismus“ war die Rede. Die christliche Weltanschauung wurde als Heilmittel einem fiktiven „Materialismus“ und „Kollektivismus“ als den angeblich gemeinsamen Wurzeln von Marxismus und Nationalsozialismus gegenübergestellt.
Die die Führungen von CDU und CSU 1946 zunehmend dominierenden politischen Kräfte, wie in der britischen Zone Konrad Adenauer, der Bankier Robert Pferdmenges und der Oberpräsident der Nordrheinprovinz Robert Lehr, arbeiteten mit Erfolg darauf hin, diese Parteien zum parteipolitischen Hauptinstrument für die Blockierung tiefgreifender demokratischer Umgestaltungen und die restaurative Durchdringung oder Überformung der demokratischen Neuordnung zu entwickeln. Als wirksames Instrumentarium hierfür erwiesen sich Antisowjetismus und Antikommunismus, insbesondere in Form der Totalitarismusdoktrin, und die nationalistische Hetze gegen die alliierte Ostgrenzenregelung. Sie fand bei vielen der über 6 Millionen Umsiedler Resonanz. Indem man diese auf Dauer als „Vertriebene“ und „Flüchtlinge“ abstempelte und ihnen ein realisierbares „Recht auf Heimat“ suggerierte, wurde sowohl bei den Verwaltungen wie auch bei den Umsiedlern selbst der Wille zu deren sozialer Integration in die Gesellschaft stark eingeschränkt. Ein großer Teil der Umsiedler mußte in den Westzonen für längere Zeit in Lagern verbleiben. Im Oktober 1946 gab es zum Beispiel in Bayern noch 1375 Lager mit 146000 Insassen. Die unzureichend und oft nur provisorisch durchgeführte Eingliederung der Umsiedler in den Westzonen und die damit verbundenen Auswirkungen ließen hier gefährliche, nationalistisch aktivierbare Potentiale entstehen. Die CDU stellte sich mit der Bildung von „Flüchtlingsausschüssen“ und mit der Verbreitung revanchistischer Losungen darauf ein.
Die Ergebnisse der Gemeindewahlen am 15. September 1946 und der Kreisund Städtewahlen am 13. Oktober 1946 in den Ländern der britischen Zone und am 28. April, 26.Mai, 15. September und 13. Oktober in den Ländern der französischen Zone ergaben, daß sich CDU und SPD als die eindeutig wählerstärksten Parteien zu profilieren vermochten, hinter denen sich bereits in beträchtlichem Abstand die liberalen Parteien (FDP, DVP) und die KPD plazierten. In einigen Ländern vermochten solche Parteien wie die Zentrumspartei, die NLP mit 19,8 Prozent der Stimmen in Niedersachsen — und die Südschleswigsche Wählervereinigung zum Teil beachtliche Stimmenanteile auf sich zu vereinen; bei den Gemeindewahlen traf das auch auf unabhängige Kandidaten zu.
Die KPD erzielte beachtliche Ergebnisse bei den Kreisund Städtewahlen in Baden mit 13,1, in Württemberg-Hohenzollern mit 12,3 und Nordrhein-Westfalen mit 9,4 Prozent der abgegebenen Stimmen. Der KPD gelang es hier vor allem im Ruhrgebiet, örtlich starke Positionen zu erringen, so in Solingen mit 23,1 Prozent.
Die SPD ging aus den Kreisund Städtewahlen in Schleswig-Holstein klar mit 42, in Hamburg mit 43,1 Prozent, in Württemberg-Hohenzollern und Baden knapp vor den christdemokratischen Parteien als wählerstärkste Partei hervor. Die CDU erreichte in Rheinland-Pfalz mit 54,7 und in Nordrhein-Westfalen mit 46 Prozent Stimmenanteil die besten Ergebnisse.
Bei den Landtagswahlen in den Ländern der amerikanischen Zone am 24. November bzw. 1. Dezember 1946 erreichte die SPD in Hessen mit 42,7 und in Bremen mit 48,0 Prozent die meisten Stimmen und ihre besten Ergebnisse. Die KPD erzielte hier 10,7 bzw. 11,5 und in Württemberg-Baden 10,5 Prozent Stimmenanteil. In Bayern erhielt die CSU 52,3, die SPD nur 28,6 und die KPD 6,1 Prozent der Stimmen. Infolge einer undemokratischen 10-Prozent-Sperrklausel war die KPD hier im Landtag nicht vertreten. Insgesamt erreichten in der amerikanischen Zone die Parteien bei den Landtagswahlen bzw. der Bremer Bürgerschaftswahl folgende Stimmenanteile: CDU/CSU 42,8, SPD 33,4; die liberalen Parteien DVP (Württemberg-Baden), FDP (Bayern), LDP (Hessen) und Bremer Demokratische Volkspartei (BDV) 11,6; KPD 8,2; WAV (nur in Bayern) 3,7 Prozent. Der Rest der Stimmen entfiel auf Splittergruppen.
Im Ergebnis der Landtagswahlen wurden in den Ländern der amerikanischen Besatzungszone die Landesregierungen neuoder umgebildet. Dabei wurde meist die Tendenz, angesichts der gegebenen besonderen Nachkriegssituation Allparteienkabinette zu bilden, fortgesetzt. In Württemberg-Baden waren unter Ministerpräsident Reinhold Maier (DVP) DVP, CDU, SPD und KPD an der Regierung beteiligt; in Bremen unter Senatspräsident Wilhelm Kaisen (SPD) SPD, BDV und KPD; in Bayern unter Ministerpräsident Hans Ehard (CSU) CSU, SPD und WAV.
Demgegenüber fand in Hessen die Koalition von SPD, CDU und KPD, die mit Ministerpräsident Karl Geiler (parteilos) an der Spitze seit November 1945 gewirkt hatte, keine Fortsetzung. Obwohl SPD und KPD im hessischen Landtag zusammen eine absolute Mehrheit besessen hätten, bildete die SPD in antikommunistischer Abgrenzung unter Ministerpräsident Christian Stock (SPD) ab Januar 1947 zusammen mit der CDU eine Zweiparteienregierung.
In den Ländern der britischen und der französischen Zone wurden auf Grund der Ergebnisse der Kreis- und Städtewahlen Regierungsumbildungen vorgenommen sowie von den Militärregierungen die Stärkeverhältnisse in den zunächst ernannten Landtagen festgelegt, die in der französischen Zone zugleich als verfassunggebende Versammlungen fungierten. Im Dezember 1946 wurden Koalitionsregierungen von SPD, CDU, FDP, NLP und KPD unter Ministerpräsident Hinrich Wilhelm Kopf (SPD) in Niedersachsen, von SPD, CDU, FDP und KPD unter Ministerpräsident Rudolf Amelunxen (parteilos) in NordrheinWestfalen, von CDU und SPD unter Theodor Steltzer (CDU) in Schleswig-Holstein und von SPD, FDP und KPD unter Bürgermeister Max Brauer (SPD) in Hamburg gebildet.
In Württemberg-Hohenzollern entstand im Dezember 1946 unter Präsident Carlo Schmid (SPD) aus SPD, CDU und DVP eine Regierungskoalition, in Baden unter Präsident Leo Wohlleb (Badische ChristlichSoziale Volkspartei) aus BCSV, Sozialdemokratische Partei (SP), Demokratische Partei (DP) und Kommunistische Partei (KP) wie sich die Parteien hier nennen mußten — und in Rheinland-Pfalz unter Präsident Wilhelm Boden (CDU) aus CDU, SPD und KPD.
Nachdem 1945 in fast allen Ländern und Provinzen der westlichen Besatzungszonen Kommunisten Regierungsmitverantwortung übertragen worden war und die kommunistischen Minister eine verantwortungsbewußte und aufopfernde Arbeit geleistet hatten, war die KPD seit Dezember 1946 an den Landesregierungen von Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Württemberg-Baden, Baden und Rheinland-Pfalz sowie an den Senaten von Hamburg und Bremen beteiligt — allerdings zumeist nur mit einem Vertreter und nicht in maßgebender Position. Vermochte die KPD auch keinen entscheidenen Einfluß auszuüben, so war doch die Tatsache ihrer Regierungsmitverantwortung von politischer Bedeutung und ein gewisser Indikator für noch offene und unentschiedene Entwicklungsmöglichkeiten. Sie konnte zu einem wichtigen Ausgangs- und Ansatzpunkt zur Verstärkung antifaschistisch-demokratischer Bestrebungen werden.
Von den Landes- und Provinzialverwaltungen bzw. späteren -regierungen der Ostzone unterschieden sich allerdings — was Charakter und Stellung anbelangt die westzonalen Länderregierungen grundsätzlich. Gemäß dem Aufgabenverständnis und der staatstheoretischen Position ihrer Ministerpräsidenten und maßgeblichen Mehrheiten konzentrierten sich diese keineswegs darauf, tiefgreifende antifaschistisch-demokratische Umgestaltungen durchzuführen oder befördern zu helfen, und sie waren infolge der Kompetenzbeschränkung seitens der westlichen Militärregierungen auch kaum in der Lage, als Machtinstrument dafür mit Erfolg zu wirken.
Die SPD errang ihre Erfolge mit einer antifaschistisch, aber auch antikommunistisch ausgerichteten Wahlpropaganda, in deren Mittelpunkt sie die Begriffe „Demokratie“ und „Freiheit“ ohne nähere Bestimmung bzw. als reine Slogans -, die Losung vom Begrüßung der SPD-Politiker Kurt Schumacher und Franz Neumann durch den City Lordmayor von London, Herbst 1946 „demokratischen Sozialismus“ sowie die Ankündigung stellte, die Grundund Schlüsselindustrien in Gemeineigentum überführen, eine Wirtschaftslenkung einführen und den Großgrundbesitz enteignen zu wollen. Mit Attacken gegen die Oder-NeißeGrenze suchte sie Wähler auch rechts von der Mitte zu gewinnen.
Im Zusammenhang mit der Bizonenentwicklung stellte der Parteivorstand der SPD in seinem am 25.September 1946 in Köln gefaßten Beschluß kritisch fest: „In Politik, Wirtschaft und Verwaltung herrschen wieder die gleichen Kräfte, die uns zu den heutigen Zuständen geführt haben. So sind bei der Vereinigung der britischen und amerikanischen Besatzungszone sämtliche Zentralbehörden Vertretern kapitalistischer Auffassungen übertragen worden.“ Ihren Protest dagegen verband die SPD mit der Ankündigung, sie werde ihre weitere „politische Mitarbeit von verbindlichen Zusagen abhängig“ machen, daß außer einem gerechten Lastenausgleich vor allem „die Sozialisierung der Grundstoff-Industrien, der Energiewirtschaft, der Verkehrsunternehmen, der Banken und Versicherungsgesellschaften und eine durchgreifende und produktionsfördernde Agrarreform durchgeführt werden“.!® In einem Aufruf vom 19. November 1946 unterstrich der Parteivorstand der SPD nochmals diesen Beschluß und erhärtete, daß es von der Erfüllung jener Forderungen abhänge, „ob die Sozialdemokratie weiter an den von den Siegermächten kontrollierten Regierungen teilnehmen kann“.
Die richtigen Feststellungen über die restaurativen Aspekte der Bizonenbildung und die weitreichenden Ankündigungen des Parteivorstandes der SPD erweck: ten Hoffnungen und schienen Möglichkeiten zu eröffnen, der restaurativen Neuordnung entgegenwirken zu können. Die gleichzeitige grundsätzliche Bejahung von Bizone, westzonaler Separatund Westblockentwicklung unter Hintanstellung der Frage. eines einheitlichen deutschen Staates und eines Vier-MächteFriedensschlusses, die Diffamierung der antifaschistisch-demokratischen Umwälzungen in der Ostzone und die Frontstellung des Parteivorstandes der SPD gegen SED und KPD standen dem jedoch entgegen. So zeitigten dessen Proteste keine Wirkung, zumal er bald auch seine Ankündigung, eine Mitwirkung der SPD aufzukündigen, wieder zurücknahm.
All dies machte deutlich, daß die KPD die einzige Partei in den Westzonen war, die sich wirklich konsequent gegen die Bildung der Bizone wandte. Die KPD entlarvte diese als „Versuch der Reaktion …, die Kluft zwischen den verschiedenen Teilen Deutschlands zu vertiefen“! und rief zum Kampf um die Herstellung der demokratischen Einheit Deutschlands auf.
Richtung und Charakter der mit der Bildung der Bizone verbundenen Entwicklungsprozesse vertieften die gesellschaftlich-politische Ost-West-Polarisierung auf deutschem Boden wesentlich. Die Bizonenbildung signalisierte und beschleunigte zugleich einen Prozeß des Hinausdriftens der Westzonen aus dem Rahmen der alliierten Viermächteverwaltung Deutschlands und aus dem Nationalverbund der deutschen Länder, wie er faktisch noch bestand. Die Weichen wurden für einen westzonalen Separatweg — gegen die nationalstaatliche demokratische Einheit Deutschlands — gestellt.
Mit der Bildung der Bizone waren die deutsche Nachkriegsentwicklung und die alliierte Viermächteverwaltung an einem Scheideweg angelangt. Zwei unterschiedliche und auseinanderlaufende Wege zeichneten sich ab. Noch aber waren im Vorfeld der Moskauer Außenministerkonferenz — keine endgültigen Entscheidungen gegen die Herstellung der wirtschaftlichen und politischen Einheit Deutschlands auf demokratischer Grundlage für die es ein Mehrheitspotential im deutschen Volke gab — bzw. gegen eine Viermächteregelung der deutschen Frage gefallen.
Der Ausbau der antifaschistisch-demokratischen Verhältnisse in der Ostzone und das Ringen um die demokratische Einheit Deutschlands und um Friedensschluß. Die Verhinderung antimonopolistisch-demokratischer Umgestaltungen in den Westzonen und die Weichenstellung für den Westzonenstaat (Herbst 1946 bis Frühjahr 1948)
Das Ringen um die demokratische Einheit Deutschlands und um einen Friedensschluß
Inhaltsverzeichnis [verstecken]
- 1 Das Ringen um die demokratische Einheit Deutschlands und um einen Friedensschluß
- 1.1 Das Dokument „Grundrechte des deutschen Volkes“ und der Verfassungsentwurf der SED
- 1.2 Der Volksentscheid in Hessen. Die westzonalen Länderverfassungen
- 1.3 Das Ringen um Enteignung der Monopole in den Westzonen
- 1.4 Entflechtung und paritätische Mitbestimmung in den Westzonen. Das Ahlener Programm der CDU
- 1.5 Für und wider den Volksentscheid über Deutschlands Zukunft. Die Interzonenkonferenzen der deutschen Gewerkschaften
- 1.6 Die Auflösung des Staates Preußen
- 1.7 Der Bericht des Alliierten Kontrollrates über den Stand der Erfüllung des Potsdamer Abkommens
- 1.8 Die Moskauer Tagung des Rates der Außenminister
Das Dokument „Grundrechte des deutschen Volkes“ und der Verfassungsentwurf der SED
Im Vorfeld der für März 1947 vorgesehenen Moskauer Konferenz des Rates der Außenminister, auf der Grundfragen eines deutschen Friedensvertrages und der politisch-staatlichen Organisation Deutschlands behandelt werden sollten, wurde es zum Gebot für alle patriotischen Kräfte des deutschen Volkes, sich um verantwortungsbewußte nationale Verständigung und Aktionen über die Zonengrenzen hinweg zu bemühen. In ihrem am 19. September 1946 in Vorbereitung auf die Wahlen in der Ostzone veröffentlichten Dokument „Die Grundrechte des deutschen Volkes“ unterbreitete die SED, deren Parteivorstand sich seit Ende Juni 1946 intensiv mit Fragen der Gestaltung des künftigen deutschen Staates und des Weges dorthin beschäftigt hatte, Vorschläge dafür sowie für die verfassungsmäßigen Grundlagen dieses Staates. Sie sprach sich für die Schaffung einer einheitlichen, demokratischen Republik, gegliedert in Länder, aus, in der die Volksvertretung als höchstes Staatsorgan fungiert, das Wirtschaftsleben nach den Grundsätzen sozialer Gerechtigkeit gestaltet wird, der Großgrundbesitz aufgelöst ist und keine privaten Konzerne, Großbanken, Kartelle und Syndikate bestehen, jeder Bürger ein Recht auf Arbeit, Erholung und soziale Versorgung sowie das gleiche Recht auf Bildung hat. „Die Säuberung der Verwaltung und der Wirtschaftsorgane von Militaristen und aktiven Verfechtern der hitlerschen Kriegsund Gewaltpolitik, die Enteignung der militaristischen Großgrundbesitzer und die Übereignung der Betriebe der Kriegsverbrecher und aktiven Nazis an die Landesverwaltungen muß der nächste gemeinsame Schritt aller friedliebenden, demokratischen Kräfte sein“!, hieß es in dem Dokument.
Als einen weiteren Schritt forderte die SED die Bildung deutscher Zentralverwaltungen. Sie warnte vor föderalistischen und separatistischen Bestrebungen, vor der Aufteilung Deutschlands in Einzelstaaten, von der sich Konzernund Bankherren, Junker und Großgrundbesitzer die Rettung ihrer Machtpositionen erhofften, und vor der Zerreißung Deutschlands in „ein östliches und westliches Gebiet“.
Die SED stellte fest, nur durch den „Aufbau einer friedlichen Ordnung“ könne das deutsche Volk „das Vertrauen der anderen Völker wiedererwerben, zur Bildung einer gesamtdeutschen Regierung ermächtigt“ werden und „die Aussicht erhalten, bei den künftigen Friedensverhandlungen gehört zu werden“ ?, und appellierte an alle antifaschistisch-demokratischen Parteien und Organisationen, ihre gemeinsamen Anstrengungen dafür zu verstärken.
Der Parteivorstand verband diese bedeutsame politische Initiative mit dem Bestreben — wie Otto Grotewohl auf der 6. Tagung im Oktober 1946 darlegte -, die Diskussion über die „Grundrechte des deutschen Volkes“ in einem „großen Kongreß aller Parteien aus allen Zonen in Berlin ausmünden“* zu lassen. Das hätte es ermöglicht, eine abgestimmte Standpunktbildung über die Grundlagen und den Aufbau eines künftigen deutschen Staates zu erreichen und zugleich die Bildung einer Repräsentation des deutschen Volkes für künftige Friedensverhandlungen vorzubereiten.
Während die bürgerlichen Parteiführungen in den Westzonen auf die Initiative der SED mit der Methode des Ignorierens und des Totschweigens reagierten, bekräftigte die Führung der SPD in aller Offenheit ihre ablehnende Haltung zu Verhandlungen mit der SED. Sie diffamierte die antifaschistisch-demokratischen Verhältnisse im Osten Deutschlands als undemokratisch und als Einparteiendiktatur der SED. Dieses Vorgehen traf sich mit den Bemühungen von Kreisen der Westalliierten und der westzonalen Bourgeoisie, die Westzonen gegen die von den grundlegenden Umgestaltungen in der Ostzone ausgehenden Einflüsse abzuschotten und ihre separate Entwicklung zu forcieren. Die westzonalen Parteiführungen — mit Ausnahme der KPD schritten den politischen Aktionsraum für die Herstellung der demokratischen Einheit Deutschlands bewußt nicht aus und orientierten sich statt dessen auf die Bizonenentwicklung.
 Im November 1946 unterbreitete der Parteivorstand der SED den Entwurf einer Verfassung für die deutsche demokratische Republik, der auf den „Grundrechten des deutschen Volkes“ basierte. Dieser Verfassungsentwurf umfaßte 109 Artikel und war in sieben Abschnitte gegliedert: die Grundlagen der Staatsordnung; Grundrechte und Grundpflichten der Bürger; das Parlament der Republik; Regierung der Republik; Rechtspflege; Verwaltung; Länder, Kreise und Gemeinden. Der Entwurf lehnte sich an die Weimarer Verfassung an, berücksichtigte Verfassungsvorstellungen der beiden anderen Blockparteien sowie auch .die Verfassungsdiskussion bzw. -entwicklung in den Ländern der Westzonen. Das Dokument befand sich in Übereinstimmung mit den gemeinsamen Deutschlandbeschlüssen der Alliierten, insbesondere mit dem Potsdamer Abkommen.
Im November 1946 unterbreitete der Parteivorstand der SED den Entwurf einer Verfassung für die deutsche demokratische Republik, der auf den „Grundrechten des deutschen Volkes“ basierte. Dieser Verfassungsentwurf umfaßte 109 Artikel und war in sieben Abschnitte gegliedert: die Grundlagen der Staatsordnung; Grundrechte und Grundpflichten der Bürger; das Parlament der Republik; Regierung der Republik; Rechtspflege; Verwaltung; Länder, Kreise und Gemeinden. Der Entwurf lehnte sich an die Weimarer Verfassung an, berücksichtigte Verfassungsvorstellungen der beiden anderen Blockparteien sowie auch .die Verfassungsdiskussion bzw. -entwicklung in den Ländern der Westzonen. Das Dokument befand sich in Übereinstimmung mit den gemeinsamen Deutschlandbeschlüssen der Alliierten, insbesondere mit dem Potsdamer Abkommen.
Bei Rezeption vieler bürgerlichoder allgemeindemokratischer Verfassungsgebote und -garantien bestand das Hauptmerkmal des Verfassungsentwurfs der SED darin, die notwendigen antifaschistisch-demokratischen Umgestaltungen und Maßnahmen zur Friedenssicherung auf deutschem Boden, einen wirklichen Volksstaat und eine reale Demokratie verfassungsmäBig festzulegen und zu verankern.
Dem diente das Ziel, in Deutschland eine unteilbare, demokratische Republik, gegliedert in Länder, zu errichten, einen dezentralisierten Einheitsstaat, in dem das Parlament als höchstes Machtorgan über die entscheidende Kompetenz verfügt, Gesetze zu erlassen sowie deren Durchführung und damit die Verwaltungsorgane und die Rechtsprechung zu kontrollieren. In Durchsetzung des Prinzips der Volkssouveränität bei Überwindung des bürgerlichen Verfassungsprinzips der sogenannten Gewaltenteilung sollte alle Staatsgewalt vom Volke ausgehen, durch das Volk ausgeübt werden und dem Wohle des Volkes dienen. „Das Volk verwirklicht seinen Willen durch die Wahl der Volksvertretungen, durch Volksentscheid, durch die Mitwirkung an Verwaltung und Rechtsprechung und durch die umfassende Kontrolle der öffentlichen Verwaltungsorgane“ (Artikel 2).° Artikel 21 gebot die entschädigungslose Überführung der Betriebe der Naziund Kriegsverbrecher in Gemeineigentum, Artikel 23 die entschädigungslose Einziehung und die Aufteilung des Großgrundbesitzes im Zuge einer Bodenreform, Artikel 27 bis 30 eine demokratische Umgestaltung des Schulwesens.
Indem der Parteivorstand der SED den Verfassungsentwurf zugleich auch als Grundlage und Leitlinie für die zu erarbeitenden Verfassungen der Länder und Provinzen der Ostzone unterbreitete, verband er den Kampf um die demokratische Einheit Deutschlands konsequent mit der weiteren Ausgestaltung der antifaschistisch-demokratischen Verhältnisse im Osten Deutschlands. Angesichts der Entwicklung in den Westzonen kam es, wie Wilhelm Pieck auf der 5. Tagung des Parteivorstandes im September 1946 erklärte, in der Ostzone immer mehr darauf an, „in den bestehenden Ländern und Provinzen die Grundlagen für den weiteren Aufbau des Staates zu schaffen und dafür entsprechende Verfassungsgrundsätze oder, besser gesagt, eine demokratische Ordnung zu entwikkeln, die unseren Auffassungen entspricht“.
Obwohl der Verfassungsentwurf der SED auch bei den Westalliierten und von nichtkommunistischen politischen Kräften in den Westzonen mit Aufmerksamkeit studiert wurde, suchte man jegliche Öffentliche Diskussion darüber zu vermeiden und wiederum die Taktik des Totschweigens anzuwenden.
Von den Blockparteien beurteilte die LDPD den Entwurf weitgehend positiv. Einwände erhob sie gegen die Aufhebung der Gewaltenteilung sowie gegen eine aus liberal-demokratischer Sicht ungenügende Berücksichtigung individueller Grundund Privateigentumsrechte. Das Streben der LDPD-Führung nach „Reichseinheit“ verband sich mit Vorstellungen von einem zentralisierten deutschen Staat, der sich an den Verfassungsgrundsätzen von Weimar orientieren, aber gemäß den Ergebnissen antifaschistisch-demokratischer Umgestaltungen bis zu einem gewissen Grade über „Weimar hinaus“ gehen sollte. Sozialpolitisch tendierte die LDPD zu dieser Zeit stark in Richtung eines reformierten Kapitalismus — ohne private, aber auch ohne „Staatsmonopole“. Der restaurative Charakter der Entwicklung in den Westzonen wurde nicht erkannt und damit auch nicht die Gegensätzlichkeit zum Weg der Ostzone. Es gab Illusionen hinsichtlich einer über die Zonengrenzen hinweg bestehenden liberal-demokratischen Gemeinsamkeit. Dies trat besonders bei der Bildung einer liberal-demokratischen Arbeitsgemeinschaft deutlich zutage, die am 8. und 9,.November 1946 in Coburg erfolgte, wo -vorbehaltlich der Zustimmung durch den Kontrollrat — auch die Gründung einer „Reichspartei“ beschlossen wurde.
In Verbindung mit der von der CDU formulierten, in deren Reihen unterschiedlich interpretierten und keineswegs unumstrittenen Losung von einem „christlichen Sozialismus“ trat in der Politik dieser Partei — verglichen mit der der LDPD stärker eine sozialreformerische Komponente hervor. Was den staatlichen Aufbau des zukünftigen deutschen Staates anbelangte, so tendierte die CDU der Ostzone in Annäherung an Positionen der westzonalen CDU stärker dahin, den Ländern relativ umfangreiche Rechte und Kompetenzen einzuräumen. Doch ein Konsens zwischen SED, CDU und LDPD war möglich, wie die bei Konstituierung der im Herbst 1946 gewählten Landtage von den drei Parteien und den in den Landtagen vertretenen Organisationen abgegebenen gemeinsamen Erklärungen zur Herstellung der Einheit Deutschlands zeigten.
Der Volksentscheid in Hessen. Die westzonalen Länderverfassungen
Ein Aufschwung antifaschistisch-demokratischer Bestrebungen war seit Herbst 1946 auch in den westlichen Besatzungszonen und ihren Ländern zu verzeichnen. Das zeigte sich nicht zuletzt in den verfassunggebenden Versammlungen der Länder der amerikanischen und der französischen Besatzungszone, die im Herbst 1946 als beratende Landesversammlungen gebildet wurden. Insbesondere in Hessen gelangten hier KPD und SPD zu einer engen Zusammenarbeit. In deren Ergebnis entstand ein Verfassungsentwurf, der über die Weimarer Verfassung hinausging. Das Land Hessen wurde seiner staatsrechtlichen Stellung nach als „ein Glied der deutschen Republik“ (Artikel 64) bestimmt.’ Die Regeln des Völkerrechts sollten bindende Bestandteile des Landesrechts sein. Der Krieg bzw. Kriegsvorbereitungen wurden als verfassungswidrig geächtet. Die Verfassung ging davon aus, daß alle Staatsgewalt durch das Volk ausgeübt wird, und zwar sowohl indirekt — über die Parlamente als auch direkt — durch Volksabstimmung (Volksentscheid) bzw. Einbringen von Gesetzesentwürfen über ein Volksbegehren. Die hessische Verfassung paraphierte eine antimonopolistisch-demokratische Ordnung des sozialen und wirtschaftlichen Lebens, so die Anerkennung des Streikrechts und das Verbot von Aussperrungen; das Prinzip des gleichen Lohns für Frauen und Jugendliche; die gleichberechtigte Mitbestimmung in sozialen, personellen und wirtschaftlichen Fragen des Betriebes durch Betriebsvertretungen im Einvernehmen mit den Gewerkschaften; die Mitbestimmung der Gewerkschaften in allen Wirtschaftsverwaltungen, Lenkungsund Planungsorganen; das Verbot von monopolistischen Machtzusammenballungen und des Mißbrauchs wirtschaftlicher Positionen in bezug auf politische Macht und die Überführung solchen Vermögens in Gemeineigentum, das Eigentum des ganzen Volkes ist und ausschließlich seinem Wohle dienen darf. Artikel 41 bestimmte: „Mit Inkrafttreten dieser Verfassung werden 1. in Gemeineigentum überführt: der Bergbau (Kohlen, Kali, Erze), die Betriebe der Eisenund Stahlerzeugung, die Betriebe der Energiewirtschaft und das an Schienen oder Oberleitungen gebundene Verkehrswesen, 2. vom Staate beaufsichtigt oder verwaltet die Großbanken und Versicherungsunternehmen …“
Artikel 42 legte die Einziehung des Großgrundbesitzes, „der nach geschichtlicher Erfahrung die Gefahr politischen Mißbrauchs oder der Begünstigung militaristischer Bestrebungen in sich birgt, im Rahmen einer Bodenreform“? fest. Artikel 44 bestimmte eine progressive Besteuerung von Vermögen und Einkommen. Dies wurde ergänzt durch solche Festlegungen, daß jeder Mensch ein Recht auf Arbeit habe, daß die Wirtschaft nicht dem Profitstreben, sondern dem Gemeinwohl und der Bedarfslenkung dienen und erforderlichenfalls gelenkt werden müsse.
Die Verfassungen Württemberg-Badens und Bayerns sowie die im Mai 1947 zur Abstimmung vorgelegten Verfassungen der Länder der französischen Zone gingen in ihrer antimonopolistisch-demokratischen Ausrichtung weniger weit als die hessische Verfassung. Dennoch ließ eine Interpretation dieser Verfassungen insgesamt den Schluß zu, daß sie die Schaffung antifaschistisch-demokratischer, mehr oder weniger eindeutig antimonopolistischer Verhältnisse sozialer Gerechtigkeit und Sicherheit nicht nur ermöglichten, sondern sogar geboten. Sie waren auf die Errichtung einer wie immer gestalteten, jedoch dem Frieden, der Demokratie und sozialer Gerechtigkeit verpflichteten Gesellschaftsund Staatsordnung ausgerichtet. Starke Übereinstimmungen mit den Verfassungen, die in den Ländern der Ostzone bis Anfang 1947 fertiggestellt wurden, waren unverkennbar. Allerdings verankerten diese konstitutionell in der Praxis bereits erfolgte oder in Gang befindliche antifaschistisch-demokratische, antimonopolistische Umgestaltungen, was bei den Verfassungen der westzonalen Länder nicht der Fall war. Trotz der auf deutschem Boden eingetretenen Ost-West-Polarisierung waren offensichtlich ein Verfassungskonsens für eine antifaschistisch-demokratische deutsche Republik bzw. eine Mehrheitsbildung dafür zu diesem Zeitpunkt kein unerreichbares Ziel.
Im Zusammenhang mit der Vorbereitung und Durchführung von Volksentscheiden über die Verfassungen kam es in den Ländern der amerikanischen Zone im Spätherbst 1946 zu einer beachtlichen Mobilisierung auch von Teilen der Bevölkerung, die bisher politisch inaktiv gewesen waren. Am stärksten zeigte sich das in Hessen. Die amerikanische Militärregierung forderte hier von der Landesversammlung eine Eliminierung bzw. zumindest Entschärfung des Artikels 41, scheiterte damit aber an der standhaften Haltung von Kommunisten und Sozialdemokraten. Daraufhin ordnete die Militärregierung eine gesonderte Abstimmung über diesen Artikel an. Doch auch auf diese Weise konnte sie ihn nicht beseitigen.
Der Volksentscheid in Hessen über eine antinazistisch-demokratische Verfassung mit antimonopolistischen Verfassungsgeboten gestaltete sich zum Höhepunkt des Ringens um eine antifaschistisch-demokratische Entwicklung als Alternative zu der auf dem Wege befindlichen restaurativen Neuordnung in den Westzonen. Bei einer Beteiligung von 73,2 Prozent der Abstimmungsberechtigten wurden am 1. Dezember 1946 von den gültigen Stimmen 76,8 Prozent für die Verfassung und 72 Prozent speziell für Artikel 41 abgegeben. Dieser klaren gesellschaftspolitischen Willensbekundung kam zweifellos eine grundlegende, keinesfalls auf Hessen beschränkte Bedeutung zu.
Das Ringen um Enteignung der Monopole in den Westzonen
Der politische Aufschwung in den Ländern der Westzonen ging vor allem von der Arbeiterbewegung aus — trotz ihrer parteipolitischen Spaltung.
Im Herbst 1946 zählte die KPD über 200000 Mitglieder und die SPD (ohne die Berliner Organisation) etwa 630000. Den Einheitsgewerkschaften, mit denen auch in den Westzonen die gewerkschaftliche Zersplitterung überwunden wurde, gehörten etwa 3,4 Millionen Arbeiter und Angestellte an.
Während des Generalstreiks von Ruhrbergarbeitern am 3. April 1947
Mit der organisatorischen Entwicklung der westzonalen Gewerkschaften schritt der Prozeß der Herausbildung und festen Verankerung solcher Ziele wie Überführung der Bodenschätze und Schlüsselindustrien in Gemeineigentum, Schaffung einer gelenkten Wirtschaft und Durchsetzung eines umfassenden Mitbestimmungsrechtes der Gewerkschaften in den Betrieben und in überbetrieblichen Lenkungsorganen als gewerkschaftspolitischer Grundsatzforderungen voran.
Die programmatischen Forderungen der westzonalen Sozialdemokratie, die diese auch in Bekundungen nach dem Parteitag in Hannover formulierte, zielten unter der Bezeichnung „Sozialisierung“ zusammengefaßt ebenfalls auf eine Überführung aller Großbetriebe in Gemeineigentum, die bei den Bodenschätzen und Schlüsselindustrien beginnen sollte.
In diesen Zielstellungen gab es in der Arbeiterklasse der Westzonen übereinstimmende oder angenäherte Positionen, so daß — bei allen Unterschieden bzw. Gegensätzen in Fragen von Staat und Macht sowie des Verhältnisses zur Sowjetunion — Möglichkeiten eines gemeinsamen Kampfes dafür bestanden.
Die mit dem Volksentscheid in Hessen gemachten Erfahrungen und die in der organisierten Arbeiterbewegung deutlich in Versammlungen und Demonstrationen sich artikulierende Bereitschaft, auch Formen des außerparlamentarischen Kampfes anzuwenden, wiesen einen Weg, der auch unter der Besatzungsherrschaft der Westmächte Erfolgsaussichten eröffnete.
Davon ging die KPD aus, wenn sie trotz vielfältiger Behinderungen als aktivste und konsequenteste Kraft für antifaschistisch-demokratische Umgestaltung in den Westzonen wirkte. Vor allem konzentrierte sie sich darauf, in den Betrieben und Zentren der Arbeiterklasse um deren Mobilisierung und um Teilerfolge zu ringen. In diesem Sinne beschloß der Bezirksparteitag der KPD Ruhrgebiet am 9. Februar 1947 als Aufgabe, „den notwendigen politischen Druck zu erzeugen, um die ersten Schritte zur Entmachtung der Monopolisten durch Übereignung der Betriebe in die öffentliche Hand zu tun. Wir wollen diese konkreten Schritte gemeinsam mit der Sozialdemokratischen Partei, den Gewerkschaften und den fortschrittlichen Kräften des Bürgertums, die dazu bereit sind, tun.“
Die KPD führte diesen Kampf in den Landtagen, wo sie eine Vielzahl von Gesetzesentwürfen einbrachte oder — wie später in Nordrhein-Westfalen — sozialdemokratische Gesetzesentwürfe unterstützte, indem sie Abstimmungen in einer Reihe von Konzernbetrieben initiierte oder sich daran beteiligte, insbesondere aber indem sie sich an die Spitze von Protestdemonstrationen stellte bzw. diese sowie auch Streiks organisierte. In Versammlungen, auf Kundgebungen und Demonstrationen wurden nicht nur Forderungen im Zusammenhang mit der sich im Winter 1946/47 vor allem im Ruhrgebiet zur Katastrophe gestaltenden Versorgungslage formuliert; gleichzeitig und in zunehmenden Maße traten Forderungen nach Entnazifizierung der Verwaltungen, Mitbestimmung der Gewerkschaften, Enteignung der Naziund Kriegsverbrecher und Überführung ihrer Betriebe bzw. aller Unternehmen der Grundstoffund Schlüsselindustrien in Gemeineigentum in den Vordergrund. Zum Zentrum von Massenbewegungen und gewerkschaftlichen Aktionen wurde das Ruhrgebiet. Die Betriebsräte von sechs Ruhrmontankonzernen initiierten im Dezember 1946 Abstimmungen in allen Konzernbetrieben, bei denen sich eine überwältigende Mehrheit der Arbeiter für die Enteignung der Konzernherren und für erweiterte Mitbestimmungsrechte aussprachen. In den Gruben des Ruhrgebietes fanden ähnliche Aktionen statt. Aus Anlaß des 15. Jahrestages der berüchtigten Industriellentagung in Düsseldorf, auf der am 27. Dezember 1932 Monopolherren einen Pakt mit Hitler geschlossen hatten, führten die Gewerkschaften im Düsseldorfer Raum Protestversammlungen und auch Warnsitzstreiks gegen erneute reaktionäre Umtriebe durch. Auf einer Konferenz sämtlicher Betriebsräte des Groß-Essener Gebietes erhoben diese mit Nachdruck die Forderung, mit der Überführung der Betriebe der Grundstoffund Schlüsselindustrien in Gemeineigentum endlich zu beginnen.
Zum Höhepunkt dieser demokratischen Massenbewegungen wurde der 24stündige Generalstreik der 334000 Ruhrarbeiter am 3. April 1947. Der Streikbeschluß war auf einer Ruhrrevierkonferenz unter maßgeblichem Einfluß des stellvertretenden Vorsitzenden des Industrieverbandes Bergbau der britischen Zone, Willi Agatz (KPD), gegen den Widerstand ihres Vorsitzenden, August Schmidt (SPD), gefaßt worden. Alle Ruhrbergarbeiter schlossen sich diesem Streik an und führten ihn diszipliniert durch. Die Bergarbeiter des Aachener Reviers solidarisierten sich mit den Ruhrkumpeln. Dieser unter westlichen Besatzungsbedingungen nicht erwartete gewaltige Streik ließ aufhorchen und weckte bei allen denen Hoffnung und Bereitschaft, denen es ernst war mit antifaschistischdemokratischen Umgestaltungen.
Während sich die meisten sozialdemokratischen Arbeiter an der Demonstrationsund Streikbewegung beteiligten, standen ihr die Mehrzahl der führenden sozialdemokratischen Funktionäre eher passiv und abwartend, wenn nicht gar ablehnend gegenüber. Die SPD-Führung war offensichtlich so einseitig auf den bürgerlichen Parlamentarismus fixiert, daß ein revolutionäroder radikaldemokratischer Weg für sie nicht in Betracht kam. Eine nicht unerhebliche Rolle für diese Haltung spielte das verzerrte Bild, das sie sich aus ihrem antikommunistischen Blickwinkel heraus von den antifaschistisch-demokratischen Umgestaltungen in der Ostzone machte. Die führenden Sozialdemokraten in der Partei, in den Länderregierungen und in Verwaltungsspitzen hatten ihre antikommunistische und antisowjetische Haltung und in Wechselwirkung damit — ihre „Westorientierung“ zunehmend verstärkt. Die unbedingte Bindung an die Westmächte, vor allem an die USA, untergrub dabei zunehmend die Aussichten auf Realisierung. ihrer Vorstellungen vom „demokratischen Sozialismus“, ihrer Forderungen nach Enteignung der Naziund Kriegsverbrecher und nach Überführung der enteigneten Betriebe in öffentliches Eigentum.
Die Massenbewegungen und insbesondere der Generalstreik der Ruhrbergarbeiter hatten beträchtliche politische Auswirkungen. Die Arbeiterklasse erzielte zwar keinen entscheidenden Erfolg, erkämpfte sich mit diesen Aktionen aber erheblich mehr soziale Rechte und politische Freiheiten, als sie sie allein auf parlamentarischem Wege hätte erreichen können.
Den Massenbewegungen der Werktätigen wurden von den westlichen Besatzungsbehörden durch Verbote rigoros Schranken gesetzt. Selbst vor der Androhung der Todesstrafe schreckten sie nicht zurück. Zugleich wurden eine Vielzahl von Maßnahmen entwickelt und Versprechungen gemacht, um zu beschwichtigen und die Ernährungssituation zu verbessern. „Entflechtung“ der Konzerne und Einführung der paritätischen Mitbestimmung sowie eines Punktesystems zur Erlangung von Sonderrationen für Bergarbeiter und eine großangelegte gezielte Aktion der Verteilung von Nahrungsmittelpaketen, sogenannten Carepaketen aus den USA, gehörten dazu. Vor allem aber waren es das mit dem kalten Krieg entstehende neue politische Klima sowie die damit verbundene Zurückdrängung des Einflusses der KPD und Erhöhung des sozialdemokratischen Einflusses in der westzonalen Arbeiterbewegung, die dazu führten, daß die Massenbewegungen im Frühjahr 1947 ziemlich schnell abebbten bzw. abgeblockt werden konnten. Damit wurde die Alternative zum Weg restaurativer Neuordnung in den Westzonen an einem entscheidenden Zeitpunkt verbaut.
Bei den Landtagswahlen in den Ländern der britischen Zone und den Bürgerschaftswahlen in Hamburg am 20. April 1947 erzielte die KPD in Nordrhein-Westfalen mit 14 Prozent Stimmenanteil ihr bestes Ergebnis. Bei den Bürgerschaftswahlen in Hamburg konnte sie 10 Prozent, bei den Landtagswahlen in Niedersachsen und in Schleswig-Holstein nur 5,7 bzw. 4,8 Prozent der Stimmen erlangen. Die SPD erreichte in Hamburg, Niedersachsen und Schleswig-Holstein zwischen 43 und 44 Prozent der Stimmen, in Nordrhein-Westfalen 32 Prozent. Hier wurde die CDU mit 37,5 Prozent zur wählerstärksten Partei. Dies gelang ihr auch in allen drei Ländern der französischen Besatzungszone bei den Landtagswahlen am 18. Mai 1947, wobei sie in den Landtagen von Südbaden und Württemberg-Hohenzollern absolute Mehrheiten erlangte.
Entflechtung und paritätische Mitbestimmung in den Westzonen. Das Ahlener Programm der CDU
Mit Bezugnahme auf das Potsdamer Abkommen erließ die britische Militärregierung mit Wirkung vom 12. Februar 1947 ihre Verordnung Nr. 78, in der die Beseitigung der deutschen Monopolvereinigungen auf dem Wege der „Entflechtung“ festgelegt wurde. Die amerikanische Militärregierung schloß sich diesem Vorgehen am gleichen Tage mit ihrem Gesetz Nr. 56 an, und im Mai 1947 erließ auch die französische Militärregierung eine gleichgeartete Verordnung Nr. 96.
In einer bereits zuvor herausgegebenen Presseverlautbarung erklärte die britische Militärregierung im Köntext zu den Entflechtungsplänen: „Die durchgeführten Maßnahmen werden in keiner Weise die Schritte vorwegnehmen oder behindern, die jetzt unternommen werden, um in Übereinstimmung mit der von der britischen Regierung verfolgten Politik unter anderen Industrien auch die Eisenund Stahlindustrie in Gemeinbesitz zu überführen.“!! Obgleich bezweifelt werden mußte, daß Großbritannien diese Absicht gegen den Einspruch der USA würde verwirklichen können, verfehlte diese britische Ankündigung gerade in den Entscheidungsmonaten Anfang 1947 ihre Wirkung nicht, ermöglichte sie der SPD und sozialdemokratischen Gewerkschaftsfunktionären die Fortsetzung ihrer Stillhaltepolitik.
Die Entflechtung, die für die Großbanken, den IGFarben-Konzern und die Ruhrmontankonzerne wirksam wurde, änderte nichts an den kapitalistischen Eigentumsverhältnissen und hatte mit einer Beseitigung der deutschen Monopolvereinigungen nichts zu tun. Sie lief lediglich auf eine Dekonzentration der betroffenen Monopole hinaus, die von deutscher Seite mit der Motivation betrieben wurde, optimale BetriebsgröBen und -profilierungen herzustellen, während von alliierter Seite auch das Motiv der Schwächung und Benachteiligung der deutschen Konkurrenz eine wesentliche Rolle spielte. Die Aufrechterhaltung der Beschlagnahme des Eigentums an den entflochtenen Betrieben durch die Westmächte fungierte zugleich als Maßnahme zur Sicherung der Eigentümer gegen Enteignung auf der Basis von Gesetzen westzonaler Landtage.
Die in Aussicht gestellten Entflechtungsmaßnahmen wurden propagandistisch im Sinne einer Beseitigung der deutschen Monopolorganisationen ausgegeben und erfüllten so die wichtige politische Funktion, den antimonopolistischen Forderungen der Werktätigen die Spitze abzubrechen bzw. die Stoßkraft zu nehmen. Dazu sollte vor allem auch das von der britischen Militärregierung gemeinsam mit deutschen Konzernvertretern ausgearbeitete Angebot einer paritätischen Mitbestimmung für die Gewerkschaften in den Betrieben der entflochtenen Montankonzerne beitragen. In einem Schreiben an den Leiter des Verwaltungsamtes für Wirtschaft der britischen Zone, Viktor Agartz, erklärten die Direktoren von Ruhrmontankonzernen offenherzig: „Dabei erfüllt uns die Hoffnung, daß die Verwirklichung unserer aus der allgemeinen Not geborenen Vorschläge eine neue, sichere Vertrauensgrundlage für die Zusammenarbeit zwischen den Werkleitungen und den berufenen Vertretern der Arbeitnehmer und der Allgemeinheit schafft, daß es damit gelingt, unsere für die Gesamtwirtschaft so ungemein wichtige Schlüsselindustrie endlich von einem politischen Odium zu befreien …
Zweifellos wurden durch die in der Montanindustrie beginnende Entflechtung und die Einführung einer Mitbestimmung der Gewerkschaften in den Aufsichtsräten der entflochtenen Gesellschaften durch deren paritätische Besetzung mit Gewerkschaftsvertretern, der sogenannten paritätischen Mitbestimmung, Hoffnungen geweckt und die Positionen der sozialreformerischen Arbeiterbewegung gestärkt. Entflechtung und Mitbestimmung erwiesen sich als teils von den Umständen erzwungener, teils strategisch bewußt gegangener verschlungener Weg zur Wiederherstellung eines reformierten Systems des staatsmonopolistischen Kapitalismus in den Westzonen. Diese, von deutschen Konzernkreisen noch während des zweiten Weltkrieges ausgearbeitete und auf westalliierte Pläne abgestimmte Restaurationsstrategie akzentuierte sich in der Öffentlichkeit zunächst stark „gemeinwirtschaftlich“ und erst später deutlich neoliberal.
Anfang 1947 war es vor allem die CDU der britischen Zone, die mit einer verbalen, jedoch massenwirksamen Monopolund sogar Kapitalismuskritik gesellschaftspolitische Leitbilder prägte, die die restaurative Neuordnung verschleierten und zugleich förderten. Die CDU der britischen Zone bekannte sich in ihrem Anfang Februar 1947 in Ahlen vom Zonenausschuß beschlossenen Wirtschaftsprogramm zu einer gemeinwirtschaftlichen Ordnung jenseits des Kapitalismus, der am Faschismus Schuld trage. Mit dem Ahlener Programm, das sie mit Losungen wie „Sozialisierung im Sinne der CDU“!? oder „CDU überwindet Sozialismus und Kapitalismus“ !* propagierte, ging sie in die bevorstehenden Landtagswahlen, und im Kontext dazu brachte ihre Fraktion im Landtag von Nordrhein-Westfalen am 5. März 1947 Gesetzesentwürfe „Zur Änderung der Besitzund Machtverhältnisse in der Wirtschaft“!° und „Zur Planung und Lenkung der Wirtschaft“!° ein. Mit alledem verfolgten die großbürgerlichen Führungskräfte der CDU das Ziel, eine entschädigungslose Enteignung der großkapitalistischen Nazi- und Kriegsverbrecher und die Überführung ihrer Betriebe in Gemeineigentum zu verhindern bzw. zu unterlaufen, die sie angesichts der starken antinazistisch-demokratischen, antimonopolistisch akzentuierten Erwartungshaltungen und Bestrebungen selbst im bürgerlichen Lager befürchten mußten.
Die KPD unterzog auf ihrer interzonalen Wirtschaftskonferenz am 19. März 1947 in Kassel die Entflechtungspolitik einer umfassenden Kritik und hob hervor: „Ähnlich wie nach 1918 versucht der Monopolkapitalismus seine Schuld zu verschleiern und sich äußerlich anzupassen, um Zeit zu gewinnen. Seine Vertreter sprechen von ‚gemischtwirtschaftlichen‘ Betrieben, von einer Gewinnbeteiligung der Arbeiter und wollen im Grunde nichts anderes als die Rettung ihrer Konzerne. Heinrich Dinkelbach, der Hauptorganisator der Vereinigten Stahlwerke, ‚entflechtet‘ in eigener Regie die westdeutschen Konzerne, um sie vor der Enteignung und Auflösung zu retten.“
Für und wider den Volksentscheid über Deutschlands Zukunft. Die Interzonenkonferenzen der deutschen Gewerkschaften
In der Phase unmittelbar vor Beginn der Moskauer Konferenz des Rates der Außenminister verstärkte die SED ihren Kampf für die Herstellung der demokratischen Einheit Deutschlands. Die Beratungen, die erstmals eine unter Leitung von Wilhelm Pieck und Otto Grotewohl stehende Delegation des Parteivorstandes der SED in der Zeit vom 30.Januar bis 7.Februar 1947 in Moskau mit Mitgliedern des Politbüros der KPdSU(B), vor allem mit J. W. Stalin, führen konnte, ermöglichten eine enge Abstimmung dieses Kampfes mit der sowjetischen Deutschlandpolitik.
SED und KPD beschlossen am 14. Februar 1947 in Berlin, eine Arbeitsgemeinschaft beider Parteien zu bilden, die es als ihr entscheidendes Anliegen betrachtete, „die Einheit der deutschen Arbeiterbewegung über die Zonengrenzen hinweg“!® als Voraussetzung für die demokratische Einheit Deutschlands herzustellen.
Der Parteivorstand der SED deckte am 23. Januar 1947 in seiner Stellungnahme „Deutschland vor der Moskauer Konferenz“ mit Blick auf das am 1. Januar erfolgte Inkrafttreten des Bizonenvertrages den restaurativen Inhalt der damit verbundenen Prozesse auf und warnte vor der Gefahr der Spaltung Deutschlands. Er zog jedoch nicht die Schlußfolgerung, eine solche Entwicklung als unausweichlich zu betrachten, sondern hielt sie angesichts des Aufschwungs der Aktionseinheit der Arbeiterklasse und antifaschistischdemokratischer Bestrebungen für noch aufzuhalten bzw. für umkehrbar. Auch schien ein — zumindest partieller — Erfolg der Moskauer Konferenz durchaus wahrscheinlich.
Der Parteivorstand der SED reagierte positiv auf Initiativen der LDPD und auch der interzonalen Arbeitsgemeinschaft CDU/CSU, Spitzengespräche zwischen den Parteiführungen aller Zonen zu führen. Doch alle diese Pläne scheiterten an der strikten Ablehnung des SPD-Vorsitzenden Kurt Schumacher, die SED überhaupt als Gesprächspartner zu akzeptieren. Adenauer und andere, ebenfalls solchen Gesprächen widerstrebende Westzonenpolitiker hatten das einkalkuliert.
Auch die Bemühungen um die Bildung einer liberal-demokratischen „Reichspartei“ kamen nicht entscheidend voran. Auf seiner Tagung in Rothenburg ob der Tauber am 15. und 16. März 1947 beschloß der Koordinierungsausschuß zwar die Bildung einer „Demokratischen Partei Deutschlands“ mit den gleichberechtigten Vorsitzenden Theodor Heuss und Wilhelm Külz; es gelang jedoch nicht, eine gemeinsame politische Plattform zu schaffen. So wurde festgelegt, daß die liberalen Parteien jeweils in ihrer Zone bzw. in ihrem Land wie bisher weitgehend unabhängig bei der Festlegung ihrer Politik bleiben sollten. Die zutage tretenden Meinungsverschiedenheiten waren grundlegender Art und damit größer, als man es sich eingestehen wollte. Auf Grund eines französischen Vetos im Alliierten Kontrollrat unterblieb schließlich die Zulassung der Demokratischen Partei Deutschlands. Die Partei führte ein Scheindasein, bis sie Anfang 1948 auch formal aufgelöst wurde.
Der Parteivorstand der SED ergriff am 1. März 1947 abermals die Initiative und schlug die Durchführung eines Volksentscheids in allen Zonen vor. Dabei sollte über die Bildung eines demokratischen Einheitsstaates entschieden werden, in dem Verwaltung und Wirtschaft entnazifiziert und demokratisiert sind, eine demokratische Bodenreform durchgeführt wird, Banken und Konzerne in Öffentliches Eigentum überführt werden, die Gewerkschaften über weitgehende Mitbestimmungsrechte verfügen und die Wirtschaft nach einem Plan gelenkt wird. Dieser Vorschlag der SED wies einen gangbaren, demokratischen Weg zur Entscheidung über die Zukunft Deutschlands. Er war zudem wahrscheinlich der einzige Weg, der es noch ermöglicht hätte, über Meinungsverschiedenheiten hinweg zu einer Regelung der deutschen Frage auf einer Viermächtegrundlage zu gelangen.
Kundgebung auf dem Römerberg in Frankfurt am Main, 9. März 1947. Otto Grotewohl spricht zum Thema „Um Deutschlands Zukunft“.
Die vier Mächte vertraten hinsichtlich des Aufbaus eines zukünftigen deutschen Staates unterschiedliche Auffassungen. Während die UdSSR einen dezentralisierten Einheitsstaat für wünschenswert erachtete, verfolgten Großbritannien und die USA bundesstaatliche Pläne, und Frankreich wollte nur der Errichtung eines deutschen Staatenbundes zustimmen. Die den Prinzipien und Zielen der Antihitlerkoalition entsprechende Problemlösung konnte nur darin bestehen, das deutsche Volk auf der Grundlage des Potsdamer Abkommens in Wahrnehmung seines Selbstbestimmungsrechtes entscheiden zu lassen.
Im Zuge eines Auseinandersetzungsund Klärungsprozesses, der sich namentlich auch unter dem Eindruck der breiten Zustimmung vollzog, die der Vorschlag der SED in der Bevölkerung fand, gab der Parteivorstand der LDPD seinen anfänglichen Widerstand gegen den Volksentscheid auf und forderte im Unterschied zum Parteivorstand der CDU in einem Beschluß am 9. April 1947 alle Liberaldemokraten auf, sich dafür einzusetzen.
In den Westzonen dagegen wurde der Vorschlag der SED teils totgeschwiegen, teils verdächtigt. Er stieß bei den maßgebenden bürgerlichen und sozialdemokratischen Politikern auf völlige Ablehnung. So wurden von westzonaler Seite zu einem Zeitpunkt, als noch Chancen bestanden, der Spaltung Deutschlands zu begegnen, alle dahingehenden Initiativen negiert und „äußerste Zurückhaltung“ geübt.
Dessenungeachtet fanden seit November 1946 zwischen den Repräsentanten der deutschen Gewerkschaftsverbände Interzonenkonferenzen statt: die erste am 7. und 8.November 1946 in Mainz, die zweite am 18. und 19. Dezember 1946 in Hannover und die dritte vom 10. bis 12. Februar 1947 in Berlin. Auf den Konferenzen kam es zu einem erfolgversprechenden Meinungsaustausch über grundlegende Gewerkschaftsfragen mit dem Ziel, die Gewerkschaftseinheit über die Blick in den Tagungsraum der III. Interzonenkonferenz der deutschen Gewerkschaften in Berlin, 10. bis 12. Februar 1947.
Links: die Delegation der amerikanischen Zone mit Fritz Tarnow, Willi Richter und Lorenz Hagen (v. |, n. r.); gegenüber: die Delegation des FDGB mit Herbert Warnke (vorn), Adolf Kaufmann, Roman Chwalek, Hermann Schlimme; im Präsidium stehend: Hans Jendretzky, Leiter der FDGB-Delegation
Zonengrenzen hinweg zu verwirklichen; auch wurden Kontakte zum Weltgewerkschaftsbund hergestellt. Die Gewerkschafter formulierten gemeinsame Positionen zu Grundfragen der deutschen Nachkriegsentwicklung und zu den Grundlagen eines künftigen deutschen Staates, an deren Zustandekommen die Repräsentanten des FDGB, vor allem Hans Jendretzky, Bernhard Göring, Roman Chwalek und Herbert Schlimme, einen wesentlichen Anteil hatten. In einer von der III. Interzonenkonferenz der deutschen Gewerkschaften verabschiedeten Entschließung über die Mitbestimmungsrechte der Gewerkschaften und Betriebsräte in der Wirtschaft hieß es: „Zwei Weltkriege haben den Beweis erbracht, daß die zum Kriege treibenden Kräfte in Deutschland in der Zusammenballung der Kapitalmächte in Monopolen, Kartellen, Konzernen und Trusts und in dem Mißbrauch ihrer wirtschaftlichen Vormachtstellung zu suchen sind … Die Entmachtung der Monopole, Kartelle und Konzerne gemäß den Potsdamer Beschlüssen ist dringend notwendig…“
Die IV. Interzonenkonferenz, die vom 6. bis 8. Mai 1947 in Garmisch-Partenkirchen stattfand, verabschiedete eine Entschließung zur Neugestaltung der deutschen Wirtschaft. Ihre Hauptforderungen lauteten: Herstellung der wirtschaftlichen und politischen Einheit Deutschlands; Aufbau eines Systems geplanter und gelenkter Wirtschaft; Vergesellschaftung der für die Lenkung der Gesamtwirtschaft wichtigen Schlüsselindustrien sowie der Kreditund Versicherungsinstitute; volle gewerkschaftliche Mitbestimmung; Durchführung einer demokratischen Bodenreform. „Die Interzonenkonferenz der deutschen Gewerkschaften“, hieß es in der Entschließung, „sieht mit Besorgnis, daß die am Hitlerregime und dem Krieg hauptverantwortlichen reaktionären und militaristischen Kräfte, die im Monopolkapitalismus und der Verwaltung verankert waren, ihre Position zum Teil halten bzw. versuchen, sie zurückzugewinnen. Daher ist die sofortige Durchführung der von den Gewerkschaften gestellten Forderungen eine zwingende Notwendigkeit.“
Trotz Meinungsunterschieden in einer Reihe gewerkschaftlicher und politischer Fragen gelang es, in solchen gesellschaftspolitischen Grundfragen wie Gemeineigentum, Wirtschaftsplanung und Mitbestimmung der Gewerkschaften übereinstimmende Kampfpositionen der deutschen Gewerkschaften zu formulieren.
Die Auflösung des Staates Preußen
Am 25. Februar 1947 erließ der Alliierte Kontrollrat das Gesetz Nr. 46 über die Auflösung des Staates Preußen. In der Begründung hieß es ganz im Geiste der Potsdamer Beschlüsse: „Der Staat Preußen, der seit jeher Träger des Militarismus und der Reaktion in Deutschland gewesen ist, hat in Wirklichkeit zu bestehen aufgehört. Geleitet von dem Interesse an der Aufrechterhaltung des Friedens und der Sicherheit der Völker und erfüllt von dem Wunsche, die weitere Wiederherstellung des politischen Lebens auf demokratischer Grundlage zu sichern, erläßt der Kontrollrat das folgende Gesetz …”
Mit diesem Gesetz wurde rechtlich sanktioniert, was seit 1945 schon Realität war. Mit dem Untergang des Deutschen Reiches war auch der Staat Preußen untergegangen. Es gab keine preußische Staatsgewalt und kein preußisches Staatsgebiet mehr. In der Ostzone waren aus ehemaligen preußischen Provinzen bzw. westlich der Oder-Neiße-Grenze gelegenen Teilen davon und unter Hinzufügung anderer Gebiete die Provinz Sachsen bzw. — später kurzfristig so genannt — Sachsen-Anhalt und die Provinz Mark Bandenburg entstanden. Restliche Teile preußischer Provinzen wurden auch in die Länder Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen und Thüringen eingefügt. In der britischen und der französischen Zone war bereits im Sommer 1946 — sozusagen im Vorgriff — eine territorial-administrative Neugliederung durch die Bildung der Länder Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen bzw. durch die des Landes Rheinland-Pfalz erfolgt.
Das Kontrollratsgesetz Nr. 46 setzte nun den staats- und völkerrechtlichen Schlußpunkt. Damit wurde auch ein neuer Ausgangspunkt für den staatlichen Aufbau des neuen Deutschlands geschaffen. Die nunmehr vollständig und rechtlich sanktionierte Beseitigung eines solchen Kriegsherdes, als der sich der preußische Staat mit seinem militaristischen Potential und Geist sowie seinen entsprechenden Traditionen erwiesen hatte, war ein wichtiger Akt zur wirklichen Friedenssicherung im Interesse Europas.
Mit der Auflösung Preußens ging ein über Jahrhunderte mit „Blut und Eisen“ geschriebenes Kapitel deutscher Geschichte zu Ende. Wenn sich mit der Geschichte Preußens auch die bleibenden historischen Leistungen der preußischen Reformpolitik, Kämpfe, Siege und Niederlagen der deutschen Arbeiterbewegung sowie ein vielfältiges geistig-kulturelles Erbe verbanden, das es zu bewahren und zu pflegen galt und das für ein neues, demokratisches Deutschland unverzichtbar war, so waren doch aus der Sicht von 1945 für die Beurteilung der Rolle dieses Staates in der Geschichte die katastrophalen Folgen ausschlaggebend, zu denen die Verpreußung Deutschlands, die Verbindung von preußischem Militarismus und deutschem Imperialismus, ja Faschismus für das deutsche Volk und seine Nachbarvölker, für die Welt und den Weltfrieden geführt hatten. Zu Recht war es daher ein wichtiges Kriegsziel der Völker der Anti-Hitler-Koalition gewesen, den Staat Preußen, der sich als ein Machtinstrument des preußisch-deutschen Militarismus erwiesen hatte, zu zerschlagen.
Mit ihrem Befehl Nr. 180 vom 21. Juni 1947 bestätigte die SMAD die von den Landtagen der Provinzen Mark Brandenburg und Sachsen-Anhalt nach Auflösung des Staates Preußen beschlossene Umwandlung dieser Provinzen in Länder. Gemäß diesem Befehl bestand die sowjetische Besatzungszone nunmehr aus den fünf Ländern Brandenburg, Mecklenburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen.
Der Bericht des Alliierten Kontrollrates über den Stand der Erfüllung des Potsdamer Abkommens
In Vorbereitung der Moskauer Konferenz des Rates der Außenminister hatte der Alliierte Kontrollrat den Auftrag zu erfüllen, detailliert über den Stand der Verwirklichung der Potsdamer Beschlüsse in den einzelnen Besatzungszonen und in Deutschland als Ganzem zu berichten. Seit Ende 1946 leisteten die Stäbe der Oberbefehlshaber, die Militärregierungen und der Apparat des Kontrollrates hierfür eine intensive Arbeit. Die Entwürfe der einzelnen Teile des Berichts wurden in den zuständigen Direktoraten, dann im Koordinierungsausschuß und schließlich im Kontrollrat selbst diskutiert. Der Bericht im Umfang von mehreren hundert Seiten gliederte sich in die neun Sektionen Demilitarisierung, Entnazifizierung, Demokratisierung, ökonomische Probleme, Reparationen, Zentralverwaltungen, Umsiedlung, territoriale Neuordnung, Liquidierung des Staates Preußen.
Der Viermächteausschuß für Luftsicherheit tagt in Berlin, Dezember 1946
Die Aufgabe, einen gemeinsamen Bericht des Kontrollrates abzufassen, erwies sich nicht nur wegen des sehr unterschiedlichen Standes der Erfüllung der Potsdamer Beschlüsse in den einzelnen Zonen als schwierig, sondern mehr noch wegen der unterschiedlichen Auffassungen darüber, wie der erreichte Stand einzuschätzen war und worin die Gründe für das Defizit in bezug auf die Behandlung Deutschlands als Ganzes lagen. Damit verbanden sich die schon zuvor zunehmend deutlich gewordenen unterschiedlichen Interpretationen einer Reihe von Festlegungen des Potsdamer Abkommens.
Die unterschiedlichen Positionen der vier Mächte und die zwischen ihnen aufgebrochenen Meinungsverschiedenheiten führten zu zum Teil heftigen Kontroversen bei der Abfassung des Berichtes, und es erhob sich schließlich die Frage, ob das Zustandekommen eines gemeinsamen Papiers überhaupt noch möglich sei. Es war in hohem Maße dem Bemühen der sowjetischen Kontrollratssektion zu danken, daß daran festgehalten wurde. Das festigte die Viermächteverwaltung und die Positionen derjenigen, die eine Viermächteregelung der deutschen Frage anstrebten. Um die Meinungsverschiedenheiten überbrücken zu können, wurde jeder Sektion die Möglichkeit eingeräumt, dem vereinbarten gemeinsamen Text gesonderte Stellungnahmen hinzuzufügen. Davon machten die Westmächte vor allem in bezug auf das Nichtzustandekommen der deutschen Wirtschaftseinheit und eines Export-Import-Planes Gebrauch, für das sie der sowjetischen Reparationspolitik die Hauptschuld anzulasten suchten.
Es war bezeichnend, daß die Westmächte, da sie die Potsdamer Beschlüsse zum Ausgangspunkt nehmen mußten, kaum einen Ansatzpunkt fanden, die Politik der SMAD bzw. die antifaschistisch-demokratische Entwicklung in der sowjetischen Besatzungszone ernsthaft zu kritisieren. Und so sehr sie sich auch bemühten, für die Westzonen ebenfalls einen guten Erfüllungsstand herauszustreichen: es wurde doch selbst in ihren eigenen Berichten — ein besorgniserregendes Defizit deutlich. Während die sowjetische Sektion eine überzeugende Fülle von Ergebnissen bei der Realisierung der auf der Konferenz vereinbarten Potsdamer Beschlüsse auflisten konnte, vermochten die Westmächte — wie bei der Bodenreform — meist nur auf Absichtserklärungen,-Beschlußfassungen und Teilmaßnahmen zu verweisen.
Entlassene oder nicht wieder eingestellte bzw. ausgeschlossene Nazis
Zu Recht kritisierte die sowjetische Sektion in gesonderten Stellungnahmen den Stand und die Praxis der Entnazifizierung und der Bodenreform sowie die Wahlgesetze in den Ländern der Westzonen, die Haltung der Westmächte in den Fragen der Beseitigung von Monopolvereinigungen, der Bildung von deutschen Zentralverwaltungen und der Erfüllung der deutschen Reparationsverpflichtungen.
Für die sowjetische Besatzungszone konnte eine gute und überzeugende Zwischenbilanz in bezug auf Faschismusund Militarismusbewältigung und demokratischen Neuaufbau dargelegt werden. Neben den grundlegenden Umgestaltungen in der gesellschaftlichen und politisch-staatlichen Struktur gehörten dazu auch die gründliche Säuberung von Verwaltungen, Gerichten, Schulen, Hochschulen und leitenden Stellungen in der Wirtschaft von ehemals aktiven Nazis sowie der Aufbau einer neuen Polizei. Insgesamt waren in der sowjetischen Besatzungszone per 1. Januar 1947 bisher 390478 ehemalige Nazis entlassen bzw. nicht wieder eingestellt worden, während 162 692 nominelle Nazis vorübergehend noch im Dienst belassen wurden. Sie verteilten sich wie folgt auf die verschiedenen Institutionen bzw. Organisationen:

Die Gesamtzahl von 162 692 Ende 1946 noch in öffentlichen und halböffentlichen Ämtern und in bestimmten Positionen in Wirtschaft und Handel weiterbeschäftigten nominellen Nazis ergab sich vor allem wie die Tabelle auswies — aus den relativ hohen Zahlen von Weiterbeschäftigten bei der Reichsbahn und der Post sowie in der Wirtschaft. Von den Entscheidungspositionen waren ehemalige Nazis in der sowjetischen Besatzungszone rigoros entfernt, und in den höheren Verwaltungen war der Prozentsatz ehemaliger Nazis, die als Fachleute weiterbeschäftigt wurden, auoßerordentlich stark reduziert worden. So betrug der Anteil ehemaliger NSDAP-Mitglieder unter den 58336 Angestellten der Landesregierung Sachsen und der ihr direkt unterstellten Körperschaften Ende 1946 nur noch 5,9 Prozent, im Apparat der Landesregierung 1,3 Prozent. Alle leitenden Positionen waren mit erwiesenen Antifaschisten, die zum großen Teil aus der Arbeiterbewegung kamen, besetzt. Von 2280 Landräten, Oberbürgermeistern und Ratsmitgliedern waren nur noch 10 (0,4 Prozent), von 40.048 Angestellten im öffentlichen Dienst nur noch 2810 (7,0 Prozent) ehemalige Mitglieder der NSDAP, darunter der überwiegende Teil Jugendliche, die unter die Jugendamnestie fielen.
Die Westmächte gaben im Bericht des Kontrollrates an, in der amerikanischen Zone 373762 ehemalige Nazis entfernt oder ausgeschlossen zu haben, in der britischen Zone 192692 und in der französischen Zone 63496. Diese Zahlen reflektierten jedoch keine echte Säuberung von Nazis. Die in der einen Zone oder dem einen Land entfernten Nazis fanden oft in einer anderen Zone bzw. einem anderen Land wieder Anstellung. In der Wirtschaft wurden vielfach die Manager weiterbeschäftigt und nur nach außen hin als Pförtner usw. eingestuft. Die Statistik wies aus, daß in der britischen Zone per 31. Mai 1947 90 Prozent der Beamten des höheren und des gehobenen Dienstes bereits vor 1945 Beamte?* — und das hieß in der Regel zumindest nominelle Mitglieder der NSDAP gewesen waren. Besonders die zonalen und bizonalen Ämter waren bis in ihre Leitungen hinein in einem hohen Grad mit ehemaligen Nazis durchsetzt.
Die Moskauer Tagung des Rates der Außenminister
Vom 10. März bis zum 24. April 1947 fand in Moskau die vierte Tagung des Rates der Außenminister der Hauptmächte der Antihitlerkoalition statt. Während die sowjetische Delegation am Abschluß eines deutschen Friedensvertrages bzw. an einer Viermächteregelung der deutschen Frage weiterhin interessiert war und konstruktive Vorschläge hierfür unterbreitete, war bei den Westmächten das Gegenteil der Fall. Der Verlauf der Moskauer Konferenz signalisierte den vollzogenen Übergang der Westmächte vom Kooperationskurs zu einer Konfrontationspolitik, in der die Westblockbildung obenan stand.

Am Beginn wurde der Bericht des Alliierten Kontrollrates für Deutschland beraten. Wie schon bei der Abfassung des Berichtes traten übereinstimmende und unterschiedliche Standpunkte zutage. Im Ergebnis der Diskussion wurden der Bericht und damit die Viermächteverwaltung in ihrer Existenz und Tätigkeit bestätigt. Der Rat der Außennminister erteilte dem Kontrollrat Direktiven, die Entmilitarisierung Deutschlands bis zum 31. Dezember 1948 abzuschließen, die Entnazifizierung zu beschleunigen, die Durchführung der Bodenreform in ganz Deutschland noch im Jahre 1947 zu bewirken und den freien Austausch von demokratischen Druckerzeugnissen zwischen den Zonen zu gewährleisten. Das war zugleich eine indirekte Bestätigung und Anerkennung dessen, was in der Ostzone vollzogen worden war, und eine ebenso indirekte Kritik am Stand der Erfüllung der Potsdamer Beschlüsse in den Westzonen.
Zur Diskussion über die Regelung der deutschen Frage legte die sowjetische Delegation zwei Dokumente vor: „Über Form und Umfang der zeitweiligen politischen Organisation Deutschlands“ und „Über den Staatsaufbau Deutschlands“. Im erstgenannten Dokument wurde die Notwendigkeit betont, die politische Struktur Deutschlands zu demokratisieren, die Staatsorgane auf der Basis demokratischer Wahlen zu bilden, die nazistische Zentralisierung der Staatsverwaltung zu liquidieren und die Dezentralisierung der Verwaltung, wie sie in der Weimarer Zeit Bestand hatte, wiederherzustellen. Es sollte eine provisorische Regierung geschaffen werden, die in der Lage war, die politische und wirtschaftliche Einheit Deutschlands sicherzustellen und gleichzeitig die Verantwortung dafür zu übernehmen, daß Deutschland seinen Verpflichtungen den alliierten Staaten gegenüber nachkommt. Nach der Bildung deutscher Zentralverwaltungen sollte der Kontrollrat unter Hinzuziehung der demokratischen Parteien, der freien Gewerkschaften und anderer antinazistischer Organisationen sowie von Ländervertretungen eine zeitweilige demokratische Verfassung ausarbeiten. Auf der Grundlage von Wahlen sollte dann eine provisorische deutsche Regierung gebildet werden, der gemäß den Potsdamer Beschlüssen als Hauptaufgabe „die Ausrottung der Überreste des deutschen Militarismus und Faschismus, die Durchführung der allseitigen Demokratisierung Deutschlands und die Verwirklichung von Maßnahmen zur Wiederherstellung der deutschen Wirtschaft sowie die unbedingte Erfüllung der Verpflichtungen gegenüber den verbündeten Staaten“? zu übertragen sei. Schließlich sollte eine Ständige Verfassung Deutschlands dem deutschen Volk zur Bestätigung vorgelegt werden.
Auch der Achtpunkteantrag „Über den Staatsaufbau Deutschlands“ ging von der vollen Verantwortung und Selbstbestimmung des deutschen Volkes aus: „Deutschland wird als einheitlicher, friedliebender Staat, als demokratische Republik mit einem gesamtdeutschen Parlament mit zwei Kammern und einer deutschen Zentralregierung wiederhergestellt, wobei die verfassungsmäßigen Rechte der zum deutschen Staat gehörenden Länder zu sichern sind.“
Die Vertreter der USA, Großbritanniens und Frankreichs wandten sich mit unterschiedlichen Argumenten gegen die Bildung einer deutschen Zentralregierung und gegen die Konstituierung eines Parlaments auf der Grundlage allgemeiner Wahlen. Ebenso lehnten sie nach wie vor einen Volksentscheid des deutschen Volkes ab, den die Sowjetunion zur demokratischen Lösung der unter den Alliierten strittigen Frage des deutschen Staatsaufbaus vorschlug. Der britische Außenminister, Ernest Bevin, führte dazu aus: „Es wird vorgeschlagen, die Deutschen selbst entscheiden zu lassen, aber gerade die Deutschen waren es, die Hitler wählten … Ich bin nicht gewillt, die Sicherheit des von mir vertretenen Landes einer Volksabstimmung durch die Deutschen auszusetzen.“?’ Der französische Außenminister, George Bidault, stimmte dem zu und argumentierte ergänzend, daß eine Volksabstimmung in ganz Deutschland die unentschiedene Frage der Einheit Deutschlands vorwegnehmen würde. US-Außenminister George C. Marshall bezweifelte, „daß das deutsche Volk darauf vorbereitet sei, in dieser Frage verständig zu handeln“.
Immer deutlicher wurde im Verlauf der Verhandlungen, daß die Westmächte an einer Viermächteregelung der deutschen Frage nicht mehr ernsthaft interessiert waren, wenngleich sie sich den gegenteiligen Anschein gaben.
Dies widerspiegelte auch der Plan, den der britische Außenminister Bevin den sowjetischen Vorschlägen entgegenstellte und der zunächst von den USA, später — auf der Londoner Außenministerkonferenz Ende 1947 — auch von der französischen Delegation unterstützt wurde. Der Bevin-Plan war nicht auf den Abschluß eines Friedensvertrages und den Abzug der Besatzungstruppen ausgerichtet, sondern auf eine „zweite Phase der Kontrollperiode“”. Für diese wurden im gleichen Dokument Richtlinien entwickelt, die das Potsdamer Abkommen ersetzen sollten und entscheidende Forderungen, wie die Beseitigung der Monopole, preisgaben. Hinsichtlich eines zukünftigen deutschen Staates war vorgesehen, die Eigenständigkeit der Länder auszubauen und die deutsche Zentralregierung weitgehend zu entmachten. Der Alliierte Kontrollrat sollte von der Kontrolle über die Länderregierungen ausgeschaltet, das Kontrollrecht über diese von den jeweiligen Zonenbefehlshabern wahrgenommen werden. Damit hätten sich die Westmächte für die Zukunft jeweils den alleinigen Einfluß auf ihre Besatzungszonen gesichert.
Im Bevin-Plan wurde der Reparationsfrage eine Schlüsselrolle zugewiesen. So enthielt er nicht nur die Forderung, alle Reparationslieferungen aus der laufenden Produktion bis zum Erreichen einer ausgeglichenen Export-Import-Bilanz zu stoppen, sondern darüber hinaus auch die bisherigen Reparationsentnahmen der Sowjetunion aus ihrer Zone gegen die bisherigen Einfuhrschulden aufzurechnen und die SAG-Betriebe zu beseitigen. Bevin wußte, daß das für die Sowjetunion völlig unakzeptabel war. In der Reparationsfrage bzw. in deren Verbindung mit der ExportImport-Problematik hatten die Westmächte einen Ansatzpunkt gefunden, um die für sie nicht wünschenswerte Viermächteregelung der deutschen Frage verhindern und gleichzeitig der Sowjetunion die Schuld dafür anlasten zu können.
Am 15. April wurden die Beratungen zum Deutschlandproblem von Außenminister Marshall, der den Vorsitz führte, wegen angeblich mangelnder Einigungsmöglichkeiten abrupt abgebrochen und von der Tagesordnung abgesetzt. Die Außenminister beschlossen die Einberufung ihrer nächsten Tagung für den Herbst 1947 nach London und beauftragten ihre Stellvertreter, die Erörterungen über die deutsche Frage fortzusetzen. Die Entscheidung war damit vertagt. Der Abschluß eines deutschen Friedensvertrages mit einer deutschen Regierung blieb aber zweifellos auf Grund der prinzipienfesten, zugleich konstruktiven Haltung der UdSSR in dieser Frage auf der Tagesordnung.
Der Ausgang der Moskauer Konferenz, an die in breiten Kreisen des deutschen Volkes große Hoffnungen geknüpft worden waren, wurde weithin als enttäuschend empfunden. Die Westmächte unternahmen große Anstrengungen, um in der Öffentlichkeit die UdSSR dafür verantwortlich zu machen. Sie lenkten dabei — nicht ohne Erfolg — von den entscheidenden Fragen ab, insbesondere von ihrer Weigerung, das deutsche Volk über seinen Staatsaufbau entscheiden zu lassen, und rückten statt dessen die Reparationen und die Oder-Neiße-Grenze in den Vordergrund.
Das Zentralsekretariat des Parteivorstandes der SED gab in seiner Stellungnahme „Zu den Ergebnissen von Moskau“ eine differenzierte Analyse. Dabei legte es Wert darauf, den Fakt zu betonen, daß sich die Hoffnungen reaktionärer Kreise auf das Auseinanderbrechen der Viermächtekooperation nicht erfüllt hätten. Die SED hob vor allem die auf der Konferenz angesprochene Möglichkeit einer „Steigerung des Produktionsniveaus um das Zweiund Dreifache des friedlichen Bedarfs“? hervor, bekräftigte ihre Forderung nach einem Volksentscheid über die Einheit Deutschlands und den Staatsaufbau und gab ihrer Hoffnung Ausdruck, daß es auf der in Aussicht gestellten Außenministerkonferenz in London zu einer weiter gehenden Verständigung zwischen den vier Mächten kommen werde.
Die Bildung der Länderregierungen, die Erarbeitung von Länderverfassungen und der Ausbau der politischen Organisation in der Ostzone
Inhaltsverzeichnis [verstecken]
- 1 Die Bildung der Länderregierungen, die Erarbeitung von Länderverfassungen und der Ausbau der politischen Organisation in der Ostzone
- 1.1 Die Konstituierung der Landtage und die Regierungsbildung in den Ländern und Provinzen
- 1.2 Die Ausarbeitung und Annahme der Länderverfassungen
- 1.3 Justiz und Polizei im neuen Abschnitt der Demokratisierung
- 1.4 Die Gründung der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes und des Demokratischen Frauenbundes Deutschlands
Die Konstituierung der Landtage und die Regierungsbildung in den Ländern und Provinzen
Nach den konfliktreichen Auseinandersetzungen der Parteien bei den Wahlen trat der zentrale Blockausschuß nach zweimonatiger Unterbrechung am 21. November 1946 erstmals wieder zu einer Beratung zusammen. Die Parteien bekundeten erneut „ihren Willen, die gemeinsame Arbeit zum Neuaufbau Deutschlands, zur Demokratisierung unseres Volkes und zur Überwindung aller Reste des Nationalsozialismus fortzusetzen“. Sie bekräftigten ihr Bekenntnis zur Einheit Deutschlands und erklärten: „Die Parteien der Einheitsfront erwarten, daß auch ihre Fraktionen in den Landtagen, Kreistagen und Gemeindevertretungen der Sowjetzone die ihnen gestellten Aufgaben im Geiste wahrhaft demokratischer Loyalität und Zusammenarbeit zu lösen suchen. Regierungen, Magistrate, Ausschüsse und alle anderen parlamentarischen Vertretungen sind nach den Gesetzen der Demokratie zu bilden. Die Handhabung der Verwaltung ist im gleichen Geiste zu gewährleisten.“
Zum Zeitpunkt der Blockberatung war die Konstituierung der Landtage bereits im Gange. Am 18. November trat in Halle als erster der Landtag der Provinz Sachsen zur konstituierenden Sitzung zusammen. In den folgenden Tagen fand auch in Schwerin, Weimar, Dresden und Potsdam ein solcher feierlicher Akt statt. In Grußansprachen würdigten die Chefs der SMA der Länder die Bildung der aus freien, demokratischen Wahlen hervorgegangenen Landtage und äußerten die Erwartung, man werde im Interesse des Volkes handeln und das demokratische Aufbauwerk gemäß dem Potsdamer Abkommen fortführen. Die Landtage wählten als erstes jeweils den Landtagspräsidenten. Über Vorschläge für dieses Amt und für das Landtagspräsidium hatten sich die Parteien vorher in den Blockausschüssen verständigt. Zu Landtagspräsidenten wurden gewählt: Bruno Böttge in der Provinz Sachsen, Otto Buchwitz im Land Sachsen, Friedrich Ebert in Mark Brandenburg, August Frölich in Thüringen und Carl Moltmann in Mecklenburg-Vorpommern. Mit ihnen hatte die SED als wählerstärkste Partei Kandidaten empfohlen, die aus der Zeit der Weimarer Republik über vielfältige Erfahrungen in der Parlamentsarbeit verfügten und die mit Ausnahme des thüringischen Landtagspräsidenten — das Amt eines der jeweils zwei Landesvorsitzenden der Arbeiterpartei wahrnahmen. Die Landtagspräsidien setzten sich aus Vertretern aller Fraktionen zusammen. Mit der Organisationsform eines solchen Präsidiums wurde eine Klammer zwischen den Landtagsfraktionen geschaffen. Sie förderte deren Zusammenwirken im Geiste der Blockzusammenarbeit.
Als erstes nahmen die Landtage in voller Einmütigkeit Entschließungen zur Herstellung der Einheit Deutschlands an. „Wir erneuern das Gelöbnis zur Einheit Deutschlands und sehen in den Ländern und Provinzen lebensvolle Glieder der deutschen Republik … Die endgültige Form des Staatsaufbaus kann nur“, hieß es in der Erklärung des Sächsischen Landtages, „ein Einheitsstaat mit dezentralisierter Verwaltung sein.“
Die Landtage beschlossen, Regierungen anstelle der Landesbzw. Provinzialverwaltungen zu bilden. Am 27.November forderte der Chef der SMAD mit Befehl Nr. 332 deren Präsidenten auf, „ihre in den Befehlen und Verfügungen der Sowjetischen Militäradministration vorgesehenen Vollmachten den Landtagen und neugebildeten Regierungen zu übergeben.“
Die Konstituierung der Landtage bedeutete „einen neuen Abschnitt der Demokratisierung“ des „gesellschaftlichen Lebens, … einen Schritt auf dem Wege zur Wiedergewinnung der deutschen Selbständigkeit“, wie Otto Buchwitz im Sächsischen Landtag erklärte. Ihre Tätigkeit hatte sich im Einklang mit den Vereinbarungen der alliierten Mächte bzw. den Kontrollratsbeschlüssen sowie auf dem Boden der durch die SMAD erlassenen Befehle zu vollziehen. Die schon bald nach Landtagseröffnung verabschiedeten Länderverfassungen fixierten die Funktion der Landtage. So hieß es zum Beispiel in der Verfassung des Landes Sachsen: „Der Landtag ist das höchste demokratische Organ des Landes. Ihm obliegt die Gesetzgebung. Er übt die oberste Kontrolle über alle Regierungsmaßnahmen und über die gesamte Verwaltung und Rechtsprechung aus. Der Landtag wählt den Ministerpräsidenten und bestätigt die von ihm vorgeschlagenen Minister.“
Den Landtagen gehörten insgesamt 519 Abgeordnete an: 249 Abgeordnete der SED, 133 der CDU, 121 der LDPD, 15 der VdgB und 1 Abgeordneter des Kulturbundes. In allen Landtagen bildete die SED die stärkste Fraktion. In Mecklenburg-Vorpommern und Thüringen hatte sie sogar 50 Prozent der Sitze erhalten. In der Provinz Sachsen und noch ausgeprägter in Mark Brandenburg überwog die Zahl der Mandate von CDU und LDPD. Die Abgeordneten der VdgB in al‚len fünf Landtagen — und der Mandatsträger des Kulturbundes — im Sächsischen Landtag — wirkten eng mit den Abgeordneten der SED zusammen.
Dem Charakter dieser Parteien entsprechend dominierten in den Fraktionen von CDU und LDPD jene Kräfte, die eine Blockzusammenarbeit mit der SED bei der Ausmerzung von Faschismus und Militarismus und im Ringen um eine antifaschistische Friedenssicherung und die Herstellung eines einheitlichen, demokratischen deutschen Staates für erforderlich hielten. Über weitere Schritte im revolutionären Umsgestaltungsprozeß und über dessen Perspektiven gingen die Meinungen zwischen diesen Parteien und der SED allerdings beträchtlich auseinander. Das traf auch für die Vorstellungen über Funktion und Arbeitsweise der Landtage zu. Während die SED die Länderparlamente unter Nutzung aller progressiven bürgerlich-demokratischen Strukturformen zu Volksvertretungen mit dem Charakter arbeitender Körperschaften im Sinne eines volksdemokratischen Weges entwickeln wollte, nahmen CDU und LDPD die Arbeit in den Landtagen mit Vorstellungen des bürgerlichen Parlamentarismus auf. Reaktionäre Kräfte, die sich wegen des Fehlens einer konservativen Partei nur im Rahmen dieser beiden bürgerlich-demokratischen Parteien artikulieren konnten, verfolgten die Absicht, die Parlamente als Tribüne für eine Konfrontation mit der SED zu nutzen. Die außerparlamentarische Blockzusammenarbeit als Ausdruck gemeinsamer antiimperialistischer Grundinteressen stellte jedoch eine Barriere gegen die Formierung einer Opposition im Sinne bürgerlich-pluralistischer Demokratiemodelle dar.
In ihrer zweiten Sitzung im Dezember 1946 wählten die Landtage die Regierungen und bestätigten deren Programme. Als Ministerpräsidenten wurden die Präsidenten der bisherigen Landesbzw. Provinzialverwaltungen gewählt: Karl Steinhoff in Mark Brandenburg, Rudolf Friedrichs — und nach dessen Tod im Juni 1947 Max Seydewitz — im Land Sachsen, Wilhelm Höcker in Mecklenburg-Vorpommern, Rudolf Paul — und nach dessen pflichtwidrigem Verlassen der Ostzone im Oktober 1947 Werner Eggerath in Thüringen (alle SED) und Erhard Hübener (LDPD) in der Provinz Sachsen. Marie Torhorst (SED) als Volksbildungsminister in der Landesregierung Thüringens war allerdings die einzige Frau, der ein Ministeramt übertragen wurde. Führende Repräsentanten von CDU und LDPD übernahmen mit Ministerämtern und anderen Funktionen Mitverantwortung für die Realisierung der Regierungspolitik, so Hermann Kastner, Landesvorsitzender der CDU, als Justizminister in Sachsen und Reinhold Lobedanz, ebenfalls Landesvorsitzender der CDU, als Leiter der Präsidialabteilung in Mecklenburg-Vorpommern.
Bei der Wahl des Ministerpräsidenten und auch bei der Bestätigung der Minister gab deren bisheriges Wirken den Ausschlag. Obwohl die SED nach parlamentarischen Regeln auch im Landtag der Provinz Sachsen als stärkste Fraktion Anspruch auf das Amt des Ministerpräsidenten hätte erheben können, unterstützte sie die Kandidatur des bürgerlichen Politikers Erhard Hübener, der sich um den demokratischen Neuaufbau verdient gemacht hatte. Von Mark Brandenburg abgesehen, war eine zügige Regierungsbildung im Geiste der Blockzusammenarbeit möglich. Dort zogen sich die Verhandlungen in die Länge, da die beiden bürgerlich-demokratischen Parteien auf ihren Stimmenanteil bei den Wahlen pochend eine neue Ressortverteilung gegenüber der, die in der Provinzialverwaltung bestanden hatte, durchsetzen wollten.
Als wählerstärkste Partei stellte die SED insgesamt 17 von 33 Ministern. 8 Minister wurden von der LDPD, 8 von der CDU und der Landwirtschaftsminister im Agrarland Mecklenburg-Vorpommern von der VdgB nominiert. Mit dem Amt des Ministerpäsidenten in vier und den Ressorts Inneres, Volksbildung und Wirtschaft — hier allerdings mit Ausnahme von Mecklenburg-Vorpommern in allen fünf Ländern bzw. Provinzen verfügte die Arbeiterklasse über Schlüsselfunktionen. Mit ihnen konnte sie ihre Hegemonie sichern und ausbauen. Bei den Innenministern lagen die Entscheidungsbefugnisse hinsichtlich der demokratischen Bodenreform und der Enteignung der Kriegsverbrecher und Naziaktivisten in der Wirtschaft, zur Entnazifizierung sowie für den kadermäßigen Ausbau der Verwaltungsorgane und den polizeilichen Schutz der neuen Verhältnisse. Als Innenminister wurden bestätigt: Ernst Busse in Thüringen, Kurt Fischer im Land Sachsen, Robert Siewert in der Provinz Sachsen, Hans Warnke in Mecklenburg-Vorpommern und Bernhard Bechler in Mark Brandenburg. Die vier Erstgenannten waren bekannte Funktionäre der revolutionären Arbeiterbewegung. Bechler hatte sich in den Reihen des NKFD als antifaschistischer Kämpfer ausgezeichnet.
Ende 1946/Anfang 1947 konstituierten sich in den Land- und Stadtkreisen die Kreistage bzw. Stadtverordnetenversammlungen. Die örtlichen Volksvertretungen waren schon gleich nach den Gemeindewahlen zusammengetreten. Viele Gemeindevertretungen bestanden nur aus Abgeordneten der SED und der demokratischen Organisationen, vor allem der VdgB und der Frauenausschüsse. Sie hatten zwar eine breite Massenbasis, boten aber nur geringe Möglichkeiten für die Entfaltung der Blockzusammenarbeit.
Die Landtage und die Länder- bzw. Provinzialregierungen stellten die obersten deutschen gesetzgebenden und exekutiven Organe in der sowjetischen Besatzungszone dar.
Die Ausarbeitung und Annahme der Länderverfassungen
Noch in der Konstituierungsphase der Landtage schlug Wilhelm Pieck im zentralen Blockausschuß vor, „sich über die Grundsätze für die neuen Kreisund Landesordnungen zu verständigen und Stellung zu dem Verfassungsentwurf für die deutsche Republik zu nehmen. Die SED habe ihrerseits Entwürfe vorbereitet und nehme das gleiche von den anderen Parteien an.“?6 Zwischen den drei Blockparteien bestand Übereinstimmung, nach der Konstituierung der Landtage sogleich die verfassungsmäßige Ausgestaltung der antifaschistischen Demokratie in den Ländern und Provinzen in Angriff zu nehmen. Dabei gingen sie davon aus, „die Ausarbeitung der Landesverfassungen unter den leitenden Gesichtspunkt zu stellen, daß die Länder nur Glieder eines einheitlichen deutschen Staates sein können und daß infolgedessen die Verfassungen der Länder nur vorläufigen Charakter haben“.?’ Mit diesem Grundsatz, der die Verhandlungen auf Zonen- wie auf Länderebene prägte, stellten sich die drei Parteien einmütig partikularistischen Konzeptionen entgegen, wie sie von politischen Kräften in den Westonen artikuliert wurden und namentlich in der am 1. Dezember 1946 beschlossenen Bayrischen Verfassung hervortraten.
Die Verhandlungen zu den Länderverfassungen in der Ostzone wurden dadurch geprägt, daß ein grundlegender Konsens hinsichtlich der verfassungsrechtlichen Sanktionierung der Beseitigung von Faschismus und Militarismus bestand. Auch die schließlich erzielte Übereinstimmung darin, daß ein Grundrechtekatalog in die Verfassungen aufzunehmen ist, da die Konstituierung einer verfassunggebenden Nationalversammlung in unbestimmter Ferne lag, förderte die gemeinsame Arbeit.
Im Zentrum der Verfassungskonzeption der SED stand die Sicherung der Souveränität des werktätigen Volkes auf dem Boden antifaschistisch-demokratischer Verhältnisse. Die Partei der Arbeiterklasse kämpfte darum, den im Wahlkampf entwickelten Leitspruch „Durch das Volk — mit dem Volk für das Volk!“?® zum obersten Verfassungsgrundsatz zu machen. Otto Grotewohl schrieb: „Wir sehen die Möglichkeit einer lebensvollen Demokratie in Deutschland nur in der Herstellung der vollen Volkssouveränität, der unmittelbaren Verwirklichung aller staatlichen Funktionen — auch der Justiz und der Verwaltung — durch das Volk selbst bzw. unter ständiger Leitung und Kontrolle der Volksvertretung, des Parlaments.“?? Die Entwürfe der SED für die Länderverfassungen basierten auf ihrem Verfassungsentwurf für eine deutsche demokratische Republik vom 14. November 1946.
Die bestimmenden Kräfte in den Führungen von CDU und LDPD orientierten sich an bürgerlichen Verfassungskonzepten, wie bereits in der Blocksitzung am 4. Dezember sichtbar wurde. Vertreter beider Parteien plädierten für das Prinzip der Gewaltenteilung. Von seiten der CDU wurde vor allem eingewendet, die in den „SED-Entwürfen zum Ausdruck gebrachte Omnipotenz der Parlamente verstoße gegen das Montesquieusche Prinzip von der Teilung der Gewalten“®, und die Einrichtung eines Verfassungsgerichtshofes gefordert. Doch boten die SED-Entwürfe Möglichkeiten eines Konsens. Die weitgehende Übernahme von Bestimmungen der Weimarer Verfassung erleichterte ein Zusammengehen der drei Parteien. Die Verhandlungen wurden auch dadurch beeinflußt, daß die SED mit der Vorlage eines geschlossenen Entwurfs in Vorhand war. Ungeachtet von Divergenzen erkärten die drei Parteien im Kommuniqu& zu der Beratung im zentralen Blockausschuß: „Der Ausschuß hält es für wünschenswert, daß die Verfassungen, unbeschadet der Rücksichtnahme auf die besonderen Verhältnisse einzelner Länder, möglichst gleichartig gestaltet werden. Er empfiehlt den Fraktionen, in diesem Sinne zusammenzuarbeiten, und ist der Auffassung, daß der vorgelegte Entwurf der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands zusammen mit etwaigen Anträgen anderer Parteien zu einer geeigneten Lösung führen wird.“*! Diese Stellungnahme förderte die konstruktive Zusammenarbeit in den Landesbzw. Provinzialblockausschüssen und in den Landtagsgremien. Die CDU-Fraktionen zogen jeweils den parallel zum Entwurf der SED eingereichten Entwurf der zentralen Führung der CDU zurück und setzten dessen kardinale Bestimmungen in Anträge zur Abänderung des SED-Entwurfes um. Die LDPD nahm von vornherein auf Antragstellungen Kurs.
Unterschiedliche bzw. gegensätzliche Standpunkte traten in den Debatten aller fünf Landtage hervor, jedoch mit mehr oder weniger großer Schärfe. Zum Teil handelte es sich um Kontroversen, denen letztendlich unterschiedliche Interessen der verschiedenen Klassen und Schichten zugrunde lagen. Das war zum Beispiel der Fall, wenn Abgeordnete von CDU und LDPD im Mecklenburgischen Landtag die Zergliederung enteigneter und als Landeseigentum konstituierter Betriebe zwecks Übergabe an kleine und mittlere Privatunternehmer forderten. Der Antrag, weitere entschädigungslose Enteignungen von einer Zweidrittelmehrheit des Landtages abhängig zu machen, entsprang der Besorgnis kleinbürgerlicher und bürgerlicher Schichten, die SED trachte nach einer Aufhebung des Privateigentums an Produktionsmitteln überhaupt. Stellungnahmen gegen die verfassungsrechtliche Fixierung der Wirtschaftsplanung — besonders heftig in Mecklenburg-Vorpommern und in der Provinz Sachsen vorgetragen — entsprangen der Illusion über die Chancen der Kleinunternehmer bei einer erhofften freien Marktwirtschaft ohne private Monopolvereinigungen.
Die meisten Auseinandersetzungen ergaben sich aus dem traditionellen Demokratie- und Staatsverständnis maßgeblicher Kräfte in CDU und LDPD. Hauptsächlich ging es diesen um die Errichtung von Wahlu-nd Verfassungsprüfgerichten, die Wiedereinführung des Berufsbeamtentums, die Deklarierung der Unabsetzbarkeit der Richter, die Ablehnung einer Berufung von Absolventen der Volksrichterlehrgänge als Richter und um den Ausschluß der demokratischen Massenorganisationen von der politischen Willensbildung in den Vertretungskörperschaften. Im Verfassungsausschuß des Sächsischen Landtages zum Beispiel beantragte die CDU, die im Entwurf der SED enthaltene Festlegung über die umfassende Kontrolle der Verwaltungen durch das Volk zu streichen. Die Auseinandersetzungen in den Verfassungsdebatten spitzten sich vor allem im Brandenburgischen und im Sächsischen Landtag noch dadurch zu, daß einzelne Abgeordnete die Debatten benutzten, um die Sequestrierung bzw. die Enteignung der Betriebe von Nazi- und Kriegsverbrechern und andere revolutionäre Errungenschaften anzugreifen. Hier trat zutage, daß die Fraktionen von CDU und LDPD nicht schlechthin unter dem Druck der monopolkapitalistischen Reaktion standen, sondern einzelne Abgeordnete mit dieser auch direkt verbunden waren.
Trotzdem gelang es der SED im Verlauf wochenlanger Verhandlungen in den Ausschüssen und dann auch in den Plenarberatungen der Landtage, eine Verständigung zwischen den Parteien herbeizuführen. Als Landtagsabgeordnete waren die Mitglieder des Zentralsekretariats der SED daran führend beteiligt, so Wilhelm Pieck in Potsdam, Otto Grotewohl in Dresden, Helmut Lehmann in Weimar, Walter Ulbricht in Halle und Franz Dahlem in Schwerin. Die SED-Vertreter deckten in intensiven Gesprächen die fortschrittshemmenden Züge mancher Anträge auf, deren Konsequenzen zunächst von der Mehrzahl der Abgeordneten von CDU und LDPD nicht erkannt worden waren. Die Annäherung der Auffassungen wurde dadurch erleichtert, daß es bei einigen strittigen Fragen von vornherein eine partielle Übereinstimmung zwischen der SED und einer der beiden bürgerlich-demokratischen Parteien gab, so zum Beispiel mit der LDPD hinsichtlich der konsequenten Trennung von Staat und Kirche in der Schule und mit der CDU in bezug auf die Wirtschaftsplanung.
In allen fünf Landtagen war es der SED möglich, den antifaschistisch-demokratischen Grundgehalt ihres Entwurfs zu bewahren. Um eine einstimmige Annahme der Länderverfassungen zu erreichen und damit die Blockgemeinschaft zu festigen, ging sie Kompromisse ein. Das betraf vor allem die Stellung der Massenorganisationen und die Ausgestaltung des Grundrechtekatalogs — in Mark Brandenburg und in Sachsen-Anhalt -, die Festlegung des Wahlalters in allen Ländern und Provinzen außer in Sachsen — sowie — in Thüringen — die Bildung eines zwar personell mit dem Landtag verbundenen, jedoch institutionell beigeordneten Verfassungsprüfungsausschusses. Die Verhandlungen zu den Verfassungsentwürfen wurden in allen Ländern und Provinzen von einer zunehmenden Übereinstimmung geprägt. Die fortschrittlichen Kräfte in CDU und LDPD trugen dazu wesentlich bei und gelangten selbst zu neuen Einsichten. Eine Rolle spielte auch, daß die Blockpartner wegen des erstrebten Ziels einer weitgehend einheitlichen Ausgestaltung der Länderverfassungen auf die Thüringer Verfassung Rücksicht nehmen mußten, die bereits am 20. Dezember — unbeeinflußt von den zentralen Blockberatungen — angenommen worden war. Die reaktionären Kräfte hingegen mußten ins Kalkül ziehen, daß die sowjetische Militärverwaltung einer Revision der bisher erreichten Ergebnisse bei der Demokratisierung und Entnazifizierung im Sinne des Potsdamer Abkommens Einhalt gebieten würde.
Die Landtage befanden stufenweise über die Entwürfe. Während bei Abstimmungen über einzelne Artikel mehrfach nur Mehrheitsentscheidungen möglich waren, kam es schließlich in allen Landtagen zu einer einstimmigen Annahme der jeweiligen Verfassung im ganzen: am 10. und 15. Januar 1947 in der Provinz Sachsen-Anhalt und im Land Mecklenburg-Vorpommern, am 6. und 28. Februar in der Provinz Mark Brandenburg und im Land Sachsen. Die Einstimmigkeit bei der grundsätzlichen Entscheidung verband die drei Parteien enger miteinander und bildete einen Ausgangspunkt für die Vertiefung der Zusammenarbeit im Block. Alle drei Parteien bekannten sich damit zu den Errungenschaften des antifaschistisch-demokratischen Entwicklungsweges und zur gemeinsamen Fortführung des Aufbauwerkes.
Erstmals in der deutschen Geschichte wurde das Prinzip der Volkssouveränität Verfassungsgrundsatz. Die antifaschistisch-demokratischen Umgestaltungen, die personellen Entnazifizierungsmaßnahmen und die Ausschaltung aktiver Faschisten und Kriegsverbrecher von den demokratischen Grundrechten wurden verfassungsrechtlich sanktioniert, die Grundrechte der Bürger vorrangig als Recht des Volkes auf aktive Mitwirkung in den staatlichen Angelegenheiten gefaßt und nicht gemäß überkommenen Auffassungen primär als Individualrechte in Abgrenzung von der staatlichen Gewalt verstanden. Die verfassungsrechtliche Verankerung der antifaschistisch-demokratischen Umgestaltung der gesellschaftlichen Verhältnisse beseitigte den in der bürgerlichen Ordnung bestehenden Widerspruch zwischen der formellen Anerkennung von Rechten und Freiheiten des Volkes bzw. des Einzelnen und deren Negation durch die aus dem kapitalistischen Privateigentum erwachsenden Ausbeutungs- und Abhängigkeitsverhältnisse. Die Fixierung folgender Rechte: auf Arbeit, auf Urlaub und Erholung, auf Versorgung bei Krankheit und im Alter, auf Gleichstellung von Mann und Frau sowie von Erwachsenen und Jugendlichen bei der Entlohnung, auf Bildung, auf soziale Sicherheit, auf gesellschaftliche Förderung der Jugend, erweiterte die Grundrechte qualitativ. Damit fanden Kampfziele der revolutionären Arbeiterbewegung verfassungsmäßige Verankerung.
Nach Verabschiedung der Länderverfassungen erfolgte bis Ende Februar 1947 mit der Beschlußfassung über dıe demokratischen Kreisordnungen die weitere rechtliche Ausgestaltung der antifaschistisch-demokratischen Verhältnisse. Die demokratischen Gemeindeordnungen kamen durch Gesetzesakte der Präsidien der Landesbzw. Provinzialverwaltungen noch vor Konstituierung der Landtage oder durch Landtagsgesetze zustande. Sie basierten auf einem SMAD-Befehl, der seinerseits auf den Grundsätzen der „Kommunalpolitischen Richtlinien der SED“ vom Juli 1946 beruhte und Anregungen auch von CDU und LDPD berücksichtigte.
Wenngleich in der Abgrenzung von sogenannten Selbstverwaltungsund Auftragsangelegenheiten die Grundkonzeption des Weimarer Kommunalrechts fortdauerte, so ermöglichten doch sowohl die Kreisals auch die Gemeindeordnungen eine weitere Ausprägung der antifaschistischen Demokratie.
Justiz und Polizei im neuen Abschnitt der Demokratisierung
Am 1. und 2. März 1947 führte der Parteivorstand der SED erstmals eine Konferenz mit den der SED angehörenden Juristen durch. Sie beriet „Grundsätze zur Rechtserneuerung“. Das Grundsatzreferat hielt Walter Ulbricht, der im Parteivorstand für die Arbeit der demokratischen Machtorgane verantwortlich war. Karl Polak erläuterte die Aufgaben bei der weiteren Demokratisierung der Justiz, und Hilde Benjamin sprach über die Ausbildung von Volksrichtern.
Als die Landtage Ende 1946/Anfang 1947 mit den Länderverfassungen auch die gesellschaftliche Stellung der Justiz bestimmten, bestanden bereits Grundlagen für ein Wirken der Justiz im Sinne der antifaschistischen Demokratie. Die Sondergerichte des „Dritten Reiches“ waren abgeschafft, die Verteidigungsrechte des Angeklagten im Strafprozeß sowie die Laiengerichtsbarkeit wiederhergestellt und die Gleichheit aller Bürger vor dem Gesetz ohne Unterschied von Rasse, sozialer Stellung und Weltanschauung gesichert. Alle Akte ausgesprochen nazistischer Gesetzgebung waren aufgehoben. Die Entnazifizierung der Justizorgane hatte bereits Ende 1946 ihren Abschluß gefunden. 74 nominelle NSDAP-Mitglieder waren im Amt belassen worden. Das waren Menschen, die sich Verdienste im antifaschistischen Widerstand erworben hatten. In der Justizverwaltung und an der Spitze der Gerichte und Anwaltschaften wirkten politisch engagierte Antifaschisten, unter anderem auch einige Fachjuristen, die bereits vor 1933 Mitglieder der KPD oder der SPD gewesen waren. Der Präsident der Deutschen Justizverwaltung, Eugen Schiffer, hatte sich bereits vor 1918 als Parlamentarier tätig in den Anfangsjahren der Weimarer Republik in Ministerämtern und als Reichstagsabgeordneter für die Ausgestaltung der Republik als bürgerlich-parlamentarischer Staat eingesetzt. 1945 zählte er zu den Mitbegründern der LDPD.
In Volksrichterlehrgängen wurden in allen Ländern und Provinzen Antifaschisten zu Richtern und Staatsanwälten ausgebildet. Nachdem bereits 1945 eine Reihe von Antifaschisten sofort als Richter oder Staatsanwälte eingesetzt worden waren, nahmen Ende 1946 97 Absolventen der ersten Achtmonatelehrgänge ihre Tätigkeit auf. Erstmals in der deutschen Geschichte gelangten damit in großer Zahl Männer und Frauen aus dem werktätigen Volk in die Justiz.
Schwarzmarktrazzia der Volkspolizei, 1947
Die demokratische Umgestaltung der Justiz war in hohem Maße das Ergebnis eines einvernehmlichen Wirkens der drei Parteien, das sich hier in strikt von der SMAD gezogenen Grenzen vollzog. Sie ließ sich weitgehend im Rahmen jener bürgerlich-demokratischen Strukturformen, Rechtsnormen und Grundrechtebestimmungen realisieren, die aus der Weimarer Republik überliefert waren. Soweit dies geschah, war von vornherein eine Übereinstimmung zwischen der SED und den bürgerlich-demokratischen Parteien gegeben. CDU und LDPD hielten jedoch zugleich zäh an der überkommenen Auffassung fest, die Selbständigkeit der richterlichen Gewalt sei eine Garantie der demokratischen Rechtsstaatlichkeit. Demgegenüber setzte sich die SED bei der Ausarbeitung der Länderverfassungen dafür ein, den Parlamenten als der unmittelbar gewählten Repräsentation des ganzen Volkes eine auch von der Justiz zu respektierende Vorrangstellung zu geben. Die Vertreter der SED beriefen sich dabei nicht zuletzt auf die Lehren der Geschichte und führten den Faktenbeweis, daß die Justiz der Weimarer Republik — verfassungsrechtlich und vor allem auch personell „Staat im Staate“ und von reaktionären Berufsjuristen dominiert — die Zerstörung der bürgerlich-parlamentarischen Demokratie durch den Hitlerfaschismus erleichtert hatte. Der Standpunkt der SED setzte sich in den komplizierten Verhandlungen schließlich durch.
Die von der Juristenkonferenz der SED im März 1947 formulierten Aufgaben zur weiteren Demokratisierung der Justiz liefen darauf hinaus, diese als wirksames Instrument zum Schutz der demokratischen Errungenschaften zu entwickeln. „Recht und Rechtspflege müssen aus ihrer verhängnisvollen Volksfremdheit herausgelöst und in den Dienst des demokratischen Aufbaus gestellt werden“, postulierte die SED in den erwähnten „Grundsätzen zur Rechtserneuerung“.
Die größten Hemmnisse bestanden trotz erfolgter Entnazifizierung — in der personellen Zusammensetzung der Justizorgane und in deren Arbeitsweise. Mitte 1947 gehörte, zwar jeder zweite Staatsanwalt, aber nur jeder fünfte Richter der SED an. 50 Prozent der Richter waren parteilos. In der Mehrzahl wirkten in den Gerichten bürgerliche Fachjuristen mit konservativen Auffassungen. Diese legten auf dem Boden positivistischer Rechtsauffassungen die überkommenen Rechtsnormen, wie die des Bürgerlichen Gesetzbuches -— denn neue Gesetzbücher gab es noch nicht -, vielfach formal aus, ohne die Erfordernisse der antifaschistisch-demokratischen Neuordnung zu berücksichtigen. Bei Wirtschaftsvergehen zum Beispiel wurde von ihnen nicht genügend zwischen gewerbsmäßigen Schiebern und jenen Werktätigen unterschieden, die im Tauschhandel ihre kärglichen Lebensmittelrationen aufzubessern versuchten. Während vielfach Schieber mit für sie gänzlich unempfindlichen Geldstrafen belegt wurden, ergingen mancherorts Urteile, durch die sich die ganze Schwere des Gesetzes gegen kleine Bauern, Industriearbeiter und Angestellte richtete. Die SED gab Bevölkerungsprotesten gegen solche Praktiken in ihren Zeitungen Raum und setzte auf der Basis einer allgemeinen Regelung der Deutschen Justizverwaltung in vielen Fällen eine Revision rechtskräftig ergangener, jedoch unsozialer und ungerechter Urteile durch. Sie bemühte sich, die Justiztätigkeit durch politisch-ideologische Erziehungsarbeit und durch öffentliche Kritik in die Mitverantwortung für das demokratische Aufbauwerk zu drängen. In den „Grundsätzen zur Rechtserneuerung“ erklärte sie es als „unerläßlich, die Werktätigen zur Mitarbeit an der Rechtspflege heranzuziehen und sie davon zu überzeugen, daß die Justiz ein unentbehrliches Instrument im Kampf für den demokratischen Aufbau Deutschlands ist“.
Das tief verwurzelte Mißtrauen in breiten Kreisen der Werktätigen gegen alle Formen der Staatlichkeit mußte überwunden werden. Erschwerte objektiv das verhüllte Klassenwesen der bürgerlichen Rechtsnormen die öffentliche Kontrolle, so bestanden zusätzliche Erschwernisse dadurch, daß heterogene Rechtsnormen nebeneinander bestanden: Neben den Befehlen und Anordnungen der SMAD und der SMA der Länder, den Kontrollratsbeschlüssen und den Gesetzen und Verordnungen der antifaschistisch-demokratischen Machtorgane waren faktisch alle vor 1933 geltenden bürgerlichen Rechtsnormen und selbst zahlreiche nachfolgend in Kraft gesetzte Rechtsakte geltendes Recht, so beispielsweise bis 1948 auch die Kriegswirtschaftsverordnung vom September 1939.
Die Demokratisierung der Justiz war insgesamt langwierig. In dem allmählichen Wandlungsprozeß traten zunehmend Volksrichter und Volksstaatsanwälte als die vorwärtsdrängenden Kräfte in Erscheinung. Mitte 1947 nahmen weitere 129 Absolventen von Volksrichterlehrgängen ihre Tätigkeit auf.
Der Ausbau der antifaschistisch-demokratischen Machtorgane schloß auch die polizeiliche Gewalt ein. Ende November 1946 begannen die entsprechend einem SMAD-Befehl vom 30.Juli 1946 gebildete Deutsche Verwaltung des Innern (DVdI) und die Innenministerien der Länder und Provinzen mit dem Aufbau der Grenzpolizei als Dienstzweig der Volkspolizei. Wie die SMAD angewiesen hatte, sollten deutsche Polizeikräfte die sowjetischen Sicherungskräfte bei der Kontrolle der Demarkationslinie zu den Westzonen, aber auch an der Oder-Neiße-Grenze sowie an der Grenze zur Tschechoslowakei unterstützen. Dieser Schritt wurde vor allem wegen der restaurativen Entwicklung in den Westzonen und der im Bizonenprojekt zutage tretenden Abschnürung der amerikanischen und der britischen von der sowjetischen Zone notwendig. Zwar waren auch schon vorher Volkspolizeiangehörige zur Kontrolle des deutschen Personenund Warenverkehrs hinzugezogen worden, jetzt aber bedurfte es angesichts der von den Westzonen ausgehenden Störaktionen einer wirkungsvolleren Kontrolle. Enteignete Fabrikanten und Gutsbesitzer, die aus der sowjetischen Besatzungszone geflohen waren, versuchten über Mittelsmänner, Maschinen und Geräte, Zuchtvieh und sonstige Werte in die Westzonen zu schleusen. Nachrichten- und kurierdienstliche Tätigkeit zur Unterwühlung der neuen gesellschaftlichen Verhältnisse in der Ostzone verstärkte sich. Die Trennung des deutschen Gebietes in Besatzungszonen und die vielschichtigen Bevölkerungsbewegungen waren ein günstiger Nährboden für die allgemeine und die Wirtschaftskriminalität.
Die Kommandogewalt für die Einheiten der Grenzpolizei, die auf das engste mit den sowjetischen Truppen zusammenwirkten und von ihnen ihre Weisungen erhielten, wurde antifaschistischen Widerstandskämpfern übertragen. In Mecklenburg-Vorpommern beispielsweise übernahm der Spanienkämpfer Rolf Hagge das Kommando West der Grenzpolizei. In die Grenzpolizei wurden Polizeiangehörige aufgenommen, die sich im Dienst auf örtlicher, auf Kreis- und auf Landes- bzw. Provinzebene bewährt hatten. Leitungen der SED delegierten Kader aus anderen Tätigkeitsbereichen. Auch junge Menschen mit antifaschistischer Gesinnung wurden für den Grenzdienst gewonnen.
Flurschutz im Landkreis Leipzig, 1947
Nach Bildung der Grenzpolizei war das Passieren der Zonengrenzen nur noch an einigen Übergangsstellen gestattet. Illegale Grenzübertritte konnten eingeschränkt werden. Das war nicht zuletzt für die Bekämpfung der weitverbreiteten Bandenkriminalität und für die Fahndung nach Nazi-und Kriegsverbrechern von Bedeutung. Die verstärkte Kontrolle des Personen-und Warenverkehrs half auch, die illegale Aus-und Einfuhr von Wirtschaftsgütern einzuschränken. Auch trug die Bildung der Grenzpolizei zur Beruhigung der Lage in den an der Oder-Neiße-Grenze gelegenen Dörfern bei.
Die Durchsetzung einer strafferen Disziplin, die Aussonderung ungeeigneter Kräfte und die Unterbindung von Willkürhandlungen, vor allem aber die Leistungen bei der Eindämmung der Bandenkriminalität erhöhten das Ansehen und die Autorität der deutschen Polizei. Solche Formen des Zusammenwirkens mit der Bevölkerung wie der Flurschutz in stadtnahen Dörfern trugen dazu bei, daß sich die unter den Werktätigen weitverbreiteten Vorurteile, die letztlich in
den Erfahrungen mit der imperialistischen Klassenherrschaft wurzelten, abschwächten.
Die zunehmende allgemeine und Wirtschaftskriminalität, die aus der Wintersnot 1946/47 und der sich nachfolgend lange hinziehenden äußerst drückenden materiellen Lage breitester Schichten erwuchs, und auch Erscheinungen eines sich verschärfenden politischen Klassenkampfes stellten die Volkspolizei schon in den ersten Monaten des Jahres 1947 vor wachsende Aufgaben. Es begann sich positiv auszuwirken, daß durch das Wirken der Deutschen Verwaltung des Inneren die polizeiliche Arbeit über die Grenzen der Länder hinaus koordiniert und einheitlicher gelenkt werden konnte. Doch erwies es sich zunehmend als ein Hemmnis, daß die aus dem Aufbau der demokratischen Machtorgane von unten nach oben erwachsene Unterstellung der Polizei unter die örtlichen Verwaltungsorgane nur bis zur Ebene der Landes- bzw. Provinzialregierungen aufgehoben werden konnte und eine Zusammenfassung auf noch höherer Ebene mit Rücksichtnahme auf die Zielsetzungen einer überzonalen politischen Zentralisation unterbleiben mußte.
Die Gründung der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes und des Demokratischen Frauenbundes Deutschlands
Im Frühjahr 1947 konstituierten sich zwei weitere politische Organisationen: die Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes (VVN) und der Demokratische Frauenbund Deutschlands (DFD).
Gründungskongreß der VVN in Berlin, Februar 1947. V. I.n. r.: Oberbürgermeister Otto Ostrowski (SPD), Sergej Tjulpanow (Leiter der Informationsverwaltung der SMAD), Franz Dahlem (Mitglied des Parteivorstands der SED)
Die VVN wurde auf einer Delegiertenkonferenz der Ausschüsse der Opfer des Faschismus am 22. und 23. Februar 1947 gegründet. Die 215 Delegierten vertraten etwa 35000 Mitglieder in der Ostzone und in Berlin. Franz Dahlem, namhafter Repräsentant der antifaschistischen Widerstandsbewegung und Mitglied des Zentralsekretariats der SED, begründete im Hauptreferat den Zusammenschluß zu einer politischen Organisation. Die VVN wolle die Kämpfer gegen den Faschismus aus allen politischen und konfessionellen Richtungen sowie jene Menschen in ihren Reihen vereinigen, die aus rassistischen Gründen bzw. wegen ihrer religiösen Auffassungen während der Nazidiktatur verfolgt wurden. In ihrem Programm stellte sich die VVN auf den Boden des demokratischen Neuaufbaus und legte sie als Aufgabe fest, die Zusammenarbeit aller Antifaschisten im Kampf gegen die Reste von Nazismus und Militarismus sowie gegen den Rassenwahn und für die Sicherung des Völkerfriedens zu festigen. Sie wolle sich vor allem darum bemühen, die Bevölkerung und insbesondere die Jugend über die faschistischen Verbrechen zu unterrichten und ihnen die Taten des antifaschistischen Widerstandes nahezubringen. Für die Erforschung der Geschichte des Widerstandskampfes wurde eine Forschungsstelle gebildet. Die VVN setzte sich für die Wiedergutmachung der schlimmsten Schäden an Gesundheit und Gut, für die Sicherung der materiellen Existenz aller ehemals Verfolgten sowie für eine gesetzliche Regelung der Fürsorge für die Arbeitsunfähigen unter ihnen und für die Hinterbliebenen der Ermordeten ein. Sie erstrebte die Zusammenarbeit mit den Bruderorganisationen in anderen Ländern und half damit, der Wiederaufnahme des deutschen Volkes in die internationale Völkergemeinschaft den Weg zu bereiten. Zum 1. Vorsitzenden des Zentralvorstandes der VVN wurde Ottomar Geschke (SED) gewählt, zum 2.Vorsitzenden Probst Heinrich Grüber. Generalsekretär wurde Karl Raddatz.
Anläßlich des Internationalen Frauentages fand vom 7. bis 9. März 1947 in Berlin der Deutsche Frauenkongreß für den Frieden statt. Als Alterspräsidentin eröffnete Else Lüders, eine Vorkämpferin aus der bürgerlichen Frauenbewegung, den Kongreß, an dem 811 Delegierte der Frauenausschüsse der Ostzone und aus Berlin sowie Vertreter aller Parteien und Massenorganisationen der Ostzone, Persönlichkeiten aus den Westzonen und auch aus dem Ausland teilnahmen. Die parteilose Ärztin Anne-Marie Durand-Wever berichtete über die Tätigkeit des Vorbereitenden Komitees zur Schaffung einer demokratischen Frauenorganisation, und die bekannte Wissenschaftlerin Paula Hertwig sprach über deren Aufgaben und Ziele. Das Hauptreferat zum Thema „Die Frauen und der Völkerfrieden“ hielt Emmy Damerius (SED). Sie betonte: „Aus dem Schrecken des Hitlerkrieges leiten wir die Verpflichtung ab, daß wir deutschen Frauen der Welt sichtbar beweisen müssen, daß in Zukunft jede Kriegshetze in Deutschland an dem heiligen Zorn der vereinsamten und von Sorgen gequälten Frauen scheitern wird. Wir kämpfen in dem Bewußtsein, daß Friede und Mütterlichkeit untrennbar ist.““* Der Kongreß beschloß die Gründung der DFD. Bereits auf der zentralen Delegiertenkonferenz der Frauenausschüsse am 13. und 14. Juli 1946 war die Bildung einer selbständigen Frauenorganisation gefordert worden. Frauen aller Parteirichtungen vertraten übereinstimmend die Auffassung, eine solche Organisation werde eine noch wirksamere Interessenvertretung und die Aktivierung weiterer Frauen ermöglichen. Im Dezember 1946 hatte sich mit Förderung der IDFF ein Gründungskomitee gebildet, dem Frauen aller Parteirichtungen angehörten. Die Initiative zu diesem Schritt ging von der SED aus. Die Partei der Arbeiterklasse trug damit den neuen Erfordernissen und Möglichkeiten Rechnung. In der Tätigkeit der Frauenausschüsse hatte sich erwiesen, daß unter den Bedingungen eines von der Arbeiterklasse im breiten Bündnis geführten revolutionären Umgestaltungsprozesses der früher vor allem durch die bürgerliche Frauenbewegung hervorgerufene „Frauenseparatismus“ kein akutes Problem mehr war. Außerdem war zu berücksichtigen, daß in Gestalt der IDFF auch international die Tendenz zum überparteilichen Zusammenschluß der Frauen zur Geltung kam. So schien nun das Ziel, die Masse der Frauen zu gewinnen, am ehesten durch die Schaffung einer Frauenorganisation erreichbar zu sein.
Gründungskongreß des DFD im Berliner Admiralspalast, 7. bis 9, März 1947. Else Lüders eröffnet den Kongreß.
Im Unterschied zur SED sperrten sich die Führungsgremien von CDU und LDPD gegen die Bildung des DFD. Vor allem befürchteten sie von der Bildung einer weiteren Massenorganisation, in der SED-Mitglieder eine aktive Rolle spielen würden, ein Anwachsen des politischen Einflusses der SED. Ohnehin begegneten sie der Bildung und Tätigkeit von politischen Massenorganisationen mit Zurückhaltung, die sich angesichts der Beteiligung einiger Organisationen neben den Parteien an den Herbstwahlen noch verstärkt hatte. Eine Rolle spielte auch die Rücksichtnahme auf die sich abzeichnenden Anfänge einer überzonalen Parteienbildung. Mit ihrer ablehnenden Haltung begaben sich die Führungen der beiden bürgerlich-demokratischen Parteien allerdings in Widerspruch zu vielen weiblichen Parteimitgliedern. Der Parteivorstand der LDPD stimmte schließlich der Bildung des DFD zu, nicht zuletzt infolge der einsichtigen Haltung von Wilhelm Külz. Die Führung der CDU hielt an der Ablehnung fest, konnte aber nicht verhindern, daß eine große Zahl von CDU-Frauen die Bildung des DFD unterstützten und an seiner Arbeit teilnahmen. Ausschlußdrohungen konnten nicht aufrechterhalten werden.
Der DFD wurde als überparteiliche, überkonfessionelle und überberufliche Vereinigung gebildet. Die Organisation bemühte sich um den Zusammenschluß der Frauen aller Bevölkerungsschichten und Berufe, unabhängig von Weltanschauung und Parteizugehörigkeit. Ihre wichtigsten Aufgaben sah sie darin, bei der völligen Beseitigung von Faschismus und Militarismus und beim Wiederaufbau der Heimat mitzuwirken und die Gleichberechtigung der Frau in der Gesellschaft durchzusetzen. Der DFD erklärte sich für die Zusammenarbeit mit den Frauen aller Nationen. Schon auf dem Gründungskongreß erfolgte die erste Fühlungnahme mit Frauenorganisationen anderer Länder.
Zur Vorsitzenden des DFD wurde Anne-Marie Durand-Wever gewählt. Stellvertretende Vorsitzende wurden Helene Beer (LDPD), Käthe Kern Vorsitzende des Frauensekretariats beim Zentralsekretariat der SED -, Emmy Damerius und Else Lüders.
Mit dem DFD entstand die erste einheitliche, demokratische Organisation der Frauen in der deutschen Geschichte. Sie nahm die Traditionen der proletarischen Frauenbewegung und auch die des Kampfes der progressiven bürgerlichen Frauen für Gleichberechtigung und Förderung der Frauen in sich auf. Der DFD führte auf breiterer Grundlage und mit erweiterter Zielstellung die Arbeit der Frauenausschüsse fort, die schließlich im Herbst 1947 organisatorisch mit der neuen Organisation verschmolzen wurden.
Nach Konstituierung seiner Kreisund Landesverbände vereinte der DFD Mitte 1947 180000 Frauen und Mädchen als Mitglieder in seinen Reihen. Er hatte in der Folgezeit wesentlichen Anteil daran, daß sich zunehmend mehr Frauen und Mädchen politisch engagierten. Bereits im September wurde der DFD von der IDFF eingeladen, an deren Kongreß in Stockholm teilzunehmen.
Der Kampf um die Überwindung des Wirtschaftsnotstands in der Ostzone. Der Nachkriegsalltag
Inhaltsverzeichnis
- 1 Der Kampf um die Überwindung des Wirtschaftsnotstands in der Ostzone. Der Nachkriegsalltag
- 1.1 Der Wirtschaftsnotstand im Winter 1946/47
- 1.2 Alltagsnöte und schwarzer Markt
- 1.3 Frauen im Spannungsfeld von Überlebenskampf und Ringen um Gleichberechtigung
- 1.4 Der Kurs der Magistratsmehrheit auf Anschluß Berlins an die Entwicklung in den Westzonen
- 1.5 Die schwierige Lage der Landwirtschaft im Frühjahr 1947. Die Überschwemmungskatastrophe im Oderbruch
- 1.6 Die weitere Konstituierung der landeseigenen Industrie und die Bildung der Deutschen Wirtschaftskommission
Der Wirtschaftsnotstand im Winter 1946/47
Bereits im Spätherbst 1946 begann sich die Aufwärtsbewegung der industriellen Produktion abzuschwächen. Die aus der faschistischen Kriegswirtschaft übernommenen Vorräte an Rohstoffen, Halbzeugen, Ersatzteilen und Werkzeugen waren aufgebraucht.
Aus den in den westlichen Besatzungszonen liegenden Hauptversorgungsgebieten der verarbeitenden Industrie kamen nur unbedeutende Mengen an Rohstoffen und Halbzeugen. Die Demontagen in der Grundstoffindustrie hatten den Kreis der Rohstofflieferanten weiter eingeschränkt. Durch den Abbau von metallverarbeitenden Betrieben blieben spezielle Ersatzteile aus. Viele Betriebe, die ihre Ersatzteile und Werkzeuge traditionell von in den Westzonen angesiedelten Firmen bezogen, mußten sich schon seit einiger Zeit ohne deren Lieferungen behelfen. Das Fehlen von Ersatzteilen hatte zunehmend längere Unterbrechungen der Produktion in den Betrieben zur Folge.
Eine im Dezember 1946 einsetzende und bis in den Februar 1947 hinein anhaltende ungewöhnlich kalte Witterung verschärfte die wirtschaftliche Situation der Ostzone dramatisch. Die niedrigen Temperaturen brachten den Eisenbahnverkehr und die Binnenschifffahrt weitgehend zum Erliegen. Sie beeinträchtigten die Braunkohlenförderung in den Tagebauen so stark, daß diese in den Monaten Januar und Februar 1947 um die Hälfte niedriger lag, als der Produktionsplan vorsah. Aus Mangel an Brennstoffen und Elektroenergie kam es im I. Quartal des Jahres 1947 in den Industriezweigen zu Produktionseinschränkungen von mindestens 20 Prozent. Besonders betroffen waren die energieintensiven Zweige, wie die Baumaterialienindustrie und die chemische Industrie, deren Produktion um 65 bzw. 55 Prozent zurückging, sowie jene Betriebe, die ihren Standort abseits der Kohlenreviere hatten. Dazu gehörten die Produktionsstätten der Textilund der Papierindustrie, deren Produktion um 57 bzw. 40 Prozent abnahm. Verschärft wurde die Situation noch dadurch, daß die mit den Westzonen getroffenen Vereinbarungen über Steinkohlenund Steinkohlenkokslieferungen nicht eingehalten wurden. So hatte der Ausfall der Lieferung von 200.000 Tonnen Kohle aus den Ruhrgruben im Januar 1947 verheerende Folgen für die Situation in Berlin.
Im Land Sachsen war die industrielle Produktion, die sich im Oktober 1946 noch auf 308 Millionen RM belief, bis zum Februar 1947 auf 184 Millionen RM abgesunken. Erst im Juni 1947 gelang es wieder, für mehr als 300 Millionen RM industrielle Erzeugnisse herzustellen.
In dieser sich katastrophal zuspitzenden Situation unterbreiteten Anfang Januar 1947 die beiden Vorsitzenden der SED, Otto Grotewohl und Wilhelm Pieck, dem Obersten Chef der SMAD, Marschall W.D.Sokolowski, Vorschläge des Parteivorstandes der SED zur Verbesserung der wirtschaftlichen Verhältnisse.
Dabei ging die SED auch davon aus, daß es mit der vorgesehenen Industrieproduktion auf der Grundlage des von den Alliierten festgelegten Industrieniveaus nicht möglich sein würde, die Reparationsverpflichtungen aus der laufenden Produktion zu erfüllen und zugleich die Lebenslage der Bevölkerung in der sowjetischen Besatzungszone nennenswert zu verbessern. Die im Dezember 1946 abgeschlossenen Arbeiten am Wirtschaftsplan für 1947 hatten das verdeutlicht. Eingehende Verhandlungen darüber führten zu einer Reihe wichtiger wirtschaftspolitischer Entscheidungen der sowjetischen Regierung. Am 11. Januar 1947 unterrichtete der Oberste Chef der SMAD die beiden Vorsitzenden der SED darüber, daß die Regierung der UdSSR beabsichtige, die Demontagen — nach Zuendeführung der im Gang befindlichen oder schon beschlossenen — endgültig einzustellen. Ausgenommen waren die Ausrüstungen von sieben Kohlengruben, die zur Kompensation der Kriegszerstörungen im sowjetischen Kohlenbergbau dringend benötigt wurden.
Dem Parteivorstand der SED wurde mitgeteilt, daß 200 ursprünglich zur Demontage vorgesehene Großbetriebe, die zwischen dem Frühsommer und dem Herbst 1946 in staatliches sowjetisches Eigentum übernommen worden waren, in Deutschland verbleiben und daß davon 74 Betriebe an die Landesund Provinzialverwaltungen übergeben werden.
Marschall Sokolowski kündigte des weiteren an, daß die Reparationsleistungen aus der laufenden Produktion im Umfang reduziert und in der Struktur verändert würden. Auf die Lieferung von Schuhen, Bekleidung und ähnlichen Konsumgütern sowie von Kali und Zellwolle werde verzichtet. Das spiegelte sich schon in den Reparationsplänen für das Jahr 1947 wider. So wurde dem Land Sachsen im Vergleich zu 1946 eine um 20 Prozent niedrigere Reparationssumme auferlegt, und die Sachleistungen konzentrierten sich weit stärker auf Produktionsmittel und auf solche Konsumtionsmittel, die nicht zu den elementarsten Lebensbedürfnissen der Bevölkerung gehörten. So reduzierte sich der Anteil der Textilerzeugnisse an der Reparationssumme von 21,1 Prozent im Jahre 1946 auf 2,2 Prozent im Jahre 1947. Demgegenüber stieg der Anteil von Erzeugnissen des Maschinenbaus von 13,1 auf 23,0 Prozent an, und die polygrafische Industrie, die 1946 im Reparationsplan unberücksichtigt geblieben war, erhielt Aufträge, die einen Anteil an den Reparationen von 17,4 Prozent ausmachten.
Von entscheidender Bedeutung war, daß sich die UdSSR — gemäß ihren im Rat der Außenminister unterbreiteten Vorschlägen für die Anhebung des künftigen Niveaus der deutschen Industrie — entschloß, das industrielle Niveau in der sowjetischen Besatzungszone auf das Zwei- bis Dreifache von dem, das der alliierte Reparations- und Industrieniveauplan vorsah, zu erhöhen. So gestattete sie, die Produktion von Maschinen für die polygrafische Industrie auf 46 Prozent statt der ursprünglich nur zugestandenen 14 Prozent der Produktion des Jahres 1938 zu erhöhen. Den
Im Katastrophenwinter 1946/47
Handwerkern und kleinen Gewerbetreibenden wurde eine bessere Versorgung mit Rohstoffen und Werkzeugen zugesichert.
Der Parteivorstand der SED, der am 22.Januar 1947 das Verhandlungsergebnis als ein Zeichen des Verständnisses und des Entgegenkommens der sowjetischen Besatzungsmacht gegenüber der deutschen Bevölkerung wertete, zog die Schlußfolgerung, daß sich „gesicherte Grundlagen einer neuen Friedensproduktion“ jedoch nur schaffen lassen, „wenn das deutsche Volk die ihm gegebenen Möglichkeiten zu nutzen versteht und durch eine planmäßige Gestaltung der Wirtschaft, durch schonungslosen Kampf gegen Spekulanten und Wirtschaftssaboteure, durch Hebung der Arbeitsmoral sowie Produktionssteigerung die Voraussetzungen für ein besseres Leben schafft“.
Die wirtschaftspolitischen Entscheidungen der Sowjetregierung bzw. der SMAD kamen allerdings erst im Laufe des Jahres 1947 in ihrer Gesamtheit voll zum Tragen. Die eingeräumten Möglichkeiten für eine höhere Industrieproduktion konnten bis in das 2. Halbjahr 1947 hinein aus sehr unterschiedlichen Gründen noch nicht ausgeschöpft werden.
Die für mitteleuropäische Verhältnisse extremen und lang andauernden Kälteeinbrüche während des Winters 1946/47 verschlechterten die ohnehin erbärmlichen Lebensumstände der Bevölkerung in katastrophaler Weise. Selbst im März gab es an die 18 Frosttage, und das Mittel seiner örtlich tiefsten Temperaturen lag noch bei minus 15,3 Grad Celsius. Doch am schrecklichsten herrschte die Kälte im Januar mit Durchschnittstemperaturen von minus 20,1 Grad Celsius, die besonders in den zerbombten Großstädten mit ihren erst notdürftig wiederhergestellten Wohnmöglichkeiten verheerende Wirkungen zeitigten.
Die strengen Frosttage lösten in weiten Kreisen der Bevölkerung eine Welle der Verzweiflung aus. Es fehlte an Brennstoffen, vor allem an Haushaltskohle, da Braunkohlenförderung und Brikettherstellung zurückgingen. Täglich mußten Gas- und Stromabschaltungen größeren Ausmaßes vorgenommen werden, Wasserleitungen froren zu oder zersprangen, der innerstädtische Verkehr geriet ins Stocken. Die Verkehrsbetriebe vieler Städte schränkten den Straßenbahnverkehr an Sonntagen und in den Abendstunden drastisch ein, um wenigstens den Berufsverkehr einigermaßen aufrechterhalten zu können. Ganze Linien wurden zeitweilig nur von einigen wenigen Triebwagen befahren. Infolge der prekären und sich weiter zuspitzenden Lage im gesamten Transportwesen — viele Lokomotiven waren wegen starker Frostschäden nicht fahrtüchtig zu halten -— kam es um die Wende 1946/47 zu erheblichen Versorgungsschwierigkeiten. Der nackte Hunger bedrohte die Menschen in vielen Gebieten der Ostzone.
PKW mit Holzgasantrieb, 1947
Eine besonders extreme Situation entstand in Berlin, wo es ab Januar 1947 fast gar kein Heizmaterial mehr gab. 200 Menschen setzten angesichts der Not im Januar 1947 ihrem Leben ein Ende. Bis Anfang Februar wurden 134 Todesfälle durch Erfrieren festgestellt. Weitere 1500 Menschen befanden sich in Lebensgefahr, 60000 wiesen Erfrierungserscheinungen auf. Volksküchen verabreichten keine warmen Mahlzeiten mehr, da ihnen die Lebensmittel ausgingen. Besonders gefährdet waren alte Menschen, die sogar in ihren Betten der Kälte und dem Hunger zum Opfer fielen. 200000 Werktätige wurden in Berlin arbeitslos, weil ihre Betriebe schließen mußten. „Der vergangene Winter hat den Berlinern, die doch ganz gewiß nicht zimperlich sind, das Herz abgekauft. Zur Kälte und zum Hunger traten andere Übel, zum Beispiel zahlreiche Kanalisationsschäden und deren infernalische Folgen. Im März schließlich war die Bevölkerung schwer angeschlagen“, schrieb damals Erich Kästner in einer Reportage.“
Doch nicht nur in Berlin — in allen Ländern und Provinzen der Ostzone standen die gesellschaftlichen Kräfte vor einer schier unübersehbaren Fülle schwierigster Aufgaben, die nur durch Mobilisierung der Bevölkerung im Zeichen der Solidarität sowie durch wohlüberlegte Hilfs- und Notmaßnahmen für besonders betroffene soziale Gruppen und Bereiche anzugehen waren. So erhielten Kältearbeitslose auf Betreiben von SED und FDGB eine Unterstützung, die allerdings nicht sehr hoch war. In Sachsen-Anhalt betrug sie 15 Mark in der Woche zuzüglich 2,50 Mark für nicht versorgte Familienangehörige. In Leipzig wurde das Netz der Volksküchen ausgebaut. Zum Preis von 3 Mark und gegen Abgabe von Lebensmittelmarken konnten Essenkarten erworben werden, die zum Bezug von sechs Mahlzeiten berechtigten. Rentner und Unterstützungsempfänger erhielten zusätzlich Verbilligungsausweise. An diesen Speisungen nahmen 1947 95945 Personen teil, davon ein Drittel zu verbilligten Preisen. Die Größenordnung dieser Unterstützungsmaßnahmen wird deutlich, setzt man sie ins Verhältnis zur Einwohnerzahl Leipzigs, die zu diesem Zeitpunkt bei rund 630 000 lag. Volksküchen gab es auch in anderen größeren Städten; daneben waren fahrbare Küchen und Wasserversorgungstrupps im Einsatz.
Vielerorts wurden wie schon im ersten Nachkriegswinter Wärmehallen eingerichtet. In vielen Grundund Oberschulen fiel der Unterricht bis zur Beendigung der Frostperiode aus. Die Schüler erhielten täglich in kurzen Zusammenkünften neue Hausaufgaben oder wurden kurzzeitig in Behelfsräumen — Wohnungen, Gaststätten, Kliniken, Kirchenkanzleien und Wärmestuben unterrichtet. In einigen Ländern erging für Kinos, Theater und Gaststätten ein zeitweiliges Heizverbot. Der Brennstoffmangel lähmte das Leben in Familie und Gesellschaft immer mehr.
Dennoch setzte sich die Mehrheit der Menschen gegen die drohenden Gefahren zur Wehr. Die Volkssolidarität erweiterte ihre Aktivitäten. Kleider-, Bettfedern- und Hausratsammlungen für Umsiedler wurden durchgeführt. Entsprechend der im Januar zwischen Wilhelm Pieck, Otto Grotewohl und Marschall Sokolowski getroffenen Absprache fiel die Lebensmittelkarte sechs ab 1. Februar 1947 weg, wodurch sich die Rationen für Hausfrauen und „Sonstige“ etwas erhöhten. Spenden aus dem Ausland trafen ein — Lebensmittel und Wolldecken aus Irland, Lebertran von den schwedischen Gewerkschaften sowie andere Hilfsgüter.
Die Wintersnot ließ die Bevölkerung in vielen Bereichen zur Selbsthilfe greifen. Fußbodenbretter, Treppengeländer, Zäune, Straßen- und Parkbäume wurden verheizt. Der Kampf ums Überleben ging zwangsläufig mit einem weiteren Verlust an materiellen und kulturellen Gütern einher. Um diesen so gering wie möglich zu halten, rief die SED in Berlin und anderen Orten die Bürger auf, Arbeitskolonnen zu bilden, um Holz aus den umliegenden Wäldern in die Stadt zu holen. Aber auch solche Aktionen konnten unter Umständen zum Raubbau führen. Mancherorts, wie beispielsweise in Berlin, wurde der unkontrollierte Holzeinschlag verboten und durften Bäume nur unter Aufsicht der Gartenämter gefällt werden.
Die Ernährungssituation blieb bis weit in den Sommer hinein besonders angespannt. Schon im März 1947 besaßen große Teile der städtischen Bevölkerung keine Kartoffeln mehr. Von 966 dazu befragten Leipziger Haushalten mußten 70 Prozent ohne dieses Grundnahrungsmittel existieren.
Der unbeschreibliche Mangel führte zu einer beängstigenden Ausweitung des Tauschhandels, des Hamsterns, der Schieberund Kompensationsgeschäfte sowie zu einem erneuten Ansteigen der Kriminalität. Einbrecherund Diebesbanden formierten sich. Die Massendiebstähle in den Kohlenlagern, die Überfälle auf Lebensmittelund Kohlentransporte nahmen zu. In Leipzig ging dadurch im Februar soviel an Kohlen verloren, wie die Stadt für drei Tage Elektrizitätsversorgung benötigte. Diese Situation zwang die Polizeiorgane, gemeinsam mit Werktätigen aus der Industrie den Schutz der Lebensmittelund Kohlentransporte zu übernehmen und gegebenenfalls mit unnachsichtiger Strenge gegen Schieberbanden vorzugehen. Der schwarze Markt, der sich mit beginnender Warenverknappung bereits im Laufe des Krieges herausgebildet hatte, nahm größte Ausmaße an. Hunger und Mangel an lebenswichtigen Gütern, auch der Rückgang ihrer Ersparnisse, wovon insbesondere die Rentner betroffen waren, veranlaßten viele Bürger zu Notverkäufen und anderen Schwarzmarktunternehmungen. Zentren des Schwarzhandels waren meist die Bahnhofsvorhallen der Städte oder zentral gelegene städtische Plätze und Parks. Kaufen konnte man auf dem schwarzen Markt, an dem sich auch Angehörige der Besatzungstruppen beteiligten, so gut wie alles vom Scheuerlappen bis zur Lebensmittelkarte, von dringend benötigten Streichhölzern oder Kerzen bis zu teuren Pelzen oder gültigen Arbeitsbüchern und nicht zuletzt Eßwaren. Für Lebensmittel und Industriegüter waren je nach Angebot und Nachfrage horrende Preise zu zahlen. Auch besonders begehrte Mangelwaren Zigaretten, Kaffee, Nylonstrüämpfe — wurden als Entgelt genommen. Zeitweise bildete sich eine regelrechte Zigarettenwährung heraus. Die meisten der auf dem schwarzen Markt anzutreffenden Käufer oder Verkäufer waren einfache Werktätige, „Normalverbraucher“, wie sie damals hießen, die dort Notverkäufe tätigten oder ihre Ersparnisse und auch andere Besitztümer benutzten, um Lebensmittel und weitere lebenswichtige Güter zu erwerben. In keinem Arbeiterhaushalt reichte der Verdienst aus, um die notwendigen Ausgaben zu bestreiten.

Dies demonstrierten Erhebungen über die Lebenshaltung einiger hundert Metallarbeiter bis weit in den Herbst 1947 hinein. Die Nettoeinnahmen im Oktober (niedrigster Lohn 130,80 RM, höchster Lohn 351 RM netto) deckten beispielsweise in Berlin, der Stadt mit der größten Zahl hochqualifizierter Facharbeiter, nur 50,1 Prozent der Haushaltsausgaben. Kauften in der übrigen Besatzungszone nur 48,3 Prozent aller Haushalte Brot, Kartoffeln, Nährmittel, Süßstoff, Gemüse und Kerzen auf dem schwarzen Markt, so in Berlin 89,6 Prozent.’’ Die Gefahr, bei dieser Art von Geschäften betrogen zu werden, etwa Gips statt Mehl, technische Öle statt Speiseöl einzuhandeln, war groß. Werktätige wiederum verkauften ihrerseits auf dem Lande erhamsterte Lebensmittel zu so stark überhöhten Preisen, daß sie damit nicht selten ein Mehrfaches ihres sonstigen Monatslohnes erzielten. Schleichhandel und Schwarzmarktgeschäfte übten einen äußerst negativen Einfluß auf das Arbeitsverhalten aus, führten zur Arbeitsbummelei und hemmten die Produktivität der sowieso unter den Kriegsfolgen und der Wintersnot leidenden Industrie weiter. Die demoralisierenden Wirkungen erfaßten auch Kinder und Jugendliche. Wie mehrfach durch die Presse bekannt wurde, entwendeten Kinder ihren Eltern oder Bekannten nicht selten die letzten Wertgegenstände und veräußerten sie auf dem schwarzen Markt.
Plünderung eines Kohlenzuges, 1946/47
Der schwarze Markt vor dem Leipziger Hauptbahnhof, 1947
Zahlreiche Betriebe suchten der Arbeitsbummelei, durch eigene Schwarzmarktgeschäfte entgegenzuwirken. Unternehmer, aber auch Vertreter volkseigener Betriebe verkauften der offiziellen Bewirtschaftung entzogene Waren und Produkte ihrer Fabriken auf dem schwarzen Markt, weil sie ihre Belegschaften durch Naturalprämien in Arbeit halten wollten. Die sächsischen Strumpffabrikanten verteilten monatlich an jeden ihrer etwa 60000 Arbeiter zwei bis vier Paar Strümpfe, die der allgemeinen Versorgung verlorengingen und vornehmlich im interzonalen Schwarzhandel verschwanden. Daneben liefen im gesamten Zonengebiet meist noch umfängliche Kompensationsgeschäfte von Werk zu Werk, bei denen Rohstoffe, Ersatzteile und Finalprodukte gegeneinander getauscht wurden. Die Desorganisation der Wirtschaft nahm unter diesen Umständen zeitweilig bedrohliche Formen an, zumal neben den genannten gelegentlich an Schwarzmarktgeschäften beteiligten Bevölkerungskreisen gewerbsmäßige Schwarzhändler existierten, von denen die Großschieber meist eindeutig der kriminellen Szene angehörten. Bei den meisten Werktätigen waren diese auf großem Fuße lebenden Schieber außerordentlich verhaßt, und sie begrüßten entsprechende polizeiliche Maßnahmen.
SMAD, Polizei und Verwaltungsorgane überwachten die Entwicklung des schwarzen Marktes nach ihren Möglichkeiten sorgfältig und suchten sie mit der Einrichtung behördlich genehmigter Tauschmärkte und Tauschzentralen sowie durch Polizeirazzien in Grenzen zu halten. Hunderte, ja Tausende von Händlern, Käufern und Verkäufern wurden bei solchen Kontrollen schlagartig hinsichtlich ihrer Personalien befragt, unter Umständen zeitweise festgenommen oder einer geregelten Arbeit zugeführt. Beschlagnahmte Waren gelangten dann in Krankenhäuser, Kinderoder Altersheime. Die ganz großen Schieber erwischte man bei solchen Aktionen allerdings selten, da sie meist Strohmänner vorschickten und außerdem selbst über nicht anzufechtende Personalund Arbeitspapiere verfügten.
Allein durch Polizeiaktionen und Volkskontrollen konnte der schwarze Markt nicht beseitigt werden. Sogar die Androhung der Todesstrafe für Großschieber hatte nur bedingt abschreckende Wirkung. Der schließlich einzig erfolgversprechende Weg, dieses illegale und irreguläre Geschäftemachen zu überwinden, bestand darin, die Warenknappheit durch Steigerung der Produktion zu beheben. Bis zum Erreichen dieses Ziels war mit dem Phänomen des schwarzen Marktes nicht fertigzuwerden.
„… und ich sage ihnen, wir müssen eben alle miteinander leiden.“ Karikatur „Lebensmittel-Transport-Begleiter“ von Rudolf Schlichter aus „Ulenspiegel. Zeitschrift für Literatur, Kunst und Satire“, Berlin, 14. Januar 1947
Zwei Kriege — zwei Witwen. Tempera von Max Lingner, 1946. Staatliche Museen zu Berlin, Nationalgalerie/DDR
Der Katastrophenwinter 1946/47 sowie der ihm unglücklicherweise folgende Dürresommer unterhöhlten Gesundheitszustand und Leistungsfähigkeit der Bevölkerung in bedenklicher Weise. Unterernährung und Kälte, später sengende Hitze durchschnittlich herrschten in den Sommermonaten um die 33 Grad Celsius — führten zu schweren körperlichen und seelischen Erschöpfungszuständen bei vielen Menschen.
Frauen im Spannungsfeld von Überlebenskampf und Ringen um Gleichberechtigung
Besondere Leistungen erbrachten in den Nachkriegsjahren die zumeist für die Ernährung und Bekleidung ihrer Familien zuständigen Frauen, vor allem aber die vielen alleinstehenden Mütter, die nur über geringe Geldmittel verfügten. Es waren in erster Linie Frauen, die stundenlang nach Lebensmitteln anstanden, die Hungergerichte kochen mußten, die nähten und flickten und um ihrer Kinder willen nicht selten eigene Ernährungsbedürfnisse zurückstellten. Das enorme Anwachsen des Frauenanteils der Bevölkerung prägte die Sozialstruktur der Ostzone längerfristig und machte entsprechende frauenpolitische Maßnahmen erforderlich. Zwar waren in Deutschland bereits um die Jahrhundertwende mehr als 30 Prozent der weiblichen Bevölkerung berufstätig, die überdurchschnittlich hohe Zahl der Kriegswitwen und alleinstehenden Frauen sowie die von den Alliierten angeordnete Arbeitspflicht konfrontierten die antifaschistischen Verwaltungsorgane aber mit dem Problem, einer weitaus höheren, wachsenden Anzahl von Frauen — um die Jahreswende 1946/47 gab es rund 4948 000 arbeitsfähige Frauen — Arbeit in einer kriegszerstörten, von Demontagen betroffenen Wirtschaft zu verschaffen, die über ein derartiges Angebot an Frauenarbeitsplätzen nicht verfügte und vorwiegend nur schwere körperliche Arbeit zu vermitteln hatte. Zwar kofnte ein gewisser Prozeritsatz der arbeitsuchenden Frauen in frauentypischen Industrien — etwa der Textilindustrie — untergebracht werden, doch vor allem gingen sie in solche Wirtschaftszweige, die einen hohen Anteil an nichtqualifizierten Arbeitskräften benötigten, wie beispielsweise die Landwirtschaft und der Torfstich. Zu diesem Zeitpunkt verzeichneten auch der Hochund der Tiefbau eine hohe Quote an weiblichen Erwerbstätigen: die sögenannten Trümmerfrauen, die — von der Qualifizierung her Hilfsarbeiterinnen wesentlich daran beteiligt waren, die Ruinenstädte vom Schutt zu befreien. Größtenteils hatten also Frauen schwere körperliche Arbeit zu leisten. Selbst im Bergbau, meist in den Braunkohlentagebauen, wurden sie eingesetzt. Sie erklärten sich zu solchen Arbeiten in erster Linie wegen der dafür erhältlichen höheren Lebensmittelrationen bereit.
Für viele Frauen, die bisher keinen Beruf ausgeübt hatten, waren mit der Arbeitsaufnahme schwierige Lernprozesse verbunden. Auch sie mußten sich nun der industriellen Disziplin unterordnen und in Betriebsbelegschaften einfügen oder ungewohnte körperliche Arbeit leisten. Nicht jede bewältigte diese Anforderungen sofort, zumal für Hausarbeit und Kindererziehung kaum gesellschaftliche Dienstleistungen angeboten werden konnten. Noch oft genug betrachteten die männlichen Kollegen Frauen als Konkurrentinnen und versagten ihnen Hilfe und solidarische Unterstützung. Es kam auch vor, daß Frauen besonders unangenehme Arbeit zugewiesen wurde. Die Berufstätigkeit erwies sich trotzdem für die meisten weiblichen Erwerbstätigen als der entscheidende Schritt in die Unabhängigkeit. Sie setzten sich durch, erkämpften sich neue Entscheidungs- und Handlungsräume und gewannen so ein Stück Gleichberechtigung, wenn auch in äußerst konfliktreichen und aufreibenden Prozessen. Im allgemeinen erhielten Frauen 70 bis 80 Prozent, manchmal auch nur 51 Prozent des Männerlohnes. Stundenlöhne von 50, ja von 34 Pfennigen waren keine Seltenheit. Die in der kapitalistischen Gesellschaftsordnung übliche Praxis der niedrigen Frauenentlohnung blieb — Ausnahmen bildeten von vornherein die Entlohnung der Trümmerfrauen und die der im Bergbau eingesetzten weiblichen Arbeitskräfte — auch nach Erlaß des SMAD-Befehls Nr. 253 vom 17. August 1946 „Gleicher Lohn für gleiche Arbeit“ noch lange in der Lohnpolitik vieler Betriebe wirksam. „Mit 23 RM Bruttolohn bei 48 Stunden Arbeitszeit kann aber die Frau, die heute oft der Ernährer ihrer Familie ist, nicht existieren“, schrieb die Sekretärin des FDGB-Bundesvorstandes, Friedel Malter, Ende 1947 im Hinblick auf die nach wie vor niedrigen Löhne in ausgesprochenen Frauenindustrien. „Der Reallohn ist trotz Preisstopp ganz erheblich gesunken, und es ist nicht selten, daß Arbeiterinnen von ihrem geringen Verdienst nicht einmal die ausgeteilten Rationen kaufen können.“
Mit der Gründung des DFD im März 1947 erhielten die Frauen eine eigene politische Interessenvertretung. SED, Verwaltungsorgane und demokratische Massenorganisationen unternahmen große Anstrengungen, sie in ihrem Bemühen um Gleichberechtigung zu fördern. Der FDGB aktivierte die gewerkschaftliche Frauenarbeit und unterstützte vor allem die weiblichen Betriebsräte bei der Realisierung des Befehls Nr.253. In den Sitzungen des Parteivorstandes der SED setzten sich Käthe Kern, Elli Schmidt und andere Frauenfunktionärinnen mit Nachdruck für die Belange der Frauenbevölkerung ein und wiesen auf deren besonders schwere Lage hin. Dennoch war die jahrtausendealte Zurücksetzung des weiblichen Geschlechts nur schrittweise, in längerfristigen Prozessen aufzuheben. Begrenztheiten der Frauenemanzipation in den vierziger Jahren ergaben sich zum Teil aus der schlechten kriegs- und nachkriegsbedingten wirtschaftlichen Lage, weit mehr jedoch aus den traditionellen Lebensbedingungen und Normen, langlebigen Gewohnheiten und Denkmustern bei Männern und auch Frauen, die nur Haushalt und Familie als eigentliches Hauptfeld weiblicher Aktivitäten gelten ließen.
Von progressiven Kräften wurde jedoch schon in dieser revolutionären Umbruchphase die traditionelle Rollenzuweisung für die Geschlechter in Frage gestellt und mit ersten praktischen Maßnahmen ein Wandel in der gesellschaftlichen Stellung der Frau eingeleitet. Dabei gab es auch kurzschlüssige Auffassungen, das Haupthindernis für die Lösung der Frauenfrage in relativ schnell zu überwindenden ideologischen Unklarheiten zu sehen. In erster Linie aber suchten die SED, antifaschistisch-demokratische Verwaltungen und Massenorganisationen beharrlich und mit großem Engagement, selbst unter den schwierigen Nachkriegsbedingungen ein Netz sozialer Einrichtungen zu schaffen, das den Frauen helfen sollte, Berufstätigkeit und familiäre Verpflichtungen in einen gewissen Einklang zu bringen. Dazu gehörten die Schaffung von Möglichkeiten zur Unterbringung der Kinder, die Einrichtung von Nähstuben und Reparaturstützpunkten, aber auch die Gewährung von Haushaltstagen, die Ausgabe von Spätverkaufsausweisen sowie die Bereitstellung von Erholungsreisen für besonders geforderte Frauen mit Kindern. Ehe- und Sexualberatungsstellen wurden geschaffen, doch trafen ihre Bemühungen zunächst noch auf große Zurückhaltung.
Die ersten Polizistinnen nehmen ihren Dienst auf, Dresden 1946
Berliner Trümmerfrauen, 1947
1946/47 stellten Angehörige der SED-Fraktionen in den Landtagen der sowjetischen Besatzungszone Anträge auf den Erlaß von Gesetzen, die eine Schwangerschaftsunterbrechung bei medizinischer, ethischer und sozialer Indikation für zulässig erklären sollten. Nach außerordentlich langwierigen, kontroversen Diskussionen sowie mehreren Lesungen in allen Landtagen wurden entsprechende Gesetze angenommen, die in der Endkonsequenz den Paragraphen 218 des BGB beträchtlich einschränkten. Von der Mehrheit der Landtagsabgeordneten in Sachsen-Anhalt wurde jedoch die soziale Indikation für eine Schwangerschaftsunterbrechung nicht anerkannt, obwohl sich insbesondere Käthe Kern, die schon als Leiterin des Berliner Frauensekretariats der SPD in der Weimarer Republik die traurigen Auswirkungen dieses Paragraphen kennengelernt hatte, sehr engagiert dafür einsetzte. In den anderen Ländern fanden die Anträge nur unter dem Vorbehalt Zustimmung, daß bei Stabilisierung der Lebensverhältnisse die Zulassung der sozialen Indikation wieder rückgängig gemacht werden müsse, was später auch geschah. Indes stellten die Lockerung des Paragraphen 218 und die Legalisierung der sozialen Indikation angesichts der Nachkriegsnöte eine wichtige Maßnahme dar, die der Gesunderhaltung zahlloser Frauen diente und zugleich schweren sozialen Nöten vorbeugte.
Arbeiterwiderstand gegen Betriebsrückgaben. Die Enteignung der Bodenschätze
Im Herbst 1946 verstärkten enteignete Unternehmer ihren Druck auf die demokratischen Verwaltungsorgane, um Enteignungsbeschlüsse rückgängig zu machen. Sie hatten dabei — ebenso wie andere, die sich um Einstufung in die Rückgabelisten bemühten nicht selten Erfolg, zumal ihre Anträge vielfach von Funktionären der bürgerlich-demokratischen Parteien auf örtlicher Ebene befürwortet wurden.
In Sachsen nahmen Vertreter von LDPD und CDU im Januar 1947 die von der Landessequesterkommission beschlossene Rückgabe von ca. 90 Betrieben an die ehemaligen Eigentümer zum Anlaß, um die Revision der Enteignungsbeschlüsse für ein Sechstel der in gesellschaftliches Eigentum übergegangenen Betriebe zu fordern. LDPD und CDU unterbreiteten jeweils Listen von 211 bzw. von 89 Betrieben, die zurückgegeben werden sollten. Ein Vertreter der CDU griff in der Verfassungsdebatte im Landesparlament offen den im Vorjahr durchgeführten Volksentscheid an.
Angesichts der massiven Revisionsversuche und offenen Angriffe gegen den Volksentscheid formierte sich die sächsische Arbeiterschaft zur Gegenwehr. Es entstand eine sich über das ganze Land ausbreitende Protestbewegung. In Chemnitz drohten am 21. Januar 1947 Arbeiter, gegen diese Machenschaften in den Streik zu treten. Zwei Tage später traten die Belegschaften der ehemaligen Firmen Kurt Zilke in Doberschau und Friese in Kirschau, die nach dem Willen reaktionärer Politiker zurückgegeben werden sollten, in den Ausstand. Sie fanden die Unterstützung ihrer Kollegen in Betrieben der Kreisstadt Bautzen, die für den 24. Januar einen Solidaritätsstreik beschlossen. 950 Betriebsräte aus Lausitzer Betrieben fanden sich am 24.Januar zu einer außerordentlichen Betriebsrätetagung in Bautzen zusammen, um gegen die Rückgabe von Betrieben an solche Unternehmer, die sich als Kriegsund Naziverbrecher erwiesen hatten, energisch zu protestieren. Mit der Begründung, daß die Arbeiterschaft nicht gewillt ist, sich die schwer erkämpften Errungenschaften wieder entreißen zu lassen, forderten sie die Landesregierung auf, bis zum 28. Januar die Ergebnisse des Volksentscheids unmißverständlich zu bestätigen. Für den Fall, daß dies nicht geschehen würde, kündigten sie für den gleichen Tag den Generalstreik an.
Die entschiedenen Abwehraktionen bewirkten, daß es am 24. Januar 1947 zu einer außerordentlichen Regierungssitzung kam, zu der auch Vertreter des Landesblockausschusses und Gewerkschafter eingeladen wurden. Während die SED-Mitglieder Otto Buchwitz, Wilhelm Koenen, Kurt Fischer und Fritz Selbmann die Forderungen der Arbeiter unterstützten, erhoben die Vertreter von CDU und LDPD mit Hugo Hickmann und Hermann Kastner an der Spitze Einwände. Alwin Golbs (SED), Betriebsrat der Firma Petz und Paul in Bautzen, schilderte den Verlauf der Sitzung wie folgt: „Die Vertreter der bürgerlichen Parteien, besonders Kastner, Hickmann und Freitag, lehnten unsere berechtigten Forderungen ab Hickmann meinte, die Besitzer seien keine Kriegsverbrecher oder -gewinnler und hätten sich nur minimal an der Kriegsproduktion beteiligt. Ministerpräsident Friedrichs fragte die Vertreter der CDU und der LDPD, ob sie den drohenden Generalstreik verhindern oder durch ihr Verhalten fördern wollten. Eine Anfrage des Wirtschaftsministers Selbmann nach etwaigem Polizeieinsatz verneinte Innenminister Fischer… Nach dreistündiger Debatte, die teilweise recht erregt verlief, konnten sich die Vertreter der bürgerlichen Parteien unseren Forderungen nicht länger verschließen und akzeptierten diese. Weiterhin vereinbarten wir, daß die Arbeit am Montag wieder aufgenommen und die drei Streiktage den Arbeitern voll bezahlt wurden.“ * Die Vertreter der Landesregierung, des Landesblockausschusses und die Delegationen der Arbeiter nahmen einstimmig eine Resolution mit folgendem Wortlaut an: „Die Landesregierung und der Block der antifaschistisch-demokratischen Parteien und der FDGB betrachten grundsätzlich die Gnadenaktion zum Volksentscheid als abgeschlossen. Die Kommissionsbeschlüsse über die Rückgabe enteigneter Betriebe müssen der Vertretung der Belegschaften der betroffenen Betriebe zur Stellungnahme vorgelegt werden, bevor die Landesregierung einen endgültigen Beschluß faßt. Die Vertreter der Belegschaften haben in der Verhandlung die Überzeugung gewonnen, daß von einer Absicht der Sabotage des Volksentscheides in der Vergangenheit nicht gesprochen werden kann.“
Mit dieser Resolution wurde den Versuchen, die notwendige, begründete Rückgabe einzelner Betriebe in eine großangelegte Revisionskampagne zu verwandeln, entgegengetreten. Im letzten Teil der Resolution waren die Vertreter der Arbeiter bzw. die Mitglieder der SED, im Interesse der Festigung und Fortführung der Blockpolitik und auf den zunehmenden Einfluß der progressiven Kräfte in CDU und LDPD vertrauend, einen Kompromiß eingegangen. Der Erfolg der Arbeiterklasse drängte reaktionäre Kräfte in CDU und LDPD zurück, aber er hob die unterschiedlichen Positionen der SED und der bürgerlich-demokratischen Parteien zum volkseigenen bzw. zum privatkapitalistischen Sektor nicht auf. Auch in der Folge erhoben Vertreter von CDU und LDPD ungerechtfertigte Rückgabeforderungen. Dabei versuchte man oft, sich über den mitgetragenen Beschluß, die Belegschaften der jeweiligen Betriebe zu befragen, hinwegzusetzen.
In der entstandenen Situation erachtete es die SED für politisch wichtig, den von den Bergarbeitern in allen Besatzungszonen erhobenen Forderungen nach Überführung der Bodenschätze und der Bergbaubetriebe in gesellschaftliches Eigentum zu entsprechen. Die Landesleitung Sachsen der SED legte einen von der Industriegewerkschaft Bergbau ausgearbeiteten Gesetzentwurf zur Beschlußfassung im Landtag vor. Auf der 20. Sitzung des Sächsischen Landtages am 8. Mai 1947 konnte das Gesetz über die Überführung aller bergbaulichen Unternehmen und Bodenschätze in das Eigentum des Landes Sachsen unter Zustimmung aller Fraktionen angenommen werden.
Im Landtag von Sachsen-Anhalt und im Thüringer Landtag kam es dagegen über gleichartige, von der SED eingebrachte Gesetzentwürfe zu heftigen Auseinandersetzungen. Im Wirtschaftsausschuß des Landtages von Sachsen-Anhalt wurde fünf Monate über den entsprechenden Gesetzentwurf verhandelt, ohne daß eine Einigung erzielt werden konnte. Erst nach einer eingehenden Debatte der Vorsitzenden der Landtagsfraktionen wurde der Weg zur Annahme des Gesetzes frei, die am 30.Mai 1947 erfolgte. In Thüringen stand das Gesetz ebenfalls am 30. Mai 1947 auf der Tagesordnung des Landtages. Bei der Abstimmung sprachen sich die Abgeordneten der CDU und der LDPD gegen das Gesetz aus; es wurde lediglich mit den Stimmen der SED-Vertreter angenommen. Eine einstimmige Annahme von Gesetzen gleichen Inhalts konnte am 28. Juni 1947 in den Landtagen von Mecklenburg und Brandenburg erreicht werden.
Die Gesetze verfügten übereinstimmend die Überführung der volkswirtschaftlich wichtigsten Bodenvorkommen in Landeseigentum. Sie erstreckten sich auf sämtliche Lagerstätten von Steinkohle, Braunkohle, Phosphaten, Erzen, Kali und anderen Salzen, von Kaolin, Bauxiten, Erdöl, Erdgas und anderen Bodenschätzen. Von nun an lagen Erkundung und Gewinnung der Bodenschätze in der Kompetenz der Landesbehörden. Den Regierungen war es gestattet, diese Kompetenz auf andere zu übertragen. Des weiteren ordneten die Gesetze die Enteignung aller privatkapitalistischer Bergbauunternehmen an, wobei für die kleinen und mittleren bzw. politisch unbelasteten Unternehmer die Möglichkeit einer Entschädigung vorgesehen war.
Mit diesen Gesetzen gingen die Landtage über die Verordnungen zur Enteignung der Kriegsund Naziverbrecher von 1946 insofern hinaus, als es sich bei diesen Eigentumsveränderungen nicht mehr um Sühnemaßnahmen handelte, sondern darum, das Kapitalverhältnis in einem entscheidenden Volkswirtschaftszweig völlig aufzuheben. Durch die neuen Gesetze wurden die im Sommer 1946 gegen die Kriegsund Naziverbrecher im Montanwesen getroffenen Entscheidungen bekräftigt und damit jenen, die mit allen Mitteln versuchten, die Errungenschaften der antifaschistisch-demokratischen Umwälzung zu beseitigen, eine politische Niederlage bereitet. Das ökonomische Gewicht der durch diese Gesetze nunmehr in Landeseigentum übergehenden Produktionsstätten war allerdings geringer als das der im Sommer 1946 enteigneten. Die Liste der durch das Gesetz vom 8. Mai 1947 in Sachsen betroffenen Unternehmen beispielsweise umfaßte lediglich acht kleinere Braunkohlenbergwerke und eine Schwerspatgrube.
Die Enteignung der Bodenschätze zugunsten der Länder war von großer politischer Bedeutung für den Kampf der Bergarbeiter in den Westzonen, die ebenfalls für die Enteignung des Monopolkapitals eintraten. Auf der 2. Interzonenkonferenz der Bergarbeitergewerkschaften, die Ende Mai 1947 in Halle stattfand, sprachen sich die Bergarbeiterfunktionäre aus allen Besatzungszonen Deutschlands in einer EntschlieBung zur wirtschaftlichen und politischen Lage dafür aus, mit einer von den Gewerkschaften der Bergarbeiter getragenen breiten Massenbewegung die Annahme von Gesetzen zur Enteignung der Bergbaubetriebe in den Parlamenten durchzusetzen.
Der Kurs der Magistratsmehrheit auf Anschluß Berlins an die Entwicklung in den Westzonen
In Berlin sahen sich die fortschrittlichen Kräfte nach den Wahlen im Oktober 1946 vor große Schwierigkeiten gestellt. Zwar erfolgte die Bildung des Magistrats gemäß der vorläufigen Verfassung von Groß-Berlin aus Vertretern aller vier Parteien, faktisch gingen aber die SPD und die beiden bürgerlichen Parteien eine gegen die SED gerichtete Koalition ein. Damit veränderte sich die politische Szenerie tiefgreifend. Jene Politiker, die die Berliner Organisation der SPD beherrschten, verfolgten den Kurs einer Frontbildung gegen die SED. Es entstand die Gefahr, daß die in den Betrieben und Wohngebieten errungene und in den Einheitsgewerkschaften verkörperte Aktionseinheit der Arbeiterklasse wieder zerbrach. An der Haltung der SPD-Führung scheiterten die Bemühungen der SED, die Zusammenarbeit im Berliner Blockausschuß wieder zu beleben.
Die Situation war vor allem auch dadurch belastet, daß die Westmächte versuchten, Berlin unter Mißbrauch ihres Anwesenheitsrechtes zum Faustpfand einer Gesamtpolitik zu machen, die mehr und mehr von den alliierten Vereinbarungen abrückte. Die vier Sektoren Berlins gehörten zwar zur sowjetischen Besatzungszone — am 25. Februar 1947 bekräftigte der Alliierte Kontrollrat dies im Bericht an den Rat der Außenminister noch einmal mit der Formel, Berlin sei zwar von den vier Mächten gemeinsam besetzt, aber „gleichzeitig die Hauptstadt der Sowjetischen Besatzungszone“°! -, jedoch waren nur im sowjetischen Sektor konsequent antifaschistisch-demokratische Umsgestaltungen nach Buchstaben und Geist des Potsdamer Abkommens erfolgt. In den Westsektoren vollzog sich unter der Oberhoheit der Westmächte hingegen ein restaurativer Prozeß.
Im Sinne der vom Parteivorstand der SED zum Wahlausgang eingenommenen Position, „die durch die Wahl geschaffene Mehrheit der Sozialdemokratischen Partei und der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands im Interesse des werktätigen Volkes wirksam zu machen“ und „die konsequente Politik der Demokratie und des Friedens weiter zu sichern“, nahm die SED in der Berliner Stadtverordnetenversammlung ihre Tätigkeit auf. Ihre Kommunalpolitik war darauf gerichtet, durch gemeinsame Aktionen mit der SPD und den Gewerkschaften sowie mit anderen progressiven Kräften den demokratischen Neuaufbau in ganz Berlin voranzubringen.
Zwei Tage nach Konstituierung der Stadtverordnetenversammlung, am 28. November, unterbreitete die SED-Fraktion den Entwurf für eine „Verordnung zur Enteignung von Vermögenswerten der Kriegsverbrecher und Naziaktivisten“. Sie forderte die sozialdemokratische Fraktion auf, sich gemeinsam für die Enteignung der Kriegsverbrecher und Naziaktivisten einzusetzen. Dabei knüpfte sie an die im Sommer 1946 im Berliner Blockausschuß und im ersten Magistrat ergriffenen Initiativen zur Entmachtung des Monopolkapitals nach dem Beispiel des Landes Sachsen an und berief sie sich auf die erste Berliner Betriebsrätevollversammlung vom 15. Oktober 1946, die einmütig die Bestrafung und die entschädigungslose Enteignung der Kriegsverbrecher gefordert hatte. Die SPD wich dem Angebot der SED aus und brachte den Entwurf eines „Gesetzes zur Überführung von Konzernen und sonstigen wirtschaftlichen Unternehmen in Gemeineigentum“ ein. Dieser war nicht auf die Entmachtung der Kriegsverbrecher und Naziaktivisten konzentriert, sondern stellte die Vergesellschaftung von Großbetrieben schlechthin in den Mittelpunkt. Die Enteignung sollte — mit Ausnahme bei den Kriegsverbrechern und Naziaktivisten — gegen eine Entschädigung erfolgen. Dieser Gesetzentwurf basierte auf den „Sozialisierungsleitsätzen“ der SPD, wie sie auf deren Parteitag im Mai 1946 in Hannover beschlossen worden waren. Die SED stellte die Gemeinsamkeiten der beiden Entwürfe in den Vordergrund und schlug im Einklang mit dem von den Mitgliedern beider Parteien in den Betrieben geführten Kampf ein Zusammenwirken im Stadtparlament vor.
Die von der Betriebsrätekonferenz beschlossene Unterschriftensammlung für die Enteignung erbrachte bis Mitte Februar 1947 rund 100000 Einzeichnungen in etwa 1600 Betrieben. Unter dem Druck dieser starken außerparlamentarischen Volksbewegung kam zumindest partiell eine Zusammenarbeit von SED und SPD in der Stadtverordnetenversammlung bzw. in deren Wirtschaftspolitischem Ausschuß zustande. Die Fraktionen beider Parteien einigten sich, die beiden Entwürfe als einander ergänzend zu behandeln. Am 13. Februar beschloß die Stadtverordnetenversammlung mit den Stimmen von SED, SPD und CDU das auf den SPD-Entwurf zurückgehende gleichnamige „Gesetz zur Überführung von Konzernen und sonstigen wirtschaftlichen Unternehmen in Gemeineigentum“ und einen reichlichen Monat später -— am 27. März 1947 dann einstimmig die von der SED eingebrachte „Verordnung zur Einziehung von Vermögenswerten der Kriegsverbrecher und Naziaktivisten“. Ferdinand Friedensburg (CDU), 1. Bürgermeister (Stellvertreter des Oberbürgermeisters) im Magistrat -— nachdem er seines Postens als Präsident der Deutschen Zentralverwaltung der Brennstoffindustrie entbunden worden war -, äußerte rückschauend, bei der Annahme dieser Gesetze habe sich „die Zusammenarbeit zwischen der Sozialistischen Einheitspartei und den Sozialdemokraten als entscheidender Faktor“ erwiesen, „demgegenüber die beiden nichtsozialistischen Minderheitsparteien nur teilweise unter Mitmachen oder Ausweichen Änderungen anfügen konnten“.
Berlin war trotz starker Kriegszerstörungen eines der bedeutendsten industriellen Zentren. Hier hatten noch immer die Direktionen solcher Konzerne wie Siemens und AEG ihren Sitz. Andere Konzerne unterhielten Filialen oder Büros, um auf die in der Ostzone gelegenen Teilbetriebe Einfluß zu nehmen und die Konzernbindungen aufrechtzuerhalten.
Nur im sowjetischen Sektor war Kriegsverbrechern und Naziaktivisten durch Sequestrierungen auf der Basis des SMAD-Befehls Nr. 124 vom 30. Oktober 1945 die wirtschaftliche Verfügungsgewalt genommen.
Die Durchsetzung der beiden Gesetzesvorlagen in der Stadtverordnetenversammlung zeigte, welche Möglichkeiten für ein Vorantreiben progressiver Entwicklungen noch immer bestanden, wenn SED und SPD gemeinsam handelten und die Kraft der Einheitsgewerkschaften mit ihren 725000 Mitgliedern zur Wirkung kam. Die SPD-Führer betrieben jedoch als Grundlinie die Zusammenarbeit mit CDU und LDPD, deren großbürgerliche Führungskräfte eng mit den Elektrokonzernen AEG und Siemens und anderen Konzernen verbunden waren. In der Magistratsarbeit dominierte zunehmend ein Kurs, der auf den Abbau der 1945/46 in ganz Berlin erkämpften progressiven Errungenschaften gerichtet war. So faßte die Stadtverordnetenversammlung am 14. Februar 1947 gegen die SED-Stimmen den Beschluß, die Frauenund die Jugendausschüsse beim Magistrat und bei den Stadtbezirksverwaltungen aufzulösen.
Unter dem Druck der Bevölkerung leitete der Magistrat einige Maßnahmen zur Linderung der Wintersnot ein. Ende Februar 1947 begann Oberbürgermeister Otto Ostrowski (SPD) Gespräche mit dem sowjetischen Stadtkommandanten, Generalmajor A.G. Kotikow, und ging auf das Angebot des SEDLandesvorstandes zu Verhandlungen über ein auf drei Monate befristetes Arbeitsprogramm von SED und SPD zur Behebung der äußersten Not der Bevölkerung ein. Damit fiel er bei der amerikanischen Besatzungsmacht in Ungnade. Captain Biel von der US-Militärregierung sandte ein Schreiben an den SPD-Vorstand mit folgenden Worten: „Dr. Ostrowski hat eine Wendung um 180° zu den Bolschewiken hin gemacht. Er ist als das trojanische Pferd innerhalb der SPD zu betrachten. Er hat zu verschwinden.“°* Von seiten der im SPD-Landesvorstand Groß-Berlin bestimmenden Anhänger des Schumacher-Kurses wurde ein politisches Kesseltreiben entfacht: Man brauche keinen Ostrowski, sondern einen Westrowski. Am 17. April 1947 war der Oberbürgermeister genötigt, sein Amt niederzulegen. Zur Wahl als Nachfolger im Amt präsentierte die SPD auf dringliche Empfehlung der Amerikaner Ernst Reuter, einen Renegaten der revolutionären Arbeiterbewegung mit extrem antikommunistischer bzw. antisowjetischer Haltung. Im November 1946 mit Hilfe des amerikanischen Geheimdienstes aus türkischem Exil nach Berlin zurückgekehrt, war er zum Stadtrat für Verkehr und damit in ein Amt gewählt worden, das er bereits vor 1933 im Berliner Magistrat bekleidet hatte. Die sowjetische Seite legte gegen Reuters Nominierung in der Alliierten Stadtkommandantur ihr Veto ein.
Berlin 1947 — hungernde Mutter. Aquarell von Paul Fuhrmann, 1947. Armeemuseum, Dresden
Die Nominierung Reuters ging mit zahlreichen Schritten einher, die progressive Entwicklung in der ganzen Stadt zum Stillstand zu bringen und in den Westsektoren den restaurativen Kurs zu verstärken. Im Zusammenhang mit den Gewerkschaftswahlen versuchten antikommunistisch eingestellte Funktionäre, die Gewerkschaften zu spalten. In den Westsektoren erfolgte ein Wiederaufbau der Unternehmerverbände. Auch wurde hier die Entnazifizierung in eine Farce verwandelt, wie der Fall des Siemens-Direktors Wolf-Dietrich von Witzleben signalisierte. Noch im Oktober 1946 hatte die Spandauer Spruchkammer dessen Entnazifizierungsantrag zurückgewiesen; im Februar 1947 aber stufte sie — inzwischen unter neuem Vorsitz — den ehemaligen faschistischen Wehrwirtschaftsführer als „Mitläufer“ ein. Ähnliches erreichten auch andere stark belastete Wirtschaftsführer, wie der Telefunken-Direktor Martin Schwab und der Bankier Friedrich Ernst. Konzernbetriebe der Westsektoren steigerten vorsätzlich die wirtschaftlichen Schwierigkeiten durch Teilstillegungen und Verlagerung von Betriebsabteilungen und Produktionskapazitäten in die Westzonen. Sie organisierten ausgedehnte Schieberund Kompensationsgeschäfte. Systematisch wurde die gewerkschaftliche Mitbestimmung abgebaut. Magistratsstellen förderten das Treiben berufsmäßiger Schwarzhändler, die zu Tausenden in die sowjetische Besatzungszone hinausfuhren und Agrarerzeugnisse für den schwarzen Markt heranschleppten. Die von der Stadtverordnetenversammlung beschlossene Enteignung der Konzernbetriebe wurde verschleppt und schließlich durch ein Veto der Westmächte in der Stadtkommandantur aufgehalten.
Angesichts dieser Entwicklungen sah sich der sowjetische Stadtkommandant veranlaßt, für seinen Sektor Maßnahmen zum Schutz der sequestrierten Betriebe zu ergreifen. Mit Befehl Nr. 27/47 vom 1. April 1947 wurde zu deren Verwaltung die Deutsche Treuhandstelle unter Leitung von Willy Rumpf gebildet. „Angelegenheiten, die die treuhänderische Verwaltung des sequestrierten und beschlagnahmten Vermögens“ betrafen, waren — so hieß es in dem Befehl — „aus dem Geschäftsbereich der Magistratsämter … herauszunehmen“. Mit dieser Maßnahme wurde der Grundstein zur Formierung eines bedeutenden volkseigenen Wirtschaftssektors in Berlin gelegt. In über 300 Treu-. handbetrieben arbeiteten etwa 40 Prozent der Beschäftigten der Industrie des sowjetischen Sektors bzw. 13 Prozent der in ganz Berlin Tätigen. Sie erzeugten 50 Prozent der industriellen Produktion des sowjetischen Sektors bzw. 20 Prozent der aller vier Sektoren. Zu den Treuhandbetrieben gehörten solche bedeutenden Werke wie die Schering-AG in Adlershof und die AEG-Fabriken in Schöneweide.
Insgesamt war die Situation in Berlin schon im Frühjahr 1947 nachhaltig durch Elemente des kalten Krieges belastet. Die antikommunistische bzw. antisowjetische Hetze nahm zu. Die Führung der Berliner SPD vertiefte den Kurs der Spaltung der Arbeiterklasse. Sie wies ein von der SED vorgeschlagenes Nothilfeprogramm zurück und widersetzte sich deren Initiativen für einen Volksentscheid über Namenslisten zu enteignender Kriegsverbrecher und Naziaktivisten. Immer enger wurde ihr Zusammengehen mit den Führungen der beiden bürgerlichen Parteien und mit den westlichen Besatzungsmächten. Die von ihr maßgeblich bestimmte Magistratspolitik stellte zunehmend wichtige demokratische Errungenschaften sowie Aufbauerfolge in Frage und isolierte die Westsektoren der Stadt mehr und mehr von der sowjetischen Besatzungszone. Das ging einher mit Versuchen, wenn nicht ganz Berlin, so doch zumindest die Westsektoren an die restaurative Entwicklung in der Bizone anzubinden. Es vergrößerte sich die Gefahr, daß die Westsektoren vom sowjetischen Sektor und von der sowjetischen Besatzungszone abgetrennt wurden und daß schließlich im Herzen dieser Zone ein konterrevolutionäres Zentrum entstand.
Die schwierige Lage der Landwirtschaft im Frühjahr 1947. Die Überschwemmungskatastrophe im Oderbruch
Auch die Landwirtschaft stand 1947 vor komplizierten Problemen. Die Ernteerträge waren 1946 weiter gesunken. Als Pflichtablieferung für die Ernährung hatte man teilweise Halmfrüche und Kartoffeln erfaßt, die als Viehfutter bzw. Saatgut für die Wirtschaftsführung benötigt wurden. Nicht selten waren auch Nutztiere als Äquivalent für nichterfüllte Ablieferungsverpflichtungen bei pflanzlichen Produkten beschlagnahmt worden. Der frühe, lange und harte Winter schuf zusätzliche Schwierigkeiten. Die Winterfurche wurde nur zu 60 Prozent gepflügt. Ein Teil der Kartoffel- und der Zuckerrübenernte verdarb in den oft nur provisorisch hergerichteten Mieten. Es entstanden beträchtliche Auswinterungsschäden, und für die Neubestellung stand nur minderwertiges Saatgut zur Verfügung.
Die schwierige Situation in der Landwirtschaft belastete die verschiedenen Schichten der Bauernschaft sehr unterschiedlich. Am schwersten hatten es die Neubauern in den von den Kriegsschäden besonders betroffenen östlichen Gebieten Mecklenburgs und Brandenburgs, insbesondere die Umsiedler. Aber auch Neubauern in anderen Gebieten fehlten vielfach Zugkräfte, Vieh, Maschinen und Geräte, Wohnund Wirtschaftsräume. Die meisten Neubauern hatten sich das eine oder andere Gerät für Acker und Stall beschaffen können, von einer Ausstattung mit dem Notwendigsten konnte aber noch keine Rede sein. Besonders bedrückend war der Zugkraftmangel. Ein eigenes Pferd besaß nur jeder vierte Neubauer. Die meisten waren auf die Gespannhilfe im Dorf und auf die wenigen
SED-Betriebsgruppen beim Landeinsatz, 1947
Traktoren angewiesen, die den Maschinenausleihstellen der VdgB zur Verfügung standen. Unter den Neubauern bestand eine erhebliche Differenziertheit. Unterschiede in der Bodenqualität und im Inventarbesatz ihrer Höfe spielten dabei ebenso eine Rolle wie solche im Bestand an Arbeitskräften aus der eigenen Familie und in deren Berufserfahrung. Viele Neubauern hatten 1946 nicht einmal das bis zu 50 Prozent gegenüber dem der altbäuerlichen Betriebe ermäßigte Ablieferungssoll aufbringen können.
Die Lage der alteingesessenen Kleinbauern — mit Höfen bis zu 5 Hektar — war im allgemeinen besser als die der Neubauern. Sie hatten in der Regel ihr Ablieferungssoll erfüllt, in Thüringen und Sachsen mitunter sogar zusätzliche Binnahmen aus dem Verkauf von Überschüssen realisiert. Da für die Produkte der Pflichtablieferung nach wie vor die Festpreise des Jahres 1944 gezahlt wurden, während die Preise für Industrieerzeugnisse inzwischen beträchtlich gestiegen waren — eine Sense beispielsweise kostete 70. Mark gegenüber 13 Mark 1941 -, vergrößerten sich allerdings nicht nur für die Neubauern, sondern auch für die alteingesessenen Kleinbauern die Schwierigkeiten.
Zahlreiche Altbauern mit mittelbäuerlichem Besitz -— Höfen von 5 bis 20 Hektar -, die durchweg ständig oder zeitweise ein bis zwei familienfremde Arbeitskräfte beschäftigten, konnten sich durch Tauschhandel oder Produktenverkauf zu Schwarzmarktpreisen zum Teil beträchtliche Einnahmen verschaffen. Es gab aber auch Mittelbauern, die durch eine nachträgliche Erhöhung des Ablieferungssolls in Schwierigkeiten geraten waren.
Die meisten Großbauern in der Regel Bauern mit mehr als 20 Hektar Wirtschaftsfläche — waren bereits 1946 zu einer erweiterten Reproduktion in der Lage gewesen. Sie nutzten das Überangebot an Arbeitskräften auf dem Lande und ihre gute Ausstattung mit landwirtschaftlichem Inventar zur Intensivierung ihrer Wirtschaften. Obwohl sie — nach der 1946 eingeführten Staffelung der Ablieferungsnormen entsprechend sozialökonomischen und sozialen Gesichtspunkten — je Hektar landwirtschaftlicher Nutzfläche bei pflanzlichen Produkten doppelt soviel wie die Kleinbauern und ein Drittel mehr als die Mittelbauern abzuliefern hatten, erzielten sie erhebliche Überschüsse. Das traf noch mehr auf die tierischen Erzeugnisse zu, von denen sie ein Viertel mehr als die Kleinbauern und ein Achtel mehr als die Mittelbauern als Ablieferungssoll aufzubringen hatten. Durch die Naturalüberschüsse besaßen sie Voraussetzungen, Industrieerzeugnisse auf dem Schwarzmarkt zu erhandeln. Zahlreiche Großbauern und auch andere wirtschaftsstarke Bauern nutzten die Not der Städter aus und bereicherten sich bei Tauschgeschäften. In der Umgangssprache reflektierte die Bezeichnung „Speckbauer“ diesen Tatbestand.
Hochwasserkatastrophe im Oderbruch, April 1947
Am 11. Februar 1947 veröffentlichten die Tageszeitungen einen Brief von Marschall Sokolowski an die Ministerpräsidenten der fünf Länder und Provinzen. Im Hinblick auf die Frühjahrsbestellung wurde darin an die Bauern appelliert, durch Vergrößerung der Anbauflächen, rechtzeitige Reparatur der Landtechnik und Entwicklung der gegenseitigen Bauernhilfe die landwirtschaftliche Erzeugung zu steigern. Die SMAD sagte eine erweiterte Hilfe zu. Teilweise schon in den Frühjahrsmonaten wurden zusätzliche Düngermengen aus den SAG-Betrieben bereitgestellt, in denen die Mineraldüngererzeugung konzentriert war. Die Traktoren wurden ausreichend mit Treibstoffen versehen. Neubauern, die nach der Erfüllung der Ablieferungsverpflichtungen 1946 kein Saatgut mehr besaßen, erhielten leihweise Saatgetreide und Saatkartoffeln. In bestimmtem Umfange gelangte Arbeitskleidung in die Dörfer. Beispielsweise verteilten die VdgB und die Gewerkschaft Land und Forst im Land Brandenburg 50000 Meter Stoff, 10000 Stück Trikotagen, 10000 Paar Strümpfe und 15000 Paar Holzpantoffeln bzw. -schuhe.
Die Landtage und die Kreistage befaßten sich mit der Lage in der Landwirtschaft. Die Blockparteien wandten sich mit gemeinsamen Aufrufen zur Frühjahrsbestellung an die Öffentlichkeit. Viele Ortsgruppen und territoriale Leitungen der SED kümmerten sich um die Vorbereitung und Organisierung der Bestellarbeiten. Angeregt durch detaillierte Hinweise in einem Aufruf des Parteivorstandes vom 4. Februar 1947, erarbeiteten sie den örtlichen Bedingungen angepaßte Programme. Die SED-Ortsgruppe Balow im Kreis Ludwigslust beispielsweise legte fest, welcher Altbauer für die Unterstützung eines Neusiedlers gewonnen werden sollte. Die VdgB organisierte die Zugkrafthilfe für gespannlose Bauernhöfe. Auch wurde fehlendes Saatgut in gegenseitiger Hilfe aufgebracht. Der FDGB bildete wie 1946 mobile Reparaturkolonnen, und mancherorts stellte die FDJ Einsatzgruppen auf. Viele Neubauern — schlecht ernährt und gekleidet, mit primitiven Geräten — gaben ihr letztes, um den Acker ordnungsgemäß zu bestellen. Deutlicher als 1946 trat hervor, in welchem Ausmaß die Bodenreform die Tatkraft der werktätigen Dorfbevölkerung geweckt hatte. Es gelang, die Frühjahrsbestellung in besserer Qualität als im Vorjahr zu bewältigen. Hierin dokumentierten sich Fortschritte beim Wiederaufbau der Landwirtschaft.
Im Oderbruch, einem der Hauptversorgungsgebiete für Berlin, entstand im Frühjahr 1947 eine besonders komplizierte Situation. Durch mehrere Deichbrüche bei Reitwein im damaligen Kreis Lebus, wo im April 1945 intensive Kampfhandlungen stattgefunden hatten, wurden etwa 70000 Hektar Land überflutet und annähernd 5000 Wohnund Wirtschaftsgebäude zerstört. Sowjetsoldaten, Volkspolizisten und Feuerwehrleute evakuierten 20000 vom Hochwasser bedrohte Menschen, bargen Vieh und retteten gefährdete Vorräte an Lebensmitteln, Saatgut und anderen Versorgungsgütern. Einsatzkräfte der Polizei kamen aus Dresden, Leipzig und Chemnitz zur Hilfe. Die Deichbrüche wurden bis Mitte April durch Einheiten der Sowjetarmee geschlossen. Einem Aufruf des Parteivorstandes der SED folgend, wurden die verwüsteten Gebiete in einer Massenaktion wiederaufgebaut, wobei sich Jungen und Mädchen aus den Reihen der FDJ hervortaten. Bis zum Juni konnten die abgetrockneten Felder wieder bestellt werden.
Der 2. Kongreß des FDGB unter der Losung „Mehr produzieren, richtig verteilen, besser leben“
Die Gewerkschaften in der sowjetischen Besatzungszone begannen im Januar 1947 mit der Neuwahl ihrer Leitungen. Die Diskussionen in den Versammlungen wurden von den großen ökonomischen und sozialen Problemen bestimmt, drehten sich um die Fragen, wie lange Hunger und Not herrschen werden und wann die Wirtschaft wieder in der Lage sein wird, elementare Bedürfnisse der Bevölkerung zu befriedigen. Vor allem erfahrene Gewerkschafter und klassenbewußte Arbeiter wiesen in den oft heftig geführten Debatten immer wieder auf die seit der Befreiung vom Faschismus erreichten politischen, ökonomischen und sozialen Veränderungen hin. Sie ermutigten ihre Kollegen, nach Wegen zu höheren Produktionsergebnissen zu suchen, um Voraussetzungen für ein besseres Leben zu schaffen. Immer wieder mußten sie sich mit solchen von Gegnern der antifaschistisch-demokratischen Umwälzung verbreiteten Argumenten auseinandersetzen wie dem, daß nur durch Reparationsstopp und Kredite ein wirtschaftlicher Aufschwung herbeizuführen sei.
Im Verlauf der Gewerkschaftswahlen schlossen sich 272000 Arbeiter und Angestellte der Arbeiterorganisation an. Diese erfaßte damit am Vorabend des 2. FDGB-Kongresses 3,5 Millionen Mitglieder bzw. 60 Prozent der Arbeiter und Angestellten in der sowjetischen Besatzungszone. An der Gesamtmitgliedschaft des FDGB hatten die einzelnen Landesverbände folgenden Anteil: Sachsen 40 Prozent; Sachsen-Anhalt 23,7 Prozent; Thüringen 20 Prozent; Mark Brandenburg 10 Prozent; Mecklenburg-Vorpommern 6,3 Prozent. Die Berliner Gewerkschaftsorganisation umfaßte bereits im Dezember 1946 beinahe eine Dreiviertelmillion Mitglieder.
Am 17. April 1947 traten die Delegierten der Gewerkschaftsorganisationen in der Deutschen Staatsoper (Admiralspalast) in Berlin zum 2. FDGB-Kongreß zusammen. Sie konnten neben einer Delegation der SED auch eine Abordnung des Zentralrats der sowjetischen Gewerkschaften begrüßen. Die Anwesenheit sowjetischer Gewerkschafter war Ausdruck der Wertschätzung, die der FDGB sich in der sowjetischen Arbeiterklasse erworben hatte. Hans Jendretzky, der 1. Vorsitzende des FDGB, legte in seinem einführenden Referat die Auffassung des FDGB zur Stellung der Gewerkschaften in der Gesellschaft dar und analysierte die sehr unterschiedlichen Kampfbedingungen der Gewerkschafter in den Besatzungsgebieten Deutschlands. Ausführlich würdigte er den Anteil des FDGB an den seit dem 1. Kongreß erreichten politischen, ökonomischen und sozialen Veränderungen in der sowjetischen Besatzungszone. Eingehend befaßte sich das Referat mit den gewerkschaftlichen Aufgaben auf dem Produktionsfeld, zu denen der Referent abschließend feststellte: „… es konzentriert sich eigentlich alles in drei ganz einfachen Losungen: Mehr produzieren, richtig verteilen und besser leben!“
In der Diskussion berichteten Delegierte über die von ihren Organisationen erzielten Fortschritte in bezug auf die Durchsetzung des Mitbestimmungsrechtes in den Betrieben und Verwaltungen. Sie vermerkten kritisch, daß verschiedene Verwaltungsstellen den Abschluß von Tarifverträgen verzögerten, und verwiesen auch darauf, daß Unternehmer vielfach die im SMAD-Befehl Nr. 253 vom August 1946 verfügte Gleichstellung der Frau in der Entlohnung mißachteten. Entschieden wandten sie sich gegen die mangelnde Entschlossenheit von Funktionären und Betriebsräten, die demokratischen Rechte der Werktätigen uneingeschränkt wahrzunehmen. Sie warnten davor, daß das Vernachlässigen des gewerkschaftlichen Mitbestimmungsrechtes unerlaubte Preiserhöhungen und die Mißachtung von Arbeiterinteressen durch Unternehmer begünstige.
Von besonderem Gewicht waren die Meinungsäußerungen, die sich mit der Verantwortung der Gewerkschaften gegenüber der landeseigenen Industrie befaßten und in denen die von Erfahrungen getragene Gewißheit vermittelt wurde, daß es möglich ist, aus eigener Kraft und ohne Monopolkapitalisten die Produktion zu steigern. Das Mitglied des FDGB-Landesvorstandes Sachsen Grete Groh-Kummerlöw berichtete über die Entwicklung der landeseigenen Industrie, und der Delegierte der IG Bergbau Artur Wölk umriß in knappen Worten den im Bergbau vollzogenen sozialökonomischen Wandel. Auf das Beispiel seiner Kollegen verweisend, stellte er fest: „Was sie unter mancherlei Entbehrungen leisten, geschieht im Interesse des schaffenden Volkes.“
Die Kongreßteilnehmer befaßten sich eingehend mit den Aufgaben, die von den Gewerkschaften in den privatkapitalistischen Betrieben zum Schutze der Arbeiter vor der Ausbeutung und zur Einbeziehung dieser Betriebe in den demokratischen Wirtschaftsaufbau zu leisten waren.
Der 2. FDGB-Kongreß verabschiedete ein „Programm der sozialen Forderungen des FDGB“ und spezielle Entschließungen zur Jugendund zur Frauenfrage, die an den sozialpolitischen Vorstellungen der SED orientiert waren. In zwei Dokumenten verdeutlichten die Delegierten ihren Standpunkt zur kulturellen Situation des deutschen Volkes und zu den gewerkschaftlichen Aufgaben beim kulturellen Aufbau. Von außerordentlicher Bedeutung war, daß der Kongreß den Grundsatz „Ein Betrieb — eine Gewerkschaft“ bekräftigte und in den „Satzungen der Freien Deutschen Gewerkschaften“ erklärte: „Die Freien Gewerkschaften in Deutschland erstreben die Aufhebung jeder Form kapitalistischer Ausbeutung und haben als Ziel die sozialistische Ordnung der Wirtschaft.“
Der Kongreß wählte den 47 Mitglieder umfassenden Bundesvorstand des FDGB mit Hans Jendretzky als 1., Bernhard Göring als 2. und Ernst Lemmer als 3. Vorsitzenden.
Die weitere Konstituierung der landeseigenen Industrie und die Bildung der Deutschen Wirtschaftskommission
Seit dem Sommer 1946 waren bei der Konstituierung der landeseigenen Industrieunternehmen wesentliche Fortschritte erzielt worden. Die Bildung ihrer Leitungen und der Ausbau ihrer Grundstruktur waren erfolgt, die Leistungsfähigkeit der Produktionsstätten ermittelt. Größere Betriebe hatten für 1947 einen Produktionsplan erarbeitet. Der Ende des Jahres 1946 auch in den landeseigenen Industrieunternehmen einsetzende Rückgang der Produktion — in denen des Landes Sachsen sank die durchschnittliche Bruttoproduktionsleistung eines Arbeiters zwischen Dezember 1946 und Februar 1947 um die Hälfte — beeinträchtigte den Konstituierungsprozeß erheblich. Die bereits begonnene Ausbildung der ökonomischen Beziehungen zwischen den Betrieben der landeseigenen Industrie zu einem funktionstüchtigen Organismus wurde unterbrochen, das Entstehen einer dem gesellschaftlichen Charakter des Eigentums entsprechenden Arbeitshaltung in den Betriebsbelegschaften behindert. Die Bedeutung der landeseigenen Betriebe für die ökonomische und politische Entwicklung in der sowjetischen Besatzungszone veranlaßte die SED und die demokratischen Verwaltungsorgane, nach Wegen zu einer Veränderung zu suchen. Das Zentralsekretariat bzw. die Abteilung Wirtschaft beim Parteivorstand der SED führten darum mit verantwortlichen Funktionären in den Landesregierungen und mit den der SED angehörenden Direktoren der Hauptverwaltungen Landeseigene Betriebe aus allen Ländern im 1. Halbjahr 1947 eine Reihe von Beratungen durch. Als ein Ergebnis dieser Beratungen entstand ein Arbeitsprogramm für die Kohlenindustrie als dem Schlüsselbereich. Darin wurde auf die größtmögliche Ausnutzung der vorhandenen Kapazitäten, auf die sparsamste Verwendung von Brennstoffen, auf das Anheben der Arbeitsmoral der Bergarbeiter und auf eine verschärfte Kontrolle bei der Verteilung von Kohle orientiert. Unter der Anleitung des Zentralsekretariats der SED wurde im 1. Halbjahr 1947 die Leitung der landeseigenen Industrie innerhalb des Wirtschaftsapparates der Länder nach einheitlichen Gesichtspunkten organisiert und personell gestärkt. Mitte 1947 waren in den Hauptverwaltungen Landeseigene Betriebe der Landesregierungen Brandenburg, Mecklenburg, Sachsen und Sachsen-Anhalt 23,0 Prozent Arbeiter, 15,9 Prozent Angestellte, 23,0 Prozent Kaufleute, 32,2 Prozent Ingenieure und 5,9 Prozent ehemalige Direktoren tätig. Ähnlich war die soziale Zusammensetzung der Leiter der landeseigenen Betriebe.
Bis zum Sommer 1947 gelang es, die Produktion der landeseigenen Industrie wieder anzuheben, ohne aber schon das Niveau von 1946 zu erreichen. Die Produktion blieb auf Grund des Roh- und Brennstoffmangels und der häufigen und langwierigen Instandsetzungsarbeiten an dem oftmals abgenutzten und überalterten Produktionsapparat diskontinuierlich. Diese Sachlage und vor allem die sich seit Anfang 1947 verschlechternde Versorgung der Industriearbeiter mit Lebensmitteln — in den Betrieben mußten die meisten der seit 1946 verschiedentlich eingerichteten Küchen zeitweilig wieder schließen — trugen dazu bei, daß sich die Arbeitsdisziplin in den landeseigenen und SAG-Betrieben lockerte. In zunehmendem Maße blieben Industriearbeiter zeitweilig der Arbeit fern, um für sich und ihre Familien Lebensmittel und auch Brennholz zu beschaffen. Das beeinträchtigte die Produktivität der landeseigenen Betriebe noch mehr.
Die Erfordernisse der Entwicklung einer leistungsfähigen Friedensindustrie und der Überwindung der akuten Wirtschaftsnöte drängten auf eine einheitlichere und koordiniertere Wirtschaftsentwicklung im Zonenmaßstab. Diese wurde auch deshalb zu einer akuten Frage, weil Fortschritte in Richtung auf die Herstellung der demokratischen Einheit Deutschlands, insbesondere seiner Wirtschaftseinheit, nicht erreicht worden waren und sich auch für die nächste Zeit noch nicht abzeichneten. Das Festhalten an dem grundlegenden Ziel, einem einheitlichen, demokratischen deutschen Staat mit Ländern als konstitutiven Elementen, setzte einem Ausbau der Ostzone zu einem eigenständigen und einheitlichen Wirtschaftsorganismus Grenzen. Die-Maßnahmen, die zu treffen waren, um die zugespitzten ökonomischen und sozialen Probleme zu lösen, waren so zu gestalten, daß sie von den westlichen Besatzungsmächten und westzonalen Politikern nicht als Zonenpartikularismus seitens der Ostzone diffamiert und damit zur Legitimierung ihrer Politik zur Spaltung Deutschlands genutzt werden konnten. Außerdem mußte in Rechnung gestellt werden, daß die Stellung und Rolle der Länder der Ostzone mit den Wahlen und der Konstituierung von Landtagen und Landes- bzw. Provinzialregierungen weiter angehoben worden war. Auch die SMAD orientierte auf die politische und ökonomische Stabilisierung der Länder und Provinzen. So hatte die SMAD im Herbst 1946 den Landes- und Provinzialverwaltungen den Auftrag erteilt, die Wirtschaftsentwicklung ihrer Territorien so zu planen, daß sie sich im Jahre 1947 weitgehend auf der Basis der eigenen Ressourcen vollziehen konnte. Rohund Brennstoffe, Fertigerzeugnisse, Lebensmittel usw. sollten nur in geringem Umfang aus den anderen Ländern und Provinzen bezogen werden.
Der leere Topf. Gemälde von Hermann Bruse, 1948. Kulturhistorisches Museum, Magdeburg
Diese auf relativ unabhängige Länderund Provinzialwirtschaften ausgerichtete Orientierung korrespondierte mit anderen in die gleiche Richtung zielenden. Regelungen. Unter ihnen spielten die Steuerhoheit der Länder und Provinzen, deren eigenständige Haushalte, die Länderund Provinzialbanken und das auf Länderbasis organisierte Versicherungswesen sowie das industrielle und landwirtschaftliche Landes- und Provinzialeigentum eine besondere Rolle. Mit der Realisierung dieses Eigentums entstanden in einem besonderen Maße eigenständige ökonomische Interessen der Länder. Sie wurden auch durch das System zur Bewirtschaftung der wichtigsten industriellen und agrarischen Erzeugnisse gefördert, nach dem Länder und Provinzen ihre Wirtschaft und ihre Bevölkerung vornehmlich aus dem eigenen Aufkommen zu versorgen und darüber hinaus nach einem Verteilungsplan der SMAD Lebensmittel und Industriegüter in andere Länder und Provinzen zu liefern hatten. Zugleich verlangten aber der zunehmende Umfang der Produktion und das sich erweiternde Sortiment an industriellen Erzeugnissen nach einem Wieder- bzw. Neuknüpfen von Produktionsbeziehungen zwischen den in verschiedenen Ländern der Ostzone angesiedelten Betrieben, vornehmlich zwischen den großen und stark spezialisierten landeseigenen Betrieben, deren Wirt-
schaftlichkeit von einer derartigen Kooperation abhing. Damit korrespondierten eine Reihe von Maßnahmen, die darauf abzielten, unter Berücksichtigung der gegebenen Bedingungen und jeweiligen Erfordernisse weitere Fortschritte in Richtung auf eine Koordinierung und einheitliche Leitung der Wirtschaft im Zonenmaßstab zu erreichen.
Schon im Herbst 1946 hatte die SMAD durch ihren Befehl Nr. 323 der Deutschen Zentralverwaltung der Brennstoffindustrie weitgehende Befugnisse bei der technisch-ökonomischen Leitung des Kohlenbergbaus in der sowjetischen Besatzungszone übertragen. Damit wurde neben der Deutschen Reichsbahn, der Post, dem Fernmeldewesen und der elektroenergieerzeugenden Indüstrie ein weiterer für die gesamte Wiirtschaft entscheidender und durch einen hohen Grad der Vergesellschaftung der Produktion und der Arbeit gekennzeichneter Bereich zentral organisiert.
Zur Erschließung der in der Ostzone gegebenen Potenzen wurden auf Zonenebene auch Gremien aus Mitarbeitern der verschiedenen wirtschaftlichen Zentralverwaltungen und aus Vertretern der Landesbzw. Provinzialverwaltungen gebildet. Schon im Januar 1946 war bei der Deutschen Verwaltung für Handel und Versorgung ein Interzonenausschuß geschaffen worden, in dem Vertreter der wirtschaftlichen Zentralverwaltungen die operativen interzonalen Einund Ausfuhrgeschäfte abstimmten und für die SMAD die erforderlichen Entscheidungen vorbereiteten. Die Landes- und Provinzialverwaltungen hatten im August 1946 einen gemeinsamen Interzonenbeirat gegründet, dessen Aufgabe es war, die Länderinteressen im Handel mit anderen Besatzungszonen zu koordinieren. Er bereitete vornehmlich interzonale Abmachungen vor. Aus Vertretern der verschiedenen Verkehrsträger hatte sich — ebenfalls gesamtzonal — 1946 bei der DZV des Verkehrs ein Planungsausschuß konstituiert. Ende Januar 1947 trat eine Kommission zusammen, in der Vertreter der Planungsabteilungen der Zentralverwaltungen und Vertreter der Länder: und Provinzialregierungen gemeinsam den Ablauf der Planungsarbeiten in der Ostzone nach einheitlichen Gesichtspunkten ausarbeiteten und entsprechende Richtlinien entwarfen.
Darüber hinaus unterbreiteten Mitarbeiter deutscher Dienststellen der SMAD immer wieder Vorschläge, die eine bessere Organisierung des Wittschaftslebens im Rahmen der gesamten Ostzone zum Inhalt hatten und die auf eine Erhöhung der Kompetenzen der wirtschaftlichen Zentralverwaltungen gegenüber den Ländern hinzielten. Die SMAD wies diese Vorschläge im Interesse ihres deutschlandpolitischen Kurses zurück. Jedoch wurden Richtlinien für die Zusammenarbeit zwischen den Länderbzw. Provinzialregierungen und der DZV der Industrie, der DZV der Brennstoffindustrie sowie der Deutschen Verwaltung für Handel und Versorgung in der Ostzone erarbeitet, die die Wirtschaftsminister der Länder und Provinzen und die Präsidenten der Zentralverwaltungen am 10. Februar 1947 unterzeichneten. Diese Richtlinien legten fest, daß die drei wirtschaftlichen Zentralverwaltungen die Arbeiten der Länder und Provinzen in bezug auf Planung, Lenkung und Kontrolle der Industrie, des Handwerks, des Handels und der Versorgung im Interesse der gesamten Ostzone koordinieren. Dazu räumten ihnen die Länderund Provinzialregierungen die nötigen Rechte ein.
Diese Bemühungen führten aber in der Praxis aus unterschiedlichen Gründen nicht zu dem erhofften Ergebnis. Zum einen behielt sich die SMAD die grundlegenden Entscheidungen über die wirtschaftliche Entwicklung in der sowjetischen Besatzungszone vor. Das begrenzte den Grad der Zuständigkeit der wirtschaftlichen Zentralverwaltungen, so daß diese ihre koordinierende Funktion gegenüber den Ländern nur in einem sehr engen Rahmen ausüben konnten. Zum anderen erzielten die Zentralverwaltungen bei der gegenseitigen Abstimmung ihrer Tätigkeit nur geringe Fortschritte. All das war nicht geeignet, die Vorbehalte abzubauen, die sich seit längerem in den Ländern gegen die Zentralverwaltungen gebildet hatten. Diese Vorbehalte waren vielfach aus Erfahrungen erwachsen, die die mit großer Autorität ausgestatteten Länderregierungen in der bisherigen Zusammenarbeit mit den Zentralverwaltungen gesammelt hatten. Zwar waren deren Spitzenpositionen seit 1946 durchweg mit bewährten Antifaschisten besetzt, doch bestand in den anderen Funktionen zunächst noch ein zahlenmäßig starker Anteil von Mitarbeitern, deren Verständnis für die Erfordernisse des sich in der Ostzone vollziehenden gesellschaftlichen Veränderungsprozesses entweder gar nicht oder doch nur gering ausgebildet war. Ihre Arbeitsweise bestimmten administrativbürokratische Methoden, die in den Ländern auf Unverständnis und Ablehnung stießen. Ein grundlegender Wandel durch das Heranziehen von Arbeitern und Intellektuellen, die sich im antifaschistisch-demokratischen Umgestaltungsprozeß bewährt hatten, zur Arbeit in den Zentralverwaltungen hatte erst begonnen und bestimmte noch nicht deren Bild.
Nach dem unbefriedigenden Ausgang der Moskauer Außenministerkonferenz und angesichts des verstärkten Ausbaus der Bizone — vor allem durch das am 29. Mai 1947 getroffene amerikanisch-britische Abkommen über die Bildung des bizonalen „Wirtschaftsrates“ mit sowohl legislativen als auch exekutiven Funktionen — entschloß sich der Oberste Chef der SMAD, Bedingungen für eine mehr zentralisierte Lenkung und Planung des wirtschaftlichen Lebens auf Zonenebene zu schaffen. Der von ihm am 4. Juni 1947 erlassene Befehl Nr. 138 bestätigte die am 10. Februar 1947 getroffenen Vereinbarungen zwischen den drei wirtschaftlichen Zentralverwaltungen und den Länder- bzw. Provinzialregierungen und forderte die Vorlage eines entsprechenden Abkommens zwischen der Deutschen Verwaltung für Land- und Forstwirtschaft und den Länderregierungen bis zum 10. Juni 1947. Vor allem aber übertrug er den Zentralverwaltungen die Verantwortung für die Aufstellung und Durchführung gesamtzonaler Produktionsund Verteilungspläne auf ihrem jeweiligen Zuständigkeitsgebiet. Auch räumte er ihnen das Recht ein, den sowjetischen Dienststellen Entwürfe für Verfügungen und wirtschaftliche Entscheidungen, die das gesamte Besatzungsgebiet betrafen, zu unterbreiten. Der Befehl übertrug den Präsidenten der Zentralverwaltungen die Befugnisse zu systematischen Kontrollen in den Ländern, während er die Ministerpräsidenten der Länder verpflichtete, den Zentralverwaltungen über die Durchführung der Wirtschaftspläne regelmäßig zu berichten. Die Abteilung für Interzonen- und Außenhandel wurde in eine selbständige Zentralverwaltung umgewandelt.
Die wichtigste Festlegung des Befehls Nr. 138 war die Bildung einer ständigen Deutschen Wirtschaftskommission (DWK), bestehend aus den Präsidenten der wirtschaftlichen Zentralverwaltungen, dem Vorsitzenden des FDGB und dem der VdgB. Zur Führung der Geschäfte wurde eine ständige Wirtschaftsabteilung geschaffen. Die DWK nahm am 14. Juni 1947 ihre Tätigkeit auf. Sie entstand als zonales Koordinierungsorgan, das insbesondere die Tätigkeit der wirtschaftlichen Zentralverwaltungen abzustimmen hatte. Die Leitung der Abteilung Wirtschaftsfragen übertrug die SMAD Bruno Leuschner, der seit 1931 Mitglied der KPD aktiv am antifaschistischen Widerstandskampf teilgenommen und seit Herbst 1945 als Leiter der Abteilung für Wirtschaft und Finanzen beim Sekretariat des ZK der KPD und dann beim Parteivorstand der SED erfolgreich gewirkt hatte. Die Tätigkeit der Wirtschaftsabteilung der DWK erlangte bei der weiteren Ausarbeitung einer einheitlichen Wirtschaftspolitik im Zonenrahmen zunehmendes Gewicht.
Die Wahrnehmung der Koordinierungsfunktion seitens der DWK stieß auf eine Reihe Schwierigkeiten. Solange die DWK nicht über die Kompetenz verfügte, Verordnungen und Gesetze zu erlassen, konnte sie die Funktion eines zentralen wirtschaftsleitenden Organs nur sehr begrenzt wahrnehmen. In den ersten Monaten ihres Wirkens befaßten sich die Mitglieder der DWK vornehmlich mit der Brennstoffversorgung. In ihrem Auftrag erarbeitete die DZV der Brennstoffindustrie einen „Generalplan für die Wiederherstellung der Kohlenindustrie in der Ostzone für die Jahre 1948 bis 1952“. Außerdem beschäftigten sie sich mit der Vorbereitung eines Produktionsplans für 1948.
Die Überwindung der wirtschaftlichen Nöte und der Übergang zu einem Wirtschaftsaufschwung hing entscheidend davon ab, wie es gelang, Organisation und Arbeitsweise der landeseigenen Industrie zu verbessern, den Leistungswillen der Arbeiter zu erhöhen und die Arbeitsdisziplin wesentlich zu verbessern.
Die sowjetische Militäradministration beauftragte im Juli 1947 fachkundige Offiziere der Sowjetarmee und Mitarbeiter des demokratischen Verwaltungsapparates, die Wirtschaftstätigkeit einer größeren Anzahl landeseigener Betriebe in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen zu analysieren und alle Ursachen für die unbefriedigenden ökonomischen Ergebnisse zu ermitteln. Zu den Ursachen dafür, daß eine erhebliche Anzahl landeseigener Betriebe unrentabel arbeiteten, gehörten die auf dem Niveau von 1944 gestoppten Preise für Industrieprodukte, die es den Betrieben nicht erlaubten, die Produktionskosten zu decken. Des weiteren minderte die aus dem Mangel an Roh- und Brennstoffen resultierende geringe Auslastung der gegebenen Kapazitäten das Produktionsergebnis, so daß es die anfallenden Produktionskosten nicht aufwog. Eingehend befaßten sich die Analysen mit den Ursachen für die gesunkene Arbeitsmoral und mit dem Unverständnis, das in den Belegschaften der landeseigenen Betriebe über die Notwendigkeit herrschte, besondere Arbeitsleistungen höher zu entlohnen oder zu prämiieren. Die Auffassung, daß unter den neuen Gesellschaftsverhältnissen alle Arbeitenden unabhängig von ihrer individuellen Leistung im gleichen Umfang am Produktionsresultat beteiligt werden müssen und daß die Differenzierung in der Entlohnung oder die materielle Anerkennung besonderer Arbeitsleistungen durch Geld- oder Sachprämien zur Spaltung der Belegschaften führe, wurde auch von SED-Mitgliedern und Gewerkschaftsfunktionären vertreten. Es war für eine solche Gleichmacherei kennzeichnend, daß der Betriebsrat einer vogtländischen Maschinenfabrik als Sachprämien gedachte Kleidungsstücke, Schuhe, Fahrradmäntel usw. nicht an Arbeiter, die sich in der Produktion ausgezeichnet hatten, als Anerkennung übergab, sondern unter den Belegschaftsmitgliedern verloste.
Trittbrettfahrer auf der Straßenbahn, 1947
Ausgehend von den Untersuchungen in den landeseigenen Betrieben und auf die dazu geführten Beratungen gegründet, unterbreiteten der Parteivorstand der SED, der Bundesvorstand des FDGB, verschiedene Zentralverwaltungen, Länderbehörden und Direktoren landeseigener Betriebe der SMAD Vorschläge zur Veränderung der Lage, die kurze Zeit später in einen speziellen Befehl der SMAD eingingen. Vorschläge zur Veränderung der Lage.
Der kalte Krieg und seine Auswirkungen auf Deutschland
Inhaltsverzeichnis
- 1 Der kalte Krieg und seine Auswirkungen auf Deutschland
- 1.1 Die Truman-Doktrin und die Inaugurierung des Kurses zur Bildung eines westzonalen Separatstaates durch die USA
- 1.2 Die Münchner Konferenz der Ministerpräsidenten der deutschen Länder
- 1.3 Der Marshallplan zur Schaffung eines westeuropäischen Wirtschaftsblocks
- 1.4 Die Direktive JCS 1779 und das Ende der britischen „Sozialisierungspolitik“
- 1.5 Die Auseinandersetzungen auf den Parteitagen von LDPD und CDU um die Kursbestimmung
- 1.6 Der II. Parteitag der SED. Das Konzept des Aufbaus aus eigener Kraft als Alternative zum Marshallplan
- 1.7 Die Beschlüsse der KPdSU und weiterer kommunistischer und Arbeiterparteien Europas auf dem Treffen in Szklarska Poreba
- 1.8 Die geistige Kultur unter den Bedingungen der Klassenauseinandersetzungen in den vier Besatzungszonen
Die Truman-Doktrin und die Inaugurierung des Kurses zur Bildung eines westzonalen Separatstaates durch die USA
Am 12. März 1947, zwei Tage nach Beginn der Moskauer Außenministerkonferenz, hatte USA-Präsident Harry S. Truman vor dem Kongreß eine Rede gehalten, in der er die Absicht der USA erklärte, die reaktionären Regime in der Türkei und in Griechenland durch wirtschaftliche und militärische Unterstützung zu befähigen, sich „totalitärer Angriffe“ zu erwehren. In diesem Zusammenhang bekräftigte Truman den Anspruch des USA-Imperialismus auf Führung in der Welt, formulierte er ein Globalinteresse der USA am Schutz der „freien Welt“ vor „totalitären Gefahren“, wo immer sie auftreten — die später nach dem Redner benannte „Truman-Doktrin“ — und erteilte er dem Bemühen um friedliche Koexistenz eine Absage. Mit dieser Rede wurde offiziell jene imperialistische Politik verkündet, die man dann als Politik des kalten Krieges bezeichnete. Die USA beabsichtigten danach, von der Kooperation mit der Sowjetunion vollends abzugehen und dieser gegenüber einen Kurs der Konfrontation einzuschlagen. Die feierliche Verpflichtung der Krimdeklaration zur Einigkeit im Frieden wie im Kriege und zur Fortführung der engen Zusammenarbeit der Hauptmächte der Anti-Hitler-Koalition im Interesse einer weltweiten Friedensgestaltung und -gewährleistung wurde damit vor aller Welt aufgekündigt.
Der amerikanische Präsident Harry S. Truman, der am 12. März 1947 die nach ihm benannte außenpolitische Doktrin verkündete
In der Rede Trumans sowie in weiteren regierungs-offiziellen „Kommentaren“ so in einem Artikel von Georg F. Kennan, nunmehr Leiter des Politischen Planungsstabes des State Department — wurde die Sowjetunion als aggressive und expansive Macht verleumdet, mit der man nicht leben könne und gegen die’man die „freie Welt“ schützen müsse. In diesem Weltbild gab es nur noch einen bösen „kommunistischen Machtbereich hinter dem Eisernen Vorhang“ und eine gute „freie Welt“. Und diese war aufgerufen, jenen einzudämmen, besser noch: zurückzudrängen und zu überwinden.
Im Grunde ging es dem amerikanischen Imperialismus um die Weltherrschaft oder zumindest um die Vorherrschaft in der Welt, aufgebaut auf militärischer Suprematie, um die Revision der ihm nicht genehmen Ergebnisse des zweiten Weltkrieges und um die Gestaltung einer von ihm beherrschten kapitalistischen Weltwirtschaft als Voraussetzung für eine ungehemmte Exportoffensive. Diese neue Globalstrategie war — wenngleich aus einer historischen Defensivposition heraus entwickelt und zunächst als eine Politik des „Containment“ (der „Eindämmung“) deklariert — keineswegs defensiv; in ihr nahmen Aufrüstung, Erpressungsversuche und Drohungen mit der Atombombe, die Errichtung von Militärblöcken, die Erlangung militärischer Überlegenheit über die Sowjetunion und die Vorbereitung auf militärische Auseinandersetzungen einen zentralen Platz ein. Auch fehlte es schon 1947/48 nicht an Ausarbeitungen der militärischen Planungsstäbe der USA für den militärischen Angriff auf die Sowjetunion — bis hin zu Plänen für die militärische Besetzung und Verwaltung sowjetischen Territoriums. In Rundfunk und Presse der USA wurde bald auch die politisch-moralische „Berechtigung“ eines Präventivkrieges gegen die Sowjetunion in aller Öffentlichkeit erwogen.
Da zum Zeitpunkt der Verkündung der Truman-Doktrin weder die psychologischen noch alle militärischen und politischen Bedingungen für die Politik des kalten Krieges vorhanden waren, bedurfte es einer bestimmten Zeit intensiver Anstrengungen, um diese zu schaffen. Die auf Fortführung der Ant-Hitler-Koalition und Bewahrung ihrer Errungenschaften gerichtete Politik der Sowjetunion erschwerte die Eskalation des kalten Krieges beträchtlich. In den USA selbst gab es viele einflußreiche Kritiker dieser Politik. Dennoch setzte sie sich als Grundtendenz in der Außenpolitik der Westmächte durch und dominierte sie diese dann auf lange Zeit gänzlich.
Die Politik des kalten Krieges tendierte schon in ihrer Anfangsphase dazu, die Welt in zwei Blöcke oder Lager zu teilen. Dies mußte, wenn es nicht gelang, einen einheitlichen, neutralisierten deutschen Staat zu schaffen und einen deutschen Friedensvertrag abzuschließen, für Deutschland weitreichende Folgen haben, denn die Grenze zwischen den zwei Lagern war dann in Mitteleuropa zwangsläufig mit der zwischen der sowjetischen Besatzungszone und den Besatzungszonen der Westmächte identisch.
Nach der Logik der herrschenden Kreise der USA enthielt die Politik des kalten Krieges zwei zwingende Schlußfolgerungen in bezug auf Deutschland: Zum einen nahmen die USA Kurs darauf, ihre militärische Präsenz in den Westzonen für unbefristete Zeit aufrechtzuerhalten, diese als militärisches Glacis zu nutzen, und zum anderen waren sie fest entschlossen, die westdeutsche Wirtschaft in die Entwicklung der kapitalistischen Wirtschaft Westeuropas einzuordnen und einen fest an sie geketteten Westzonenstaat zu schaffen, dem die Funktion eines antikommunistischen Bollwerks und antisowjetischen Stoßkeils zugedacht war.
In den globalstrategischen Planungen der USA zeichnete sich als logische Konsequenz vor allem auch schon die Absicht zur Wiederherstellung und Einbeziehung deutscher Streitkräfte in einen von den USA dominierten Militärblock ab. Bereits am 29. April 1947 hieß es in einem gemeinsamen Memorandum der Stabschefs der USA: „Die potentiell stärkste Militärmacht dieses Gebietes ist Deutschland. Ohne deutsche Hilfe könnten die übrigen Länder Westeuropas kaum so lange den Armeen unserer ideologischen Gegner widerstehen, bis die Vereinigten Staaten ausreichend große strategische Streitkräfte mobilisiert und ins Feld geführt haben, um ihnen eine Niederlage zu bereiten. Mit einem wiedererstarkten Deutschland, das auf der Seite der westlichen Alliierten kämpft, wäre das möglich.“
Das alles bedeutete eine völlige Abkehr vom Friedenssicherungsprogramm der Antihitlerkoalition, wie es insbesondere in Potsdam beschlossen worden war, und deshalb widersetzten sich die herrschenden Kreise der Westmächte einer deutschen Friedensregelung nunmehr entschieden. Damit entsprachen sie zugleich den Vorstellungen der deutschen Monopolbourgeoisie, deren restaurative und revisionistischen Pläne nur dann Aussicht auf Erfolg hatten, wenn eine deutsche Friedensregelung zu diesem Zeitpunkt verhindert und wenn unter Bruch des Potsdamer Abkommens, unter Preisgabe der Ziele der Entmilitarisierung, der konsequenten Entnazifizierung und der Entmonopolisierung ein Westzonenstaat geschaffen wurde.
Am Ende der Moskauer Außenministerkonferenz hatte William H. Draper, Direktor der Wirtschaftsabteilung von OMGUS noch in Moskau in einer schriftlichen Stellungnahme zur geplanten weiteren Fusion der Bizone betont, „die wirkliche Frage“ sei, „ob nun die politische Fusion der Zonen die ökonomische ergänzt“ und ob „eine provisorische Regierung allmählich entwickelt“ werden soll. Und der langjährige politische Berater der US-Militärgouverneure in Deutschland, Robert D. Murphy, bestätigte später, daß dies nach der Moskauer Konferenz die eindeutige Orientierung der offiziellen amerikanischen Politik in Deutschland wurde. Am 26. Januar 1959 erklärte er in seiner Eigenschaft als stellvertretender Außenminister der USA rückblickend: „Als unsere Delegation Moskau nach dem Fehlschlagen der. Deutschlandkonferenz von 1947 verließ, vereinbarten die drei Westmächte mit den Westdeutschen die Errichtung der deutschen Bundesrepublik.“
Bei aller Tarnung und Geheimhaltung des Kurses zur Gründung eines Westzonenstaates auf seiten der Westmächte erhielten bestimmte westzonale Politiker doch Hinweise und Einblicke. Dies bestätigte der Ministerialdirektor in der bayrischen Staatskanzlei Gebhard Seelos in einem Aktenvermerk, den er am 3. Mai 1947 im Zusammenhang mit der Vorbereitung der Münchner Konferenz deutscher Ministerpräsidenten zu Papier brachte. Darin hieß es: „Seit zwei Wochen sind bei den alliierten Militärregierungen Besprechungen im Gange über die Einrichtung einer politischen Koordinierung der Westzonen bis zur Errichtung einer westdeutschen Regierung …“
Die Münchner Konferenz der Ministerpräsidenten der deutschen Länder
Münchener Ministerpräsidentenkonferenz
Anfang Mai 1947 machte eine Aktion des bayrischen Ministerpräsidenten Hans Ehard von sich reden, die Erstaunen auslösen mußte, weil sie aus dem nicht zu Unrecht separatischer oder zumindest partikularistischer Neigungen verdächtigen Bayern kam. Es handelte sich um eine Einladung an die Ministerpräsidenten aller deutschen Länder zu einer Beratung nach München. Viele werteten diese Einladung damals und später als eine bedeutsame gesamtdeutsche Initiative. Aufschluß über die wahre Motivation gab der schon erwähnte Aktenvermerk des maßgeblich in die Vorbereitung der Konferenz einbezogenen Ministerialdirektors Seelos vom 3. Mai 1947, in dem dieser ausführte: „Sofern die Konferenz auf Einladung Bayerns und an einem bayrischen Ort stattfindet, wird es viel leichter sein, die bayrischen föderalistischen Ziele zur Geltung zu bringen. Das Bekenntnis zur deutschen Einheit, das angesichts der außenpolitischen Lage nur Lippenbekenntnis sein kann, wird die dauernde Hetze gegen Bayern künftig zumindest recht erschweren. Insbesondere ist nicht anzunehmen, daß Sowjet-Rußland seine Zustimmung zu einer gesamten Beteiligung der Ministerpräsidenten der Ostzone gibt. Rußland wird damit in die unangenehme Lage versetzt, die Teilnahme der Ministerpräsidenten der Ostzone verbieten zu müssen und das Odium auf sich zu nehmen, die gesamtdeutsche Wirtschaftseinheit … machen.
Mit diesen Ausführungen ist sicher nicht die gesamte, vielschichtige Motivation der Einladung ausgeleuchtet — auf alle Fälle aber der entscheidende Kern. Die Initiatoren wußten um die nunmehr feste Absicht der Amerikaner und Briten, eine einseitige „Westlösung“ der deutschen Frage in dieser oder jener Form herbeizuführen, und glaubten deshalb nicht mehr an die Möglichkeit, die Einheit Deutschlands herzustellen. Zudem wollte man diese unter den Bedingungen, unter denen allein sie zu erlangen war — nämlich mit dem Potsdamer Abkommen als Richtschnur -,. auch gar nicht. In der von westzonaler Seite ausgearbeiteten Tagesordnung für die Konferenz war von Deutschland keine Rede mehr, statt dessen wurden einseitig die Wirtschaftsprobleme der Bizone in den Mittelpunkt gerückt. Jede Erörterung von Problemen der wirtschaftlichen und politischen Einheit Deutschlands, die in der Einladung noch angesprochen waren, sollte vermieden werden.
Auch ohne Kenntnis dieser Fakten schätzte der Parteivorstand der SED auf seiner 11. Tagung im Mai 1947 ein, daß die Einladung Ehards keinesfalls als Initiative angesehen werden konnte, um die Einheit Deutschlands auf demokratischer Grundlage zu fördern, sondern daß die Konferenz einseitig die Stellung der Länder stärken und einen föderalistischen bzw. reaktionären Weg unterstützen sollte. Um dennoch keine Möglichkeit ungeprüft zu lassen und zugleich offensiv reaktionären Absichten entgegenzuwirken, unterbreitete die SED, anknüpfend an die bayrische Initiative, Ehard den Vorschlag, zu der Konferenz Vertreter der großen Parteien und Gewerkschaften hinzuzuziehen, die wirtschaftliche und politische Einheit Deutschlands in den Mittelpunkt der Beratungen zu rücken und die Konferenz nach Berlin, „der Hauptstadt Deutschlands“, zu verlegen.
Die bayrische Regierung kam keinem dieser Vorschläge entgegen, versicherte allerdings, daß man über die wirtschaftliche und politische Einheit zumindest reden könne. Während der Parteivorstand der SED einschätzte, daß damit Voraussetzungen für eine Teilnahme der Ministerpräsidenten aus der Ostzone fehlten, sprach sich der der LDPD angehörende Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt, Erhard Hübener, für eine Beteiligung um jeden Preis aus. Hübener glaubte, auf diese Weise etwas für die Schaffung der Einheit Deutschlands tun zu können, da er die Rolle, die der Konferenz von seiten ihrer Initiatoren zugedacht war, völlig falsch einschätzte und Illusionen über Inhalt und Ernsthaftigkeit ihrer gesamtdeutschen Bekenntnisse hegte. Nach Abwägung des Für und Wider entschied sich der Parteivorstand der SED in letzter Stunde für eine Teilnahme auch der vier der SED angehörenden Ministerpräsidenten. Nach Abstimmung mit der SMAD fuhren alle Ministerpräsidenten der Ostzone nach München, wo sie am Vorabend der Konferenz eintrafen.
Am Vorabend der Münchner Ministerpräsidentenkonferenz, 5.Juni 1947. V.l.n.r.: die Ministerpräsidenten Rudolf Amelunxen (Nordrhein-Westfalen), Erhard Hübener (Sachsen-Anhalt), Wilhelm Höcker (Mecklenburg) und Kurt Fischer (Sachsen) sowie Senatspräsident Wilhelm Kaisen (Bremen)
Hier mußten sie erleben, daß die schlimmsten Befürchtungen noch übertroffen wurden. Die Tagesordnung der Konferenz stand bei ihrem Eintreffen bereits fest, und man verwehrte es ihnen, auf der Konferenz in irgendeiner Form eine Erklärung zur wirtschaftlichen und politischen Einheit Deutschlands abzugeben. Gleichzeitig fehlte es nicht an unverfrorenen Aufforderungen, die Länder der Ostzone der Bizone anzuschließen. Insgeheim fürchtete man aber auch das, denn so Carlo Schmid (SPD) — „auch in den ostdeutschen Kompromißvorschlägen hätte der kommunistische Pferdefuß gesteckt“. Bei dieser verständigungs- und kompromißfeindlichen Grundhaltung der westzonalen Seite blieb den Ministerpräsidenten der Ostzone nichts anderes übrig, als nach der ergebnislosen Vorbesprechung München zu verlassen. Mundtot gemacht, hätten sie der Einheit Deutschlands hier nicht dienen können, und ihre Anwesenheit hätte dazu herhalten müssen, die bizonale Politik faktisch zu legitimieren und die Gefahr der Spaltung Deutschlands zu überdecken. Andererseits kam ihre Abreise den westzonalen Ministerpräsidenten nicht ungelegen. Der Ministerpräsident von Württemberg-Baden, Reinhold Maier (FDP), schrieb dazu rückblickend: „Nicht wenige aus dem Kreise der westdeutschen Delegationen atmeten auf. ‚Gottlob‘, so hörte man sagen, ‚daß wir die Kommunisten los sind. Nun brauchte man „gar keine Rücksicht mehr zu nehmen“ und konnte sich auf der Rumpfkonferenz ungestört den westzonalen Separatproblemen widmen dies allerdings nicht, ohne zugleich zu verkünden, „daß wir nun auch Sachwalter jener Teile Deutschlands sein wollen, deren Vertreter hier nun fehlen“.
Mit dieser Anmerkung von seiten des bayrischen Ministerpräsidenten Ehard am 6. Juni 1947 in seiner Eröffnungsansprache war das geboren, was später Bonner Regierungen als ihre „Obhutspflicht für alle Deutschen“ bzw. als ihren „Alleinvertretungsanspruch“ bezeichneten.
Entgegen der Behauptung ihrer Initiatoren, die Sache der demokratischen Einheit Deutschlands voranbringen zu wollen, war die Münchner Konferenz ein Schritt auf dem Wege der imperialistischen Spaltung Deutschlands. KPD und SED deckten dies in ihren Stellungnahmen auf. „München 1938 war eine Station auf dem außenpolitischen Weg zum Hitlerkrieg. München 1947 ist der Versuch einer endgültigen Teilung Deutschlands in zwei Teile, erklärten die Kommunisten der französischen Zone. Die Arbeitsgemeinschaft SED-KPD stellte in ihrer Erklärung „Gegen die Zerreißung Deutschlands“ fest: „Die tieferen Hintergründe der starren Ablehnung einer Stellungnahme zu den Fragen der Einheit Deutschlands stehen offenkundig im Zusammenhang mit den Bestrebungen der Kräfte des westlichen Monopolkapitals, Deutschland in Bundesstaaten zu zergliedern, um die westlichen und südlichen Gebiete Deutschlands in einen Westblock zu zwingen.
Die westzonalen Politiker und die ihnen nahestehenden Medien versuchten mit großem propagandistischem Aufwand, von diesen Hintergründen abzulenken und das Scheitern von München den ostzonalen Ministerpräsidenten anzulasten. In Verbindung mit der um sich greifenden Psychose des kalten Krieges geschah dies in den Westzonen nicht ohne Erfolg; außerdem konnte hier die Wahrheit über die Münchner Konferenz nur in Zeitungen mit relativ geringen Auflagen verbreitet werden.
In CDU und LDPD der Ostzone waren die Reaktionen auf die Münchner Konferenz unterschiedlich und zwiespältig. Wenngleich die Ministerpräsidenten der westzonalen Seite wegen ihres Verhaltens kritisiert wurden, neigten nicht wenige Vertreter dieser Parteien dazu, die Abreise der Ministerpräsidenten der Ostzone als Fehler zu betrachten. Insbesondere der CDU-Vorsitzende Jakob Kaiser sparte nicht mit Kritik, die er an die Adresse der SED richtete. Scharfe politisch-ideologische Auseinandersetzungen kündigten sich an.
Der Marshallplan zur Schaffung eines westeuropäischen Wirtschaftsblocks
US-Außenminister George C. Marshall offerierte am 5. Juni 1947 in einer vielbeachteten und mit großem Aufwand propagierten Rede an der Harvard-Universität in Cambridge/USA ein Hilfsprogramm der USA für den Wiederaufbau und die Wiedergesundung der europäischen Wirtschaft. Mit dem „Marshallplan“ setzten die USA jene Linie ihrer imperialistischen Politik fort, die darauf abzielte, ihre ökonomische Stärke als Mittel zur Erlangung von Hegemonialpositionen und Möglichkeiten für Exportoffensiven einzusetzen. Zugleich verfolgten sie damit die Absicht, die wirtschaftlichen Schwierigkeiten des kapitalistischen Weltsystems bei gleichzeitiger Festigung und Stärkung des staatsmonopolistischen Kapitalismus und unter Zurückdrängung der antimonopolistischen und demokratischen Bewegungen zu überwinden. Vor allem aber handelte es sich dabei um den Versuch, dies alles durch einen solchen wirtschaftlichen Zusammenschluß bzw. durch ein solches System wirtschaftlicher Zusammenarbeit zu erreichen, die zugleich wesentliche Grundlagen für die Errichtung eines westlichen Militärblocks entstehen ließen.
Der Marshallplan stand in untrennbarem Zusammenhang mit der Truman-Doktrin und war — aus strategischem Blickwinkel — auf die Durchsetzung reaktionärer und konterrevolutionärer politischer sowie aggressiver militärischer Ziele gerichtet. Mit dem Marshallplan sollte ein System wirtschaftlicher Abhängigkeit der einbezogenen kapitalistischen Länder vom USA-Imperialismus geschaffen werden, das gleichsam zwangsläufig deren politische und militärische Gleichschaltung auf den Kurs der USA-Politik nach sich zog. Der Marshallplan übte schon in seiner Vorbereitungs- und Anfangsphase 1947 in den Westzonen Deutschlands und in den anderen: einbezogenen Ländern die Funktion aus, antimonopolistische Umgestaltungen jeder Art als „sozialistische Experimente“ zu verhindern.
Der Gedanke einer Unterstützung des Wiederaufbaus in den europäischen Ländern durch die USA, die nicht unter Kriegszerstörungen im eigenen Land litten und deren Wirtschaft im Kriege expandiert hatte, war naheliegend. Die Sowjetunion hatte des öfteren ihr Interesse an der Realisierung dieser Möglichkeit bekundet und war zunächst auch bereit, eine solche ins Auge zu fassen. Voraussetzung war, daß diese Unterstützung ohne politische Bedingungen gewährt und die Souveränität der Staaten, über ihr Wirtschaftsleben zu entscheiden, nicht in Frage gestellt wurde und daß die Empfängerländer in Übereinstimmung mit ihren Bedürfnissen — Einfluß auf die Lieferungen nehmen konnten und nicht zum bloßen Absatzmarkt der USA-Wirtschaft degradiert wurden.
Die herrschenden Kreise des amerikanischen Imperialismus waren jedoch zur Gewährung solcher Wirtschaftshilfen nicht bereit. Die Bedingungen des Marshallplans ließen die Verwirklichung der Möglichkeiten eines gesamteuropäischen Wiederaufbaus gleichberechtigter Nationen nicht zu, denn eine Beteiligung an diesem „Wiederaufbauprogramm“ war der Sowjetunion und den volksdemokratischen Ländern nicht möglich, ohne ihren demokratischen und sozialistischen Wirtschaftsaufbau zu gefährden und sich dem Kapitalismus und der Konterrevolution zu öffnen.
Der Politische Planungsstab des State Department hatte dies vorprogrammiert. In seinem Memorandum vom 16.Mai 1947 war ganz eindeutig die Ausrichtung des Hilfsprogramms auf Westeuropa fixiert: „Das Programm sollte so geplant werden, daß es dazu beiträgt, eine Form regionalen politischen Zusammenschlusses der westeuropäischen Staaten zu ermutigen. Unsere Besatzungspolitik in Deutschland und Österreich muß dahingehend ausgerichtet werden, die westlichen Zonen zu befähigen, einen maximalen Beitrag für die allgemeine ökonomische Wiederherstellung Westeuropas zu leisten.“’? Zugleich wurde empfohlen und am 23.Mai 1947 in einem weiteren Memorandum bekräftigt, das Angebot offiziell auch an alle osteuropäischen Länder und sogar an die Sowjetunion zu richten, es aber so zu konzipieren, „daß sich die russischen Satellitenländer entweder aus Unwillen, die vorgeschlagenen Bedingungen zu akzeptieren, selbst ausschließen oder einwilligen, die einseitige Ausrichtung ihrer Wirtschaft aufzugeben“.”? Deutlich wurde diese Absicht im Verlauf der Konferenz der AuBenminister der Sowjetunion, Großbritanniens und Frankreichs, die zur Beratung der Marshallplanvorschläge vom 27. Juni bis 2. Juli 1947 in Paris stattfand. Die Außenminister der beiden westlichen Staaten lehnten es dort brüsk ab, die von W. M. Molotow entwickelten konstruktiven Vorschläge für ein europäisches Wiederaufbauprogramm zu unterstützen.
Der Marshallplan bedeutete im Kontext mit der Truman-Doktrin — im Maße der Verwirklichung beider das Ende des „Zeitalters von Potsdam“ und der Viermächteverwaltung Deutschlands. Er implizierte die Spaltung Deutschlands und begrub die Chance des deutschen Volkes, seine nationalstaatliche Souveränität in einem deutschen Friedensstaat wiederzuerrichten. Denn die Westzonen waren von vornherein als ein unverzichtbarer Bestandteil des Marshallplanprogramms eingeplant. Im Schlußbericht. der Marshallplankonferenz von 16 Staaten im September 1947 in Paris wurde deren Zustimmung mit der Forderung nach der Einbeziehung der Westzonen verbunden.
Mit dem Marshallplan setzten die USA ihre überlegene ökonomische Macht ein, um die Folgen ihrer Politik des kalten Krieges zu kaschieren und diese Politik für die westeuropäischen Länder attraktiv zu machen. Obwohl der Marshallplan zweifellos zum wirtschaftlichen Aufbau und zur Wiedergesundung der Wirtschaft dieser Länder beigetragen hat, waren seine ökonomischen Wirkungen sehr unterschiedlich und insgesamt nicht so groß, wie das erwartet und in der zeitgenössischen Presse weithin eingeschätzt wurde. Schon lange vor dem Wirksamwerden der Marshallplanlieferungen für die Westzonen im 2.Halbjahr 1948 setzte hier seit den 2.Halbjahr 1947 — nach Überwindung der Transportkrise — eine deutliche, allerdings bis zur Währungsreform verdeckte wirtschaftliche Wiederbelebung ein.
Seit dem Sommer 1947 übte der Marshallplan in den Westzonen und Westeuropa eine kaum zu überschätzende politisch-moralische Wirkung aus. Eine großangelegte und von breiten Kreisen willig aufgenommene Propaganda stimulierte die daran geknüpften Erwartungen und Hoffnungen. Es schien sich nun für die Menschen in den Westzonen ein leichterer und schnellerer Weg aus der wirtschaftlichen Not als der des Aufbaus aus eigener Kraft zu eröffnen. Die Verheißungen des Marshallplans drängten in der öffentlichen Diskussion die Probleme der Faschismusbewältigung und Entmonopolisierung sowie des Abschlusses eines Friedensvertrages und der Bildung einer provisorischen deutschen Regierung in den Hintergrund. Ähnlich wie nach dem ersten Weltkrieg funktionierte auch diesmal die imperialistische Politik mit dem Hunger. Der kalte Krieg, verbunden mit den Verheißungen des Marshallplans, führte in den Westzonen eine tiefgreifende Veränderung des politischen Klimas, der politischen Konstellationen und der gesellschaftlichen Psychologie herbei.
Die Direktive JCS 1779 und das Ende der britischen „Sozialisierungspolitik“
Während sich die Westmächte den Anschein gaben, als ob auch sie an einer Viermächteregelung der deutschen Frage auf der Ende 1947 bevorstehenden Londoner Konferenz des Rates der Außenminister interessiert seien bzw. eine solche Regelung für möglich erachteten, hatten die USA und Großbritannien die Grundsatzentscheidung zur Schaffung eines Westzonenstaates längst gefällt und setzten sie diese bereits Schritt für Schritt durch. Entsprechend ihrem Abkommen vom 29. Mai 1947 wurde in Frankfurt am Main der bizonale Wirtschaftsrat errichtet. Er bestand aus 54 von den Landtagen gewählten Mitgliedern und einem Exekutivausschuß. Dieser sollte die Arbeit der fünf bereits seit 1.Januar 1947 bestehenden bizonalen Wirtschaftsämter koordinieren, deren fünf Direktoren die CDU/CSU stellte. Die CDU/CSU verfügte auch im Wirtschaftsrat selbst — zusammen mit anderen bürgerlichen Parteien — über eine klare Mehrheit. Profilierte Exponenten von Großkapital und Großgrundbesitz wie Robert Pferdmenges, Günter Henle, Otto Schniewind und Hans Schlange-Schöningen bestimmten den wirtschaftlichen Kurs dieses Gremiums, das am 25. Juni 1947 zum erstenmal zusammentrat. Die SPD ging in Opposition.
Die Arbeitsgemeinschaft SED-KPD stellte in ihrer Erklärung vom 12. Juni 1947 zur Bildung des Wirtschaftsrates fest, daß diese einen weiteren, gravierenden Schritt zur Zerreißung Deutschlands und zur Torpedierung einer Viermächtevereinbarung auf der bereits anberaumten Londoner Außenministerkonferenz darstellte. Mit der Entscheidung zur Bildung des Wirtschaftsrates, den die Arbeitsgemeinschaft SED-KPD als Vorform einer autoritären Regierung wertete, waren die Weichen für die Gründung eines Westzonenstaates und die Restauration der Macht des Monopolkapitals gestellt worden.
Die Bildung der Bizone und der BRD
Gleichzeitig damit wurde die Deutschland- bzw. Besatzungspolitik der USA auf eine neue Grundlage gestellt. Zahlreiche Berichte und Memoranden hatten das vorbereitet, darunter der Bericht des Expräsidenten Herbert Hoover, der Anfang 1947 die Westzonen und die Berliner Westsektoren inspiziert, und der Bericht von Lewis Brown, der im Auftrag des State Department die Bizone bereist hatte.
Der Grundtenor der Empfehlungen Hoovers bestand in dem Nachweis, daß die bisherige, am Potsdamer Abkommen orientierte Politik in die Sackgasse geführt, daß sie die deutsche Wirtschaft bankrott und damit anfällig für die Ausbreitung des Kommunismus gemacht habe. Letzteres treffe auch für Westeuropa insgesamt zu. Es müsse zum obersten Anliegen der Deutschlandpolitik der USA als Bestandteil ihrer Europapolitik werden, die deutsche kapitalistische Wirtschaft anzukurbeln, damit sie ihren Beitrag zur wirtschaftlichen Wiedergesundung Westeuropas und damit zur Bannung der Gefahr kommunistischer Infiltration leisten könne. Die deutsche Wirtschaft müsse von allen Sozialisierungsbestrebungen abgeschirmt, ein funktionierendes kapitalistisches Management wiederhergestellt werden. Alles, was dem im Wege stünde, nicht zuletzt auch die Entnazifizierung, müsse aufgegeben bzw. jenem obersten Anliegen untergeordnet werden.
Noch zugespitzter war diese Neuorientierung im Brown-Bericht zusammengefaßt: Aufgabe der Abkommen von Jalta und Potsdam; Zusammenlegung der amerikanischen, der britischen und der französischen Zone; Beendigung der Demontage für Reparationszwecke; Festsetzung eines endgültigen Abschlußtermins für die Entnazifizierung; Schaffung bestimmter Garantien gegen eine Sozialisierung der entkartellisierten Industrie; Verzicht auf alle wirtschaftlichen Kontrollen und Wiederherstellung eines „freien Marktes“; Beteiligung der Westzonen am Marshallplan; Errichtung einer deutschen Zentralregierung für die Westzonen; Vorbereitung der westdeutschen Verteidigungsanlagen auf die Abwehr einer Invasion; Schaffung von Anreizen für den westdeutschen Export; Errichtung einer Zentralbank für die Westzonen zur Ausgabe einer neuen Währung.
Als wesentlich für die Durchsetzung dieser totalen Umorientierung erwies sich, daß die Deutschlandpolitik der USA nunmehr fest in deren antisowjetische Westblock- bzw. Europapolitik eingeordnet wurde. Durch ihre Verbindung mit dem Marshallplan erhielt diese Neuorientierung den Stempel der Unausweichlichkeit und der Einordnung in „höhere Ziele“.
Die neue Direktive JCS 1779 vom Juli 1947 für den amerikanischen Oberbefehlshaber in Deutschland — seit Anfang 1947 General Lucius D. Clay -, die die amerikanische Deutschland- und Besatzungspolitik in Abkehr vom Potsdamer Abkommen neu bestimmte und die Direktive JCS 1067 ersetzte, erklärte es zum Ziel der amerikanischen Besatzungspolitik, „dem deutschen Volke die Möglichkeit zu geben, die Grundsätze und Vorteile einer freien Wirtschaft kennenzulernen“. Entsprechend wurde dann verfahren, wobei Militärgouverneur Clay, als er die Aussetzung von Artikel 41 der hessischen Verfassung ankündigte, unverblümt erklärte: „Aber in einer Zeit, in der die USA so viel Geld aus eigener Tasche zahlen, um Deutschland zu unterstützen, haben sie auch das Recht, ihre Meinung auszudrücken und Experimente nicht zuzulassen.“
Die Labourregierung, deren Vertreter noch Anfang 1947 die Möglichkeit einer „Sozialisierung“ insbesondere der Schwerindustrie an der Ruhr offiziell verlautbart hatten, beugte sich nun auch in dieser Frage dem von der US-Administration ausgeübten Druck. In einem Bericht über die Washingtoner Verhandlungen der Außenminister der USA und Großbritanniens, den Gilmor Jenkins, leitender Beamter des Foreign Office, am 10. August 1947 für Außenminister Bevin anfertigte, hieß es resignierend: „We have … lost our freedom of action with regard to socialisation …
Die Auseinandersetzungen auf den Parteitagen von LDPD und CDU um die Kursbestimmung
Anfang Juli 1947 veröffentlichte das „Neue Deutschland“ den für den II. Parteitag der SED im September bestimmten Entwurf einer „Entschließung zur politischen Lage“. Nach Abschluß der Pariser Außenministerkonferenz der UdSSR, Großbritanniens und Frankreichs nahm der Parteivorstand in einer speziellen Erklärung zum Marshallplan Stellung. Zuvor Mitte Juni hatte die Arbeitsgemeinschaft SED-KPD die schon erwähnten Stellungnahmen zum Ausgang des Ministerpräsidententreffens in München und zur Bildung des Bizonenwirtschaftsrates veröffentlicht. In all diesen Dokumenten enthüllte die SED die Bestrebungen, die Westzonen von der Ostzone abzuschnüren und dort die monopolkapitalistischen Machtverhältnisse zu restaurieren. In der Erklärung vom 23. Juli zum Marshallplan warnte die SED unter Hinweis auf die Erfahrungen des deutschen Volkes mit der amerikanischen Anleihepolitik in den Jahren der Weimarer Republik: „Die Auswirkungen der neuen amerikanischen Anleihepolitik werden noch ebenso verhängnisvoll, wenn nicht schlimmer sein. Der industrielle Westen Deutschlands wird in einen den Frieden bedrohenden Westblock eingegliedert. Sie verwies auf zwangsläufige Folgen für die Westzonen: „Die Macht der deutschen Konzernherren bleibt erhalten. Statt einer deutschen Friedenswirtschaft entsteht ein neues Herrschaftszentrum reaktionärer und kriegslüsterner Elemente. An die Stelle des Mitbestimmungsrechts der Arbeiterschaft am Aufbau der Wirtschaft-tritt die Lohnsklaverei zugunsten ausländischer und deutscher Monopolkapitalisten.“ ’® Das Marshallplanprojekt zurückweisend, erklärte die SED: „Das deutsche Volk muß wie alle übrigen Völker den Weg zu einem besseren Leben aus eigener Kraft suchen und finden. Das wird ihm um so eher gelingen, je rascher die wirtschaftliche und politische Einheit Deutschlands hergestellt wird.“’” Mit dieser Zielsetzung faßte die SED ihre auf den „Grundsätzen und Zielen“ beruhende Strategie und Taktik zusammen und entwickelte sie ein Handlungsprogramm, in dessen Mittelpunkt eine Beratung der antifaschistisch-demokratischen Parteien aller Besatzungszonen und die Durchführung eines Volksentscheids über die Einheit Deutschlands standen.
Sichtpropaganda für den Wirtschaftsaufbau aus eigener Kraft, 1947
Die Erklärungen der SED vom Sommer 1947 bedeuteten Klarstellungen zu einem Zeitpunkt, als sich die Klassenauseinandersetzungen zuspitzten. Reaktionäre Kräfte hofften, die Ostzone werde in den Sog der restaurativen Prozesse in den Westzonen und des Marshallplans geraten, und steigerten ihre Angriffe auf den antifaschistisch-demokratischen Entwicklungsweg. In breiten Bevölkerungsschichten verstärkten sich politische Schwankungen. Enttäuschungen über das Ausbleiben der von den Besatzungsmächten zugesagten Lösung der Deutschlandfrage spielten dabei ebenso eine Rolle wie die nach der Winterkatastrophe anhaltenden wirtschaftlichen, sozialen und ernährungswirtschaftlichen Nöte. Die Parteitage von LDPD und CDU reflektierten diese Situation.
Der 2. Parteitag der LDPD fand vom 4. bis 7. Juli 1947 in Eisenach statt. Das Referat des Parteivorsitzenden Wilhelm Külz war Ausdruck des Suchens bürgerlich-demokratischer Politiker nach dem Weg zur Abwendung der Gefahr einer Spaltung Deutschlands. Besorgt, die Herausbildung zweier weltpolitischer Lager werde Deutschland endgültig zerreißen, gelangte Külz zu der Auffassung, Deutschland müsse als Herzstück Europas eine Mittlerrolle im Ost-West-Konflikt wahrnehmen: „Wir kennen weder eine östliche noch eine westliche Orientierung, nur eine kennen wir: Deutschland!“®° Mit Blick auf die realen Gegebenheiten wies Külz darauf hin, daß ohne die Sowjetunion als Weltmacht eine Lösung der deutschen Frage nicht möglich sei. Zum Marshallplan bezog Külz eine ausweichende Position. Wenige Tage vor dem Parteitag hatte er im Parteiorgan „Der Morgen“ auf die Gefahr hingewiesen, „daß sich die Weltgeldherrschaft zu einer Weltherrschaft schlechthin entwickeln könnte“. Er war für eine Hilfsaktion unter der Ägide der Vereinten Nationen eingetreten. Auf dem Parteitag äuBerte er mit Blick auf die von der Sowjetunion auf der Pariser Außenministerkonferenz erklärte Ablehnung der an das Projekt geknüpften Bedingungen die Hoffnung, in der Sache selbst sei damit noch nichts endgültig entschieden. Der Parteivorsitzende bekräftigte seine Überzeugung, die deutsche Wirtschaft könne sich ohne Kredithilfe nicht wieder entfalten. Der Parteivorsitzende der LDPD bekannte sich zur Konzeption des deutschen Einheitsstaates und hob in dieser Frage die Übereinstimmung mit der sowjetischen Deutschlandpolitik hervor. In seiner Stellungnahme zur Entwicklung in der Ostzone stellte er sich auf den Boden der entstandenen antifaschistisch-demokratischen Verhältnisse und plädierte er für die weitere Blockzusammenarbeit unter Betonung der Gemeinsamkeiten. Solche Aussagen des Referats wie die, daß die Verantwortung politischer Willensbildung unter Ausschließung der Massenorganisationen allein bei den Parteien liege, daß Auseinandersetzungen zwischen Arbeitern und Unternehmern von außen hereingetragen seien und daß die gesellschaftlichen Umgestaltungen nun zum Stillstand kommen müßten, reflektierten Begrenztheiten des bürgerlich-demokratischen Standpunkts.
Die Diskussion zeigte, daß erst wenige Politiker in Führungsfunktionen diese Grenzen zu überwinden begannen. Unter diesen trat Johannes Dieckmann, der stellvertretende Vorsitzende des Landesverbandes Sachsen, hervor. In seinem Diskussionsbeitrag verteidigte er die Aufnahme des FDGB als stimmberechtigtes Mitglied in den sächsischen Landesblock. Nachdrücklich betonte er, daß die sowjetische Deutschlandpolitik mit den Ansichten seiner Partei übereinstimme, und forderte, „diese Trennungswand zu durchstoßen“?, die schon in der Weimarer Republik von reaktionären Kräften zwischen dem deutschen und dem sowjetischen Volk aufgerichtet worden sei.
Wenn auch der Verlauf des Parteitages grundlegend von den bürgerlich-demokratischen Politikern geprägt wurde, so traten doch konservative Politiker und offen reaktionäre Kräfte stark hervor. Alphons Gaertner, der stellvertretende Vorsitzende des Landesverbandes Thüringen und Präsident der Landesbank, versuchte im Referat zur Wirtschaftspolitik, bekannte neoliberale Positionen für die LDPD festzuschreiben, indem er sich anscheinend gleichermaßen gegen den Monopolkapitalismus und gegen eine sozialistische Wirtschaftsordnung wandte. Einerseits grenzte sich Gaertner von den Konzernen ab — die Existenz privater Großbetriebe an sich jedoch bejahend. Andererseits wandte er sich gegen die Großbetriebe im landeseigenen Industriesektor als dessen Kern und erklärte: „Im übrigen wollen wir keine neuen Konzerne. Wenn Konzerne gefährlich sind, dann können sie auch gefährlich werden in der Hand des Staates.“® Er plädierte für die Wirtschaftslenkung in der Ostzone als den Umständen angemessen und argumentierte zugleich gegen eine umfassende Planwirtschaft, die er mit der faschistischen Zwangswirtschaft verglich. Die Rede war Ausdruck dafür, daß ein starres Festhalten an konservativen Auffassungen unter den Bedingungen der verschärften Auseinandersetzungen um den weiteren Entwicklungsweg in eine reaktionäre Positionsbestimmung umschlug.
Die vom Parteitag angenommenen wirtschaftspolitischen Resolutionen zielten auf eine Stärkung der privatkapitalistischen Wirtschaft. In ihnen wurden die Zulassung von Unternehmerverbänden und eine Senkung der Einkommens-, Vermögensund Erbschaftssteuer gefordert.
Mit der Forderung, Wilhelm Külz als Vorsitzenden abzuwählen, unternahmen die im Berliner Landesverband konzentrierten reaktionären Kräfte einen offenen Vorstoß. Waldemar Koch sollte wieder an die Spitze der Partei treten, Carl-Hubert Schwennicke, der Berliner Landesvorsitzende und Interessenvertreter des Siemens-Konzerns, Stellvertreter werden. Die Wiederwahl von Külz mit neun Zehnteln aller Stimmen bedeutete eine Schlappe für diese Kräfte, aber noch keine endgültige Niederlage.
In den Monaten nach dem Parteitag versuchten sie — die unentschlossene Haltung vieler Liberaldemokraten ausnutzend -, durch eine Vielzahl fortschrittsfeindlicher Aktionen den antifaschistisch-demokratischen Kurs der Partei aufzuweichen bzw. aufzuheben. Abgeordnete der LDPD verstärkten im Herbst 1947 im Sächsischen Landtag die schon seit Jahresbeginn betriebenen Attacken gegen die landeseigenen Betriebe. Auf dem Parteitag des sächsischen Landesverbandes,
des zahlenmäßig stärksten, wurde Hermann Kastner aus dem Amt des Landesvorsitzenden abgewählt. An seine Stelle trat der Ministerialdirektor im Wirtschaftsministerium der Landesregierung Arthur Biretschneider, der für seine konservativen Ansichten bekannt war. Mitte Oktober 1947 ließ sich der Parteivorstand dazu drängen, eine Kommission zur Überprüfung von Enteignungsentscheidungen zu fordern. Die Auseinandersetzungen in der LDPD um die Kursbestimmung verschärften sich, und ihr Ausgang war noch nicht entschieden.
Die größeren Gefahren für die Fortführung der Blockzüsammenarbeit ergaben sich jedoch aus Vorgängen in der CDU. Vom 6. bis 8. September 1947, also in einer Zeit sich weiter zuspitzender Klassenauseinandersetzungen auf deutschem Boden, fand in Berlin der 2. Parteitag der CDU statt. War diese Partei ohnehin die einflußreichere der beiden bürgerlich-demokratischen Parteien in der Ostzone, so glaubten sich Jakob Kaiser und die bestimmenden Kräfte in der Parteiführung angesichts der dominierenden Rolle von CDU/CSU bei der restaurativen Neuordnung in den Westzonen in einer Position der Stärke. Unter ihrer Regie wurde der Parteitag darauf ausgerichtet, die antifaschistisch-demokratischen Verhältnisse in Zweifel zu ziehen und sich an der westzonalen Entwicklung in Richtung eines reformierten Kapitalismus zu orientieren.
Bereits im Sommer 1947 hatte sich Kaiser vom antifaschistisch-demokratischen Grundkonsens der drei Parteien distanziert, indem er faktisch das Marshallplanprojekt befürwortete und in Leitsätzen von der Blockzusammenarbeit abrückte. Auf dem Parteitag ging er einen Schritt weiter und kündigte an, seine Partei werde die Funktion einer „regulierenden Opposition“ ausüben.®* Die CDU müsse „Wellenbrecher des dogmatischen Marxismus und seiner totalitären Tendenzen“ sein. Das Wesen der ideologischen und politischen Auseinandersetzungen in Deutschland bestand nach Kaisers Ansicht darin, daß sich hier „dogmatischer Marxismus mit seinem totalitären Willen einerseits und eine Welt, der die persönliche Freiheit und das Recht der Persönlichkeit oberstes Gesetz sind“, andererseits gegenüberstünden. Erstmals wurde damit in einer breiten Öffentlichkeit der Ostzone die fortschrittsfeindliche Totalitarismusdoktrin als politisches Credo von einem namhaften Politiker vorgetragen. In diesem Kontext und auch angesichts der nochmals erhobenen Forderung nach „materieller Hilfe von außen“ konnte die schon weit vor dem Parteitag entwickelte Formel vom „Brückenschlag zwischen Ost und West“ nur als eine Westoption verstanden werden. Das Ziel, die Hegemonie der Arbeiterklasse und die antifaschistisch-demokratischen Verhältnisse zu beseitigen, verklausulierte Kaiser mit der Forderung nach „Korrekturen“ bzw. nach einer „Bereinigung“ und tarnte er mit der Sorge um die Einheit Deutschlands. „Die Ordnung der Ostzone“, erklärte Kaiser, „muß einen Charakter tragen, daß der deutsche Westen und Süden nicht allzusehr erschrickt.“ Das Grundsatzreferat, mit zahlreichen Fortschrittsbeteuerungen angefüllt, sollte bei den Delegierten den Eindruck der Zwangsläufigkeit einer derartigen Positionsbestimmung entstehen lassen. Für den Tenor des Referats war auch kennzeichnend, daß Kaiser die Oder-Neiße-Grenze angriff und Forderungen nach einer Grenzrevision an die Adresse Polens richtete.
Das wirtschaftspolitische Referat hielt Karl Arnold, Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen. Es war offensichtlich als Schützenhilfe für Kaisers Kursbestimmung gedacht. Als Ausweg aus der wirtschaftlichen Notlage nannte Arnold die Herstellung der wirtschaftlichen Einheit Deutschlands, verlangte aber im gleichen Atemzug „ausländische Kredithilfe zumindest für die Überbrückung der Anlaufjahre“. Welchen Inhalt Arnold der Wirtschaftseinheit zu geben ‚gedachte, erschloß sich aus dem zweiten Teil des Referats. Im Zentrum seiner Ausführungen zu „Problemen der Wirtschaftsordnung“ standen nämlich Angriffe auf die Wirtschaftsplanung und die landeseigenen Betriebe in der Ostzone. Arnold äußerte, ihn erfülle „tiefe Sorge über die wirtschaftlichen Änderungen in der Ostzone und über das der CDU völlig fremde System der landeseigenen Betriebe“.®° Die offenen Angriffe wurden in der Diskussion von mehreren Delegierten zurückgewiesen. Zugleich wurde die Forderung erhoben, man möge in den Westzonen die wirtschaftliche Neuordnung in der Ostzone als Beitrag zu einer wirtschaftlichen Neugestaltung Deutschlands anerkennen.
Im Verlaufe des Parteitages gaben Politiker wie Reinhold Lobedanz, Otto Nuschke und Luitpold Steidle ihrem Bekenntnis zum antifaschistisch-demokratischen Entwicklungsweg Ausdruck und grenzten sich vom Marshallplan ab — ohne allerdings gegen Kaiser zu polemisieren. Der Neubauer August Hillebrand forderte eine verstärkte Unterstützung der Neubauern und die Durchführung einer Bodenreform in ganz Deutschland.
Die fast einstimmige Wiederwahl von Jakob Kaiser und Ernst Lemmer als 1. bzw. 2. Vorsitzender der CDU zeigte die gelungene Parteitagsregie an. Es schien, als sei die in der CDU bestehende tiefe Gegensätzlichkeit überbrückt und ein reaktionärer Kurswechsel ohne innere Krise möglich.
Sowohl der Parteitag der CDU als auch die Auseinandersetzungen in der LDPD signalisierten, daß reaktionäre Kräfte in beiden Parteien von taktischen Geplänkeln zum Angriff auf die Blockzusammenarbeit übergehen und eine legale politische Opposition zur SED formieren wollten. Mit Kaiser hatten sie einen Wortführer gefunden. Diese Vorgänge zeigten, daß die konterrevolutionären Kräfte in der Ostzone legal nur im Rahmen der beiden bürgerlich-demokratischen Parteien agieren konnten und sich deshalb tarnen mußten. Letztlich wurde der illusionäre Plan verfolgt, die Zustände in der Ostzone und in ganz Berlin nach stufenweiser Zurücknahme der antifaschistisch-demokratischen Errungenschaften — denen der Westzonen anzugleichen und Voraussetzungen für die Einbeziehung der Ostzone in die westorientierte Staatsbildung zu schaffen. Hatte der kalte Krieg die reaktionären Kräfte zu diesem Schritt ermutigt, so sahen sie sich durch die Weichenstellung in Richtung Westzonenstaat in Zugzwang. Im Herbst 1947 entwickelte sich — auf dem Hintergrund der sich zuspitzenden weltund deutschlandpolitischen Auseinandersetzungen -— eine für die Fortführung des progressiven Entwicklungsweges in der Ostzone schwierige Situation.
Der II. Parteitag der SED. Das Konzept des Aufbaus aus eigener Kraft als Alternative zum Marshallplan
Vom 20. bis 24. September 1947 tagte in Berlin der II. Parteitag der SED. Als Partei der Arbeiterklasse und zahlenmäßig stärkste deutsche Partei — mit 1,8 Millionen Mitgliedern, unter ihnen eine halbe Million seit dem Vereinigungsparteitag aufgenommene Frauen, Männer und Jugendliche — mußte die SED eine Antwort auf die Lebensfragen des deutschen Volkes geben: Wie war der Kampf um die Herstellung der einheitlichen demokratischen Republik zu führen angesichts der Vertiefung der Unterschiede in der Entwicklung der Ostzone und der Westzonen zu Gegensätzlichkeiten, und wie war eine Willensbekundung des deutschen Volkes auf der Londoner Außenministerkonferenz zu erreichen? Welche Möglichkeiten bestanden in den Westzonen noch, die Arbeiterklasse zu mobilisieren und Einheitsbestrebungen voranzubringen, die restaurativen Prozesse zu stoppen und eine konsequente Demokratisierung einzuleiten? Wie waren in der Ostzone die Errungenschaften der antifaschistisch-demokratischen Umwälzung zu stabilisieren und zu erweitern, und auf welchen Wegen konnte eine Wende von den andauernden wirtschaftlichen und sozialen Nöten zu einem stabilen Aufstieg herbeigeführt werden?
Nachdem der im Juli veröffentlichte Entwurf der „Entschließung zur politischen Lage“ bereits Gegenstand einer allgemeinen Diskussion in den Gliederungen der Partei während der Parteiwahlen gewesen war, bestimmte der Parteitag den weiteren Kurs der SED. Den Politischen Bericht des Parteivorstandes gab Wilhelm Pieck, den Organisatorischen Bericht Erich W. Gniffke. Otto Grotewohl referierte zum „Kampf um die nationale Einheit und um die Demokratisierung Deutschlands“, Walter Ulbricht zum „Demokratischen Neuaufbau in Wirtschaft und Verwaltung“. Die Berichte und Referate waren Gegenstand einer mehrtägigen Diskussion. Der Parteitag bekräftigte die vom Vereinigungsparteitag beschlossenen „Grundsätze und Ziele der SED“. Diese programmatischen Orientierungen bewährten sich sowohl beim demokratischen Neuaufbau in der Ostzone als auch im Ringen um demokratische Einheit und gerechten Frieden. Die Ausarbeitung eines umfassenden Parteiprogramms, die der Vereinigungsparteitag dem nachfolgenden Parteitag als Aufgabe vorgegeben hatte, konnte folglich zurückgestellt werden. Diese Entscheidung wurde vor allem deshalb getroffen, weil wesentliche Fragen der Gestaltung der Zukunft Deutschlands noch offen waren oder schienen nicht zuletzt mit dem Blick auf die bevorstehende Londoner Außenministerkonferenz der vier Mächte.
Der Parteitag analysierte die gegensätzlichen Entwicklungen, die sich in der Ostzone einerseits und in den Westzonen andererseits vollzogen, und erklärte in seiner „Entschließung zur politischen Lage“, daß „der Kampf um die Einheit Deutschlands die dringendste Aufgabe des deutschen Volkes“ sei. Er bekräftigte die vom Vereinigungsparteitag erhobene Forderung, in allen Teilen Deutschlands das Potsdamer Abkommen konsequent durchzusetzen, also alle Nazis aus öffentlichen Funktionen zu entfernen, die Monopole zu zerschlagen und eine demokratische Bodenreform durchzuführen sowie das Kulturund Geistesleben demokratisch umzugestalten. Ein antifaschistisch-demokratischer Wandel in ganz Deutschland hätte für eine friedliche Nachkriegsentwicklung Europas großes Gewicht gehabt und lag folglich im Interesse sowohl des deutschen Volkes als auch aller anderen Völker. Er war zugleich der einzige Weg, die Spaltung Deutschlands aufzuhalten und die einheitliche, demokratische deutsche Republik zu errichten. Da die Gefahr der Spaltung vom restaurativen Kurs in den Westzonen ausging, war der Kampf gegen die Wiederherstellung monopolkapitalistischer Herrschaftsverhältnisse und um antifaschistisch-demokratische Umgestaltungen zugleich der Kampf für die Einheit der Nation. Darin bestand zum damaligen Zeitpunkt der soziale Inhalt der nationalen Frage. Die SED forderte erneut — und wegen der bevorstehenden Londoner Außenministerkonferenz mit Dringlichkeit —, einen „Volksentscheid für die Gestaltung Deutschlands zu einem demokratischen Einheitsstaat mit dezentralisierter Verwaltung“ ®® durchzuführen und sofort deutsche Zentralverwaltungen für die Wirtschaft als Schritt zur Vorbereitung einer gesamtdeutschen Regierung einzurichten.
Die demokratischen Parteien aller vier Besatzungszonen sollten sich „zu einer gesamtdeutschen Beratung gemeinsam mit den Ländervertretungen zusammenfinden …, um den Willen des deutschen Volkes zum Ausdruck zu bringen“.
Obwohl die von den aggressivsten Kräften des USA-Imperialismus ausgelöste Politik der Konfrontation zur Sowjetunion immer mehr die Viermächtekooperation in bezug auf Deutschland in Gefahr brachte, richtete die SED ihre ganze Kraft darauf, das Zustandekommen eines Kompromisses in der Deutschlandfrage auf der Londoner Konferenz zu fördern. Sie ließ nichts unversucht, um der Politik der imperialistischen Spaltung Deutschlands entgegenzuwirken. Der Parteitag erklärte: „Deutschland darf aber nicht zu einem Unruheherd in Europa werden. — Deshalb muß Deutschland gemäß dem Potsdamer Abkommen wirtschaftlich und politisch ein einheitliches Ganzes bilden. Das ist die Grundfrage unserer Politik.“
In Übereinstimmung mit diesen Zielstellungen für ganz Deutschland ging die SED an die Bestimmung der spezifischen Aufgaben in der Ostzone. Sie orientierte im Einklang mit dem Befehl Nr. 201 der SMAD vom 16. August 1947 auf den beschleunigten Abschluß der Entnazifizierung, verlangte die baldige Zuendeführung der Sequestrierung und der Bodenreform und forderte, die demokratischen Verwaltungsorgane zu festigen. Der Parteitag erarbeitete ein Programm des beschleunigten wirtschaftlichen Aufbaus, um eine Wende zur Beseitigung der Not und zur Verbesserung der Lebenslage zu erreichen und die Ergebnisse der gesellschaftlichen Umwälzung, insbesondere die von der Arbeiterklasse errungenen Machtpositionen, zu festigen. Mit aller Klarheit brachte die SED zum Ausdruck: „Die drückende Not unseres Volkes ist die zwangsläufige Folge der Nazibarbarei und ihres völkermordenden Krieges. Entbehrungsvolle Jahre härtester Arbeit liegen vor uns.“?! Sie trat damit zugleich der verleumderischen Behauptung reaktionärer Kräfte entgegen, daß die antifaschistisch-demokratischen Umgestaltungen zusammen mit den Reparationslasten und der Abtrennung der Gebiete östlich von Oder und Neiße die Ursache der andauernden Not seien.
Unter der Losung „Mehr produzieren, gerechter verteilen, besser leben!“ rief der Parteitag im „Manifest an das deutsche Volk“ zu einer Volksinitiative für die Steigerung der Produktion und die Kontrolle der Warenverteilung auf.?? Die SED stellte diese Losung in das Zentrum ihres wirtschaftlichen Aktionsprogramms. Das wichtigste war, die landeseigenen Betriebe zu festigen, die Produktion auf der Grundlage eines auszuarbeitenden Wirtschaftsplanes systematisch zu steigern und einen geregelten Warenverkehr unter Zurückdrängung von Schiebertum und Kompensationshandel zu entwickeln. Es galt, verstärkt eine neue Einstellung der Werktätigen zu den volkseigenen Betrieben und zu den demokratischen Verwaltungsorganen auszuprägen. In den Mittelpunkt der agrarwirtschaftlichen Aufgabenstellung rückte der Parteitag die Kräftigung der Neubauernhöfe und die Förderung der Ertragssteigerung in der gesamten Landwirtschaft. Mit der Kursbestimmung für den weiteren Kampf um einen einheitlichen, demokratischen deutschen Staat sowie für den Ausbau der antifaschistisch-demokratischen Verhältnisse in der Ostzone und die Überwindung der Not des Volkes bereitete die SED den Boden, die gesellschaftliche Führungsrolle der Arbeiterklasse weiter auszugestalten und das bewährte breite Bündnis der Arbeiterklasse mit den anderen Klassen und Schichten und die Blockzusammenarbeit fortzuführen.
Die Delegation der KPdSU auf dem II. Parteitag der SED, September 1947. Im Vordergrund: M. A. Suslow
Der Parteitag orientierte auf die Stärkung der Partei und stellte angesichts des starken Mitgliederzuwachses ihr qualitatives Wachstum in den Vordergrund. Dabei galt es auch, politische Schwankungen, die sich im Sommer 1947 nicht zuletzt, unter dem Einfluß der schwierigen wirtschaftlichen Lage und unter dem Druck der Eskalation der Marshallplanpropaganda gezeigt hatten, zu überwinden. Von besonderem Gewicht für die Entwicklung der SED war, daß Otto Grotewohl der von opportunistischen Politikern in der Sozialdemokratie vertretenen These entgegentrat, „der Leninismus sei eine rein russische oder mindestens eine östliche Angelegenheit und habe darum für Westeuropa keine Bedeutung“. Der ehemalige Vorsitzende des Zentralausschusses der SPD bekannte sich öffentlich zu der Aufgabe, „die allgemeinen Richtlinien des Marxismus-Leninismus unter den Bedingungen unseres Landes und unserer Zeit weiterzuentwickeln und anzuwenden“. Zur Erhöhung der gesellschaftlichen Rolle der Partei beschloß der Parteitag als innerparteiliche Hauptaufgabe, das qualitative Wachstum der Partei zu fördern, und erklärte: „Das sozialistische Bewußtsein und die politische Aktivität der Parteimitglieder sind zu entwickeln.“’ Besonderes Gewicht legte er auf die Gewinnung der Frauen und der Jugendlichen für den Kampf um gesellschaftlichen Fortschritt und beschloß dazu spezielle Resolutionen.
Der Parteitag wählte per Akklamation einstimmig Wilhelm Pieck und Otto Grotewohl erneut als Vorsitzende der SED. Weitere 58 Mitglieder des Parteivorstandes wurden in geheimer Abstimmung gewählt. 20 Mitglieder benannte die Arbeitsgemeinschaft SED-KPD und delegierte sie in den damit 80köpfigen Parteivorstand.
Bürgerliche Kontrahenten und reaktionäre Kräfte hatten gehofft, auf dem Parteitag würde angesichts der ungelösten Deutschlandfrage, der zunehmenden OstWest-Polarisierung, der in den Westzonen ausgebliebenen Vereinigung der Arbeiterparteien und der anhaltenden wirtschaftlichen und sozialen Nöte eine innere Zerrissenheit der SED in Erscheinung treten. Verlauf und Ergebnisse des II. Parteitages bezeugten hingegen die Festigkeit des mit dem Vereinigungsparteitag geschaffenen Fundaments und das Reifen der SED als Kampfpartei der geeinten Arbeiterklasse. Ein weiteres Mal erwies sie sich als die entscheidende und wegweisende Kraft der antifaschistisch-demokratischen Umwälzung und des antiimperialistischen Kampfes.
Am Parteitag der SED nahmen neben der Delegation der KPdSU(B) unter Leitung von M. A. Suslow, Sekretär des Zentralkomitees, Vertreter von Bruderparteien aus fast allen volksdemokratischen Ländern und mehreren kapitalistischen Staaten Europas teil. Weitere Parteien hatten Beobachter geschickt oder Grußbotschaften übermittelt. „Alles das hat uns das Bewußtsein gegeben, daß wir nicht mehr allein stehen, sondern wieder dem großen Bruderbunde der sozialistischen Arbeiterbewegung angehören. Zum erstenmal nach den langen Jahren der Hitlerschmach erklang in Deutschland wieder das Bekenntnis zur internationalen Solidarität.“ Mit diesen Worten würdigte Wilhelm Pieck im Schlußwort auf dem II. Parteitag die Anteilnahme der Bruderparteien.
Die Beschlüsse der KPdSU und weiterer kommunistischer und Arbeiterparteien Europas auf dem Treffen in Szklarska Poreba
Vom 22. bis 27. September 1947 kamen Vertreter der KPdSU, der kommunistischen und Arbeiterparteien der volksdemokratischen Länder sowie der beiden mitgliederstärksten kommunistischen Parteien kapitalistischer Länder, der Französischen und der Italienischen Kommunistischen Partei, in Szklarska Poreba (Polen) zu einer Beratung zusammen. Es war die erste Zusammenkunft mehrerer kommunistischer Parteien seit der Auflösung der Kommunistischen Internationale im Jahre 1943. Die Teilnehmer erörterten auf der Grundlage eines Referats von A. A.Shdanow, Mitglied des Politbüros des ZK der KPdSU(B), die internationale Lage, tauschten Erfahrungen aus und berieten die engere Zusammenarbeit.
Shdanow analysierte die seit Beendigung des zweiten Weltkriegs in der internationalen Arena eingetretenen Veränderungen und erläuterte aus der Sicht der KPdSU die Aufgaben der kommunistischen und Arbeiterparteien „bei der Zusammenfassung der demokratischen, antifaschistischen, friedliebenden Elemente im Kampf gegen die neuen Kriegs- und Aggressionspläne Shdanows Aussage, daß in der internationalen Arena immer deutlicher zwei Hauptrichtungen hervortreten, gipfelte in der zugespitzten Feststellung, daß dies zur Teilung der Welt in zwei deutlich voneinander abgegrenzte Lager geführt habe: „das imperialistische und antidemokratische Lager einerseits und das antiimperialistische und demokratische Lager andererseits“. Shdanow formulierte zugleich die Erwartung, das antiimperialistische Lager könne sich stützen „auf die Arbeiterbewegung und auf die demokratische Bewegung in allen Ländern, auf die brüderlichen kommunistischen Parteien in allen Ländern, auf die Kämpfer der nationalen Befreiungsbewegung in den kolonialen und den abhängigen Ländern sowie auf die Hilfe aller fortschrittlichen, demokratischen Kräfte, die in jedem Lande vorhanden sind“.
Die Politik der Staaten des antiimperialistischen Lagers, insbesondere der UdSSR und der volksdemokratischen Länder, konzentriere sich auf den Kampf gegen die Gefahr neuer Kriege und gegen die imperialistische Expansion, auf die Festigung der Demokratie sowie die Ausrottung der Überbleibsel des Faschismus. Im Kampf um einen dauerhaften, demokratischen Frieden als der „Hauptaufgabe der Nachkriegsperiode“ komme der UdSSR die Führungsrolle zu.”
Mit dem Blick auf die Aufgaben der Kommunisten machte Shdanow auf die nach der Auflösung der Kommunistischen Internationale eingetretene Gefahr „einer Abnahme des gegenseitigen Verständnisses“ 100 aufmerksam.
Die Beratung der neun Parteien nahm eine Deklaration an, die die Aussagen des Referats von Shdanow teilweise noch mehr zuspitzte. Das Dokument enthielt Vereinfachungen in bezug auf das Verhältnis von Imperialismus und Krieg und hinsichtlich der Entwicklung des internationalen Kräfteverhältnisses. Es konstatierte, daß mit der „zunehmenden Verschärfung der allgemeinen Krise des Kapitalismus und mit der Schwächung seiner Macht und umgekehrt der Stärkung der Kräfte des Sozialismus und der Demokratie“ sich der Kampf zwischen den beiden Lagern immer mehr verschärft. Die sozialdemokratischen Politiker in Regierungsverantwortung in den von den USA abhängigen Ländern und auch in den Westzonen Deutschlands wurden als „jederzeit getreue Helfershelfer der Imperialisten“ bezeichnet. Damit blieb die Deklaration hinter Differenzierungen zurück, die den Dokumenten des VII. Kongresses der Kommunistischen Internationale eigen waren. Die in dieser Art getroffene Aussage über die Herausbildung zweier Lager in der Weltpolitik barg Gefahren einer schablonenhaften Sicht in sich, zumal die Widersprüchlichkeit der Beziehungen zwischen den USA einerseits und den von ihnen mehr oder weniger abhängigen Ländern andererseits außer acht blieb. Die zur imperialistischen Politik des kalten Krieges formulierte Gegenposition betonte nur die aufgebrochenen Gegensätze und bot daher wenig Ansatzpunkte für neue Kompromisse mit verständigungsbereiten Kräften in den herrschenden Kreisen der Westmächte. Doch lenkte die Deklaration den Blick der kommunistischen und Arbeiterparteien und aller antiimperialistischen Kräfte auf die Hauptaufgabe in der internationalen Sphäre, auf ihren Kampf um die Sicherung des Friedens. Dabei stellte die Betonung einer potentiellen Überlegenheit der um die Sicherung des Friedens ringenden Kräfte eine große Ermutigung dar: „Es muß immer im Auge behalten werden, daß zwischen dem Wunsch der Imperialisten, einen neuen Krieg zu provozieren, und der Möglichkeit, ihn zu organisieren, ein enormer Abstand besteht. Die Völker der Welt wollen keinen Krieg. Die Mächte, die den Frieden verteidigen, sind so groß, so einflußreich, daß die Pläne der Angreifer einen völligen Fehlschlag erleiden werden, wenn diese Mächte bei der Verteidigung des Friedens unerschütterlich bleiben und Entschlossenheit und Ausdauer zeigen.“ Diese Aussage zum internationalen Kräfteverhältnis reflektierte sowohl die noch immer vorhandene Antikriegsstimmung breiter Bevölkerungsschichten in den kapitalistischen Ländern als auch die sich vollziehenden Veränderungen zugunsten der antiimperialistischen Kräfte.
Mit dem Blick auf die komplizierte internationale Situation und die schon zwei Jahre nach der Zerschlagung des faschistischen Kriegsherdes neu entstandenen Gefahren für den Weltfrieden trafen die Teilnehmer Absprachen über ein engeres Zusammenwirken. Sie beschlossen die Bildung des Kommunistischen Informationsbüros (Kominform) zum wechselseitigen Erfahrungsaustausch und zur Koordinierung ihrer Aktionen in der internationalen Arena und legten die gemeinsame Herausgabe eines Presseorgans — der Zeitschrift „Für dauerhaften Frieden, für Volksdemokratie!“ fest.
Hermann Axen empfängt die von Erich Honecker geleitete erste FDJ-Delegation bei ihrer Rückkehr aus der Sowjetunion, August 1947
Das Treffen beschleunigte den politischen Zusammenschluß der UdSSR und der volksdemokratischen Staaten zu einer Staatengemeinschaft, der sich in bilateralen Verträgen über Freundschaft und Beistand manifestierte.
Das Zentralorgan der SED „Neues Deutschland“ druckte am 7.Oktober 1947 das Kommunique der Beratung mit der Deklaration zur internationalen Lage in der Fassung der „Humanite“, des Presseorgans der FKP, ab. Die Rede von Shdanow wurde durch einen Broschürendruck des SWA-Verlages in hoher Auflage ebenfalls noch 1947 zugänglich.
Die Feststellungen der Konferenz von Szklarska Porgba zur Politik der Westmächte deckten sich mit den Erfahrungen der SED im Kampf um die Herstellung der einheitlichen deutschen demokratischen Republik und den Abschluß eines gerechten Friedensvertrages. Sie gingen in dem Maße in die Kursbestimmung ein, wie sich die Chancen eines Kompromisses der vier Mächte in der Deutschlandfrage verringerten und die imperialistische Teilung Deutschlands Tatsache wurde.
Mit der Deklaration von Szklarska Poreba sah sich die SED in ihrem Streben bestätigt, durch die Errichtung eines einheitlichen, demokratischen deutschen Staates die Voraussetzungen für friedliche und gutnachbarliche Beziehungen zu anderen Völkern zu schaffen. Indem sie verstärkt den Kampf gegen Antisowjetismus und Chauvinismus führte und für die Klarstellung der Rolle der Sowjetunion und der volksdemokratischen Länder im Kampf um den Frieden und um eine demokratische Lösung der Deutschlandfrage eintrat, bereitete sie den Weg für die Entwicklung freundschaftlicher Beziehungen. In Übereinstimmung mit den Beschlüssen ihres II. Parteitages baute sie die Beziehungen zu den Bruderparteien benachbarter Länder aus. In gleicher Richtung entwickelten vor allem auch der FDGB, die FDJ und der DFD Aktivitäten. Schon im Juli 1947 hatte eine Delegation der FDJ unter Leitung ihres Vorsitzenden, Erich Honecker, auf Einladung des Komsomol die Sowjetunion besucht. Die Informationsberichte in der Zeitschrift „Für dauerhaften Frieden, für Volksdemokratie!“ nutzte die SED bei der weiteren Ausarbeitung ihrer Politik.
Die geistige Kultur unter den Bedingungen der Klassenauseinandersetzungen in den vier Besatzungszonen
Der tiefe, allumfassende Wandlungsprozeß, in welchem „ein Volk zu einem neuen, anderen Volk wird und in einer gewandelten Lebensform wiederaufersteht“, von dem Johannes R. Becher auf dem Ersten Bundeskongreß des Kulturbundes im Mai 1947 sprach!”, hatte in der Ostzone ein erstes, ergebnisreiches Stadium durchlaufen. In Schulen, Hochschulen, Kunsteinrichtungen, anderen Bilaungsund auch Forschungsstätten wie in der Kulturarbeit demokratischer Parteien, Massenund Kulturorganisationen dominierten meist schon die bewußt antifaschistisch-demokratischen Kräfte oder besaßen diese zumindest einen nicht mehr so ohne weiteres aufzuhebenden Einfluß. Im Alltagsleben und in der Alltagskultur der Werktätigen hingegen schlugen sich kulturrevolutionäre Errungenschaften zunächst nur eingeschränkt nieder. Hier herrschte „eine kalte, brutale Wirklichkeit“, so Paul Wandel auf dem II. Parteitag der SED, die die Verantwortung tragenden Antifaschisten in erster Linie vor die Aufgabe stellte, „Millionen Menschen in Deutschland vor Hunger, Not und Tod zu retten“.
Diese Wirklichkeit, in der Hoffnungslosigkeit und Verzweiflung erneut um sich griffen, prägte die sozialkulturelle Situation während des Jahres 1947 in zugespitzter Form. Und trotzdem bildeten sich im Bemühen um Linderung der Not, um Wiederaufbau und um kulturelle Erneuerung bei den aktiv beteiligten Bevölkerungsgruppen neue gesellschaftliche und subjektive Wertmaßstäbe und Lebenshaltungen heraus, die den pessimistischen Stimmungen entgegenwirkten, zugleich aber auch von perspektivischer Bedeutung waren. Solidarität und Kollektivität, kämpferischer Humanismus, gesellschaftliches Verantwortungsbewußtsein, Ehrfurcht vor dem Leben und Liebe zum Frieden gehörten dazu.
Mit dem Beginn des kalten Krieges erwuchsen für die antifaschistische Erneuerung der deutschen Kultur große Gefahren, zumal in den Westzonen das Streben nach Wiedererrichtung eines monopolkapitalistischen deutschen Staates mit einer zunehmenden Verdrängung der faschistischen Vergangenheit als Thema der öffentlichen Auseinandersetzung gekoppelt wurde. Die Konsequenzen dessen zeigten sich in der westalliierten Kulturpolitik ebenso wie in kulturpolitischen Aktivitäten westzonaler Gremien und Verwaltungen. Antifaschistische und demokratische Entwicklungen wurden immer stärker behindert und abgewürgt.
Die SED und ihre Bündnispartner beantworteten die Politik des kalten Krieges und der Spaltung Deutschlands auch kulturpolitisch mit der Fortführung der antifaschistisch-demokratischen Umwälzung. Eine Kulturkonferenz der SED im Januar 1947 drängte, den Fragen des revolutionären Marxismus bzw. des wissenschaftlichen Sozialismus in ihrer aktuellen und perspektivischen Relevanz größere Aufmerksamkeit zu schenken, und orientierte darauf, in die vor allem von Intellektuellen geführte Diskussion um die Freiheit der Persönlichkeit auch Standpunkte des dialektischen und historischen Materialismus einzubringen. Sie formulierte aber auch ein Bekenntnis zur Toleranz gegenüber religiösen Überzeugungen.
In der Bildungs- und Kulturarbeit wurde ein Aufschwung angestrebt und eingeleitet. Im Präsidialrat des Kulturbundes und im Berliner Rundfunk fanden Streitgespräche zu den großen Fragen der Zeit statt, an denen sich Kulturschaffende unterschiedlicher weltanschaulicher Standpunkte beteiligten, so Anfang 1947 zwischen Alexander Abusch, Günther Birkenfeld und Jürgen Kuczynski über die Erneuerung des deutschen Geschichtsbildes oder zwischen Alexander Abusch, Ferdinand Friedensburg, Klaus Gysi, Alfred Meusel, Ernst Niekisch, Josef Naas, Otto Dilschneider und anderen zur Frage: Gibt es eine besondere deutsche Krise? Letzteres drehte sich im Kern wieder um die gesellschaftlichen und geschichtlichen Wurzeln des deutschen Faschismus, da beispielsweise Friedensburg besondere Charakterschwächen des deutschen Volkes für die „nationalsozialistische Verirrung“ verantwortlich machte, daneben aber den Einbruch der Maschine und der Technik als die Ursache der Krise des neuzeitlichen Menschen bezeichnete, ohne die Relevanz der Frage nach der gesellschaftlichen Nutzung der Technik durch unterschiedliche Klassenkräfte zu beachten.
Kinoreklame des sowjetischen Filmvertriebs in Leipzig, 1947
Um „im Geiste echter Humanität und wahrer sozialer Gesinnung“ in allen Kreisen des Volkes „das Verständnis für Kunst und Kultur sowie für den Zusammenhang des Kulturschaffens mit dem gesellschaftlichen und geistigen Leben der Zeit zu wecken“1”, gründeten im Mai 1947 fortschrittliche Künstler und Kulturfunktionäre den Bund Deutscher Volksbühnen, der nicht nur eine Besucherorganisation sein sollte, sondern Kulturarbeit im weitesten Sinne — Diskussionen, Bildungskurse, Volkstanz, Chor, Laienspiel und anderes eingeschlossen — zu leisten beabsichtigte. Seine Bestrebungen gingen mit den Kulturbeschlüssen des II. FDGB-Kongresses vom April 1947 konform, die insbesondere die ideologische Funktion künftiger Kulturarbeit hervorgehoben hatten.
Der 1. Bundeskongreß des Kulturbundes zur demokratischen Erneuerung Deutschlands im Mai 1947 erarbeitete weitere Grundlagen für das überparteiliche, antifaschistische Zusammenwirken fortschrittlicher und humanistischer Kulturschaffender und wandte sich voller Sorge gegen das restriktive Vorgehen gegenüber dem kämpferischen Antifaschismus in den Westzonen. Er legte ein klares, von breiten Kreisen der Intellektuellen unterstütztes Bekenntnis zur Arbeit für den Frieden ab. Der Kulturbund zählte zu diesem Zeitpunkt 93000 Mitglieder. Johannes R. Becher lenkte in seiner Rede zum Thema „Unsere Ziele unser Weg“ die Aufmerksamkeit auf den „Gewinn der Niederlage“ und forderte den radikalen Bruch mit der reaktionären deutschen Vergangenheit. Auch er erörterte die Notwendigkeit eines neuen Geschichtsbildes, in welchem die progressiven Traditionen des deutschen Volkes, die Bauernbewegungen, die deutsche Klassik, die Achtundvierziger Revolution und die Arbeiterbewegung einen ersten Platz einnehmen sollten. Zugleich machte er geltend, „daß aus der Namenlosigkeit einer noch nicht geschriebenen deutschen Volksund Kulturgeschichte noch unzählige Namen und Taten emporsteigen werden“, die diese Traditionen ergänzen.!0® Von den Angehörigen der Intelligenz erwartete Becher die Begründung eines neuen Humanismus. Nachdrücklich forderte er sie auf, sich gegen die zunehmende „Rußlandhetze“ zu verwahren und das Verhältnis zur Sowjetunion grundsätzlich neu zu gestalten.
In der sowjetischen Besatzungszone vermittelten neben Filmen aus der UdSSR in besonderem Maße sowjetische Theaterstücke Begegnungen mit konkreten Problemen der sowjetischen Gesellschaft und mit Werken sozialistisch-humanistischer Dramatiker. Es gab hier nahezu ein halbes Hundert deutsche Erstaufführungen sowjetischer Stücke, die Zehntausende von Zuschauern veranlaßten, über ihr Bild vom ersten sozialistischen Staat der Welt nachzudenken. Zu den erregendsten Theaterereignissen des Jahres 1947 zählte die von Gustaf Gründgens am Deutschen Theater inszenierte Aufführung des Stückes „Der Schatten“ von Jewgeni Schwarz, dessen humanistische Botschaft, „daß ein Schatten höchstens vorübergehend siegen kann“ und die Welt „auf uns, den lebendigen, tätigen Menschen“ beruhe, Optimismus und Handlungsbereitschaft zu wecken suchte.
Der kalte Krieg drohte die ernsthafte und gründliche Auseinandersetzung des deutschen Volkes mit der faschistischen Vergangenheit zunehmend zu blockieren. Wichtige Gegenkräfte wurden unter anderem dadurch mobilisiert, daß die Verlage in der Ostzone verantwortungsbewußt und engagiert eine wachsende Zahl literarischer Zeugnisse des Widerstandes gegen Faschismus, Rassendiskriminierung und Krieg publizierten, darunter nicht wenige von bleibender Bedeutung. So erschienen allein im Aufbau-Verlag, der seit 1947 von Erich Wendt geleitet wurde, „Jeder stirbt für sich allein“ von Hans Fallada, „Grüne Oliven und nackte Berge“ von Eduard Claudius, „Die Moorsoldaten“ von Wolfgang Langhoff, „Der Totenwald“ von Ernst Wiechert, „Adel im Untergang“ von Ludwig Renn, „Ein Zeitalter wird besichtigt“ von Heinrich Mann, „LTI Notizbuch eines Philologen“ von Victor Klemperer. Das Buch „Wie der Stahl gehärtet wurde“ von Nikolai Ostrowski kam im Verlag Neues Leben heraus. Von den grundlegenden Werken des Marxismus-Leninismus erschienen in den ersten beiden Nachkriegsjahren schon etwa 6 Millionen Exemplare. Der Dietz Verlag publizierte 1947 den ersten Band des „Kapitals“ von Karl Marx.
Titelblatt des Romans „Das siebte Kreuz“ von Anna Seghers, herausgegeben als Rowohlt-Zeitungsroman Ende 1946
Die DEFA setzte 1947 mit „Ehe im Schatten“ unter der Regie von Kurt Maetzig ihre großen Nachkriegserfolge fort. Der Film erinnert an den Schauspieler Joachim Gottschalk und seine jüdische Frau, die die Faschisten 1941 in den Tod getrieben hatten. In den Westzonen kam Helmut Käutners Film „In jenen Tagen“ zur Uraufführung.
Engagierte antifaschistische Künstler unterstützten die Aktivitäten der politisch Verantwortlichen in allen geistig-kulturellen Bereichen. Die meisten zurückkehrenden Emigranten ließen sich in der Ostzone nieder, andere blieben — wie Lion Feuchtwanger, Albert Einstein, Oskar Maria Graf, Walter Gropius, Erich-Maria Remarque, Mies van der Rohe, Marlene Dietrich — für immer in ihren Exilländern, weil sie sich dort ihren Lebensund Wirkungskreis aufgebaut hatten bzw. weil ihnen Nachkriegsdeutschland fremd war. Thomas Mann zog die Schweiz als Wohnsitz vor, und auch Bertolt Brecht ging zunächst nach Zürich, siedelte dann aber 1948 in die Ostzone über, wo sich bereits viele Kulturschaffende von Rang wiedereingefunden hatten. 1947 kehrten Ludwig Renn und Anna Seghers aus dem mexikanischen Exil zurück, während Alexander Abusch schon Mitte 1946 von dorther nach Berlin gekommen war.
Mit Beginn des Jahres 1947 mehrten sich in den Westzonen Entscheidungen der Militärregierungen, auf Grund derer Antifaschisten und Verfolgte des Naziregimes, insbesondere Kommunisten, ausden Medien und anderen Öffentlichen Einrichtungen verdrängt wurden. Ihre politische Überzeugung führte viele der Betroffenen alsbald oder später in die sowjetische Besatzungszone — so Max Burghardt, Eduard Claudius, Karl-Georg Egel, Stefan Hermlin, Hans Mayer, Karl-Eduard von Schnitzler und andere. Selbst das Reeducationprogramm der westlichen Siegermächte erfuhr nach und nach seine Zurücknahme, weil es mit der Herausbildung eines antifaschistischen auch die -— so mußte man befürchten eines antiimperialistischen Traditionsstranges in kulturellen Bereichen begünstigt hätte. Auf vielfältige Weise suchten die westalliierten Militärregierungen außerdem die Rückkehr antifaschistischer deutscher Kulturschaffender zu behindern, deren Wiedereinbürgerung hinauszuzögern, da ihnen ein Anwachsen des geistigen Potentials der antifaschistischen Bewegung nicht paßte.
Der kalte Krieg beeinflußte auch die kulturpolitische Standortbestimmung westzonaler Parteien und führte beispielsweise innerhalb der Sozialdemokratie zu einem prononcierteren Abrücken vom Marxismus. So begründete eine auf deren Ziegenhainer Kulturkonferenz im August 1947 angenommene EntschlieBung das Eintreten der SPD für Demokratie und Sozialismus ausschließlich aus ethisch-humanistischen Beweggründen, lehnte aber die materialistische Weltanschauung als angeblich einseitig ökonomische Betrachtungsweise ebenso ab wie die Anerkennung von Gesetzmäßigkeiten in der Geschichte, als deren eigentliche Triebkraft der menschliche Wille bezeichnet wurde.
Immer stärker machten sich zwei unterschiedliche Wege in der Entwicklung der deutschen Kultur bemerkbar, die in Presse und Rundfunk sowie in Bereichen der Kunst und der Kunstvermittlung schon besonders deutlich hervortraten. Die Auseinandersetzung mit der faschistischen Kunstpolitik und deren Ergebnissen geriet in den Westzonen allmählich zu einer einseitigen Förderung „reiner“ Kunst oder der von den Nazis unterdrückten abstrakten Kunst, während die Leistungen der bewußt antifaschistischen realistischen Künstler immer öfter totgeschwiegen oder verkleinert wurden. Nur wenige westliche Verlage druckten Bücher wie „Das siebte Kreuz“ von Anna Seghers, allen voran der demokratische Verleger Ernst Rowohlt, der engagiert Weltliteratur für breite Massen produzierte. 1947 erschienen erstmals seine extrem billigen Rotationsdruckromane in Auflagenhöhen von 100000 Exemplaren.
Die in allen kapitalistischen Hauptländern anzutreffende Favorisierung extrem subjektivistischer Gestaltungsweisen spielte im Prozeß der Restauration der kulturellen Herrschaft der deutschen Bourgeoisie keine geringe Rolle. Die junge antifaschistische Kunstpolitik in der Ostzone wurde auf diese Weise frühzeitig mit sehr komplizierten internationalen Kunstprozessen konfrontiert, denen sie sich stellen mußte, obwohl der theoretische und empirische Vorrat an marxistischen kunstwissenschaftlichen Einsichten und Erkenntnissen über Bedeutung und Funktion spätbürgerlicher Kunst noch gering und unvollkommen war. Nicht wenige sozialistische Kulturfunktionäre waren unter diesen Umständen bereit, spielerischen Umgang und Experimentieren mit Formen und Farben pauschal und kurzsichtig als lebensfremden, letztlich reaktionären Formalismus abzulehnen.
In der literarischen Szenerie der Westzonen war die Neigung zur „reinen“ Kunst, zur Zeitflucht und zu einer unverbindlichen Innerlichkeit nicht zu übersehen. Das Übergewicht besaßen dort Autoren der sogenannten „inneren Emigration“, von denen nur wenige Positionen eines kämpferischen Antifaschismus eingenommen hatten.
Indes erschien 1947 auch Thomas Manns Roman „Doktor Faustus. Das Leben des deutschen Tonsetzers Adrian Leverkühn, erzählt von einem Freunde als erste bürgerlich-humanistische Auseinandersetzung mit Nationalsozialismus und spätbürgerlicher Gesellschaft auf literarischem Gebiet. Zu den antifaschistischen Autoren, die in dieser Zeit in den Westzonen wirkten, gehörten Erich Kästner, der 1933 der Verbrennung seiner Bücher auf dem Opernplatz in Berlin unerkannt beigewohnt hatte, Elisabeth Langgässer, deren Buch „Das unauslöschliche Siegel“ nach dem Kriege trotz seiner ahistorischen Faschismussicht viele Leser beeindruckte, Luise Rinser und andere. Literaten der jüngeren Generation suchten sich — unter dem Eindruck des eigenen Erlebens — der geistigen Auseinandersetzung mit Faschismus und Krieg zu stellen und angesichts des wieder in seine Machtpositionen zurückdrängenden deutschen Monopolkapitals ihre Besorgnis zu artikulieren. So hatte 1947 einen Tag vor dem Tode seines jungen Autors Wolfgang Borchert — das Heimkehrerstück „Draußen vor der Tür“ Premiere, das den „unversöhnlichen Konflikt zwischen dem Antifaschismus der Heimkehrerfigur und dem fortschrittsfeindlichen Charakter der Umwelt“ in den westlichen Landesteilen zum Ausdruck brachte.
Kontroverse Diskussionen entwickelten sich um das Nachkriegserfolgsstück der Westzonen, Carl Zuckmayers „Des Teufels General“, das — wenn auch von seiten des Autors antifaschistisch gemeint — durch die Art und Weise vieler Aufführungen weniger dazu angetan war, die Männer des 20. Juli zu würdigen, als reaktionäre Kreise der Wehrmacht wieder salonfähig zu machen.
Einige wenige wirklich demokratische Aktivitäten gab es im Theaterbereich jedoch auch. So konnten im Sommer 1947 6.000 Arbeiter und Angestellte in Recklinghausen mehrere Aufführungen der Hamburger Theater erleben, die diese als Dank für im Winter 1946/47 organisierte Kohlelieferungen der Bergarbeiter eigens für diese veranstalteten. Sie begründeten die Tradition der Ruhrfestspiele.
Im Jahre 1947 gründeten junge Literaten um Hans Werner Richter — nicht zuletzt motiviert durch das zeitweilige Verbot der von Richter und Alfred Andersch herausgegebenen linksdemokratischen Zeitschrift „Der Ruf“ seitens der amerikanischen Militärregierung — die Gruppe 47. Im Gegensatz zu den vielen, die eher auf Flucht vor der Gegenwart orientierten, wollten sie sich mit Krieg, Nachkrieg und den Zeitproblemen realistisch auseinandersetzen. Die politische Ausstrahlungskraft der Gruppe blieb begrenzt; es fanden aber nicht wenige junge Autoren in diesem Forum ein kritisches und förderndes Publikum, die später zu führenden humanistischen und demokratischen Schriftstellern der BRD werden sollten.
Die Abkehr der westlichen Siegermächte von einer gemeinsamen Politik der Anti-Hitler-Koalition sowie das Auseinanderdriften der kulturellen Entwicklungen in der Ostzone und in den Westzonen ließen bei humanistischen und antifaschistischen deutschen Schriftstellern den Wunsch nach einem deutschen Schriftstellerkongreß aufkommen, der die Literatur für die weitere antifaschistisch-demokratische Erneuerung der deutschen Geisteskultur in allen Teilen des Landes mobilisieren und zugleich die Weltöffentlichkeit auf die neuen Gefahren für Frieden und Demokratie aufmerksam machen sollte. Dieser I. Deutsche Schriftstellerkongreß, der vom Schutzverband Deutscher Autoren einberufen wurde, tagte vom 5. bis 8. Oktober 1947 in Berlin. Er stand unter der Schirmherrschaft aller Besatzungsmächte, doch nahm die SMAD an seiner inhaltlichen Konzipierung als Kongreß des Friedens besonders großen Anteil. Mehr als 300 Schriftsteller aus allen vier Besatzungszonen fanden sich ein, daneben Gäste aus der Tschechoslowakei, aus England, Jugoslawien, der Sowjetunion und den USA. Anwesend war auch der Generalsekretär des PEN-Clubs, Herman Ould.
Eröffnet wurde dieses erste und einzige deutsche Schriftstellertreffen der Nachkriegszeit durch eine feierliche Ansprache seiner greisen Ehrenpräsidentin, der mutigen bürgerlich-humanistischen Antifaschistin Ricarda Huch, sowie durch einen Vortrag von Günther Weisenborn, der als Mann des Widerstandes in aller Dringlichkeit seine ablehnende Haltung gegenüber einem weltabgewandten Ästhetizismus formulierte und von der Verantwortung der Schriftsteller in den Kämpfen der Zeit sprach.
Diese Fragen erhielten auf der Konferenz ein groBes Gewicht, nicht zuletzt durch ihre unterschiedliche Beantwortung in den Einleitungsreferaten von Alfred Kantorowicz und Elisabeth Langgässer. Beide Redner bezogen eindeutig antifaschistische Positionen, doch während Kantorowicz sich in seinem Vortrag „Über die deutschen Schriftsteller im Exil“ für ein politisches Engagement der Literatur in der Gegenwart aussprach, empfahl Elisabeth Langgässer, Auskunft gebend „Über Schriftsteller unter der Hitlerdiktatur“, nach den Jahren der Schändung und des Mißbrauchs der Sprache durch die Faschisten „eine Zeit der Ruhe und des Schweigens“ eintreten zu lassen.!!! Vertreter der demokratischen und sozialistischen deutschen Literatur, wie Johannes R. Becher, Anna Seghers, Willi Bredel, Erich Weinert, Friedrich Wolf, Günther Weisenborn, Stefan Hermlin und andere, plädierten eindringlich für politisch engagierte Werke und für die Teilnahme der Schriftsteller an den Kämpfen für Frieden und demokratische Erneuerung. Sie wandten sich gegen falsche Innerlichkeit und abstrakte Freiheitsbegriffe, wie sie insbesondere Rudolf Hagelstange verwendethatte, und bekannten sich zur Verantwortung der Schriftsteller gegenüber dem Volk. Das provokante Auftreten des amerikanischen Publizisten Melvin Lasky in diesem Kreis machte sichtbar, mit welcher Direktheit antikommunistische Kräfte versuchten, eine politische Einigung der deutschen Schriftsteller zu verhindern, indem sie die Gesellschaft der USA als Inbegriff von Freiheit und Demokratie hinstellten, offen zum ideologischen Angriff gegen die Sowjetunion bliesen und zugleich Nonkonformismus und oppositionelle Haltung als dem Künstler wesenseigen deklarierten.
Indes konnte die Mehrheit der Anwesenden für das Konzept einer politisch engagierten Literatur gewonnen werden, zumal Walentin Katajew die Attacken gegen sein Land in einer scharfen Replik zurückgewiesen hatte. Auch Elisabeth Langgässer hoffte, den „politischen Aktivisten“ ein Kamerad zu sein. Der Kongreß nahm ein Manifest an, das auf gemeinsame Ziele und Aufgaben antifaschistischer deutscher Schriftsteller orientierte: „Inmitten des Trümmerfeldes von Berlin erkennen wir deutschen Schriftsteller, daß unser Volk nur im dauerhaften und aufrichtigen Frieden mit den anderen Völkern der Erde gesunden kann. Wir wissen, daß ein neuer Krieg den völligen Untergang unseres Landes nach sich ziehen würde. Wir deutschen Schriftsteller geloben, mit unserem Wort und unserer Person für den Frieden zu wirken — für den Frieden in unserem Lande und für den Frieden der Welt.
Der kalte Krieg indes zerstörte viele dieser Möglichkeiten. Am letzten Tag des Kongresses verbot die amerikanische Militärregierung in ihrem Sektor Berlins den Kulturbund. Nicht lange darauf folgte ihr die britische Militärregierung mit einem entsprechenden Verbot. Es zeichnete sich ab, daß kulturelle Faktoren in der künftigen internationalen Klassenauseinandersetzung zunehmendes Gewicht erlangen würden.
Erster Deutscher Schriftstellerkongreß, 4. bis 8. Oktober 1947. Die Präsidentin des Kongresses, Ricarda Huch, mit den sowjetischen Gästen W. M. Wischnewski, B. L. Gorbatow und W. P. Katajew (.I.n.r.)
Allseitige Stärkung und Ausbau der Ostzone als Bastion des Kampfes um die demokratische Einheit Deutschlands und um Friedenssicherung. Restaurative Neuordnung und Bildung des Westzonenstaates. Die Errichtung der Deutschen Demokratischen Republik (Frühjahr 1948 bis Oktober 1949)
Die Verschärfung der Auseinandersetzung in und um Deutschland. Der Ausbau der Beziehungen der Ostzone zur Sowjetunion und zum entstehenden sozialistischen Weltsystem
Inhaltsverzeichnis [verstecken]
- 1 Die Verschärfung der Auseinandersetzung in und um Deutschland. Der Ausbau der Beziehungen der Ostzone zur Sowjetunion und zum entstehenden sozialistischen Weltsystem
- 1.1 „Londoner Empfehlungen“, „Frankfurter Direktiven“ und die Veränderung der Lage in und um Deutschland
- 1.2 Das Aktionsprogramm der Warschauer Außenministerkonferenz zur deutschen Frage
- 1.3 Die grundlegend veränderte Lage und die komplizierte Entscheidungssituation Mitte 1948
- 1.4 Die Gründung der DBD und der NDPD
- 1.5 Die Intelligenz vor neuen gesellschaftlichen Aufgaben und Entwicklungsproblemen
- 1.6 Die separate Währungsreform und die Berliner Krise
- 1.7 Die demokratische Währungsreform in der Ostzone
- 1.8 Die weltpolitischen Konstellationen und die Herausbildung des sozialistischen Weltsystems
„Londoner Empfehlungen“, „Frankfurter Direktiven“ und die Veränderung der Lage in und um Deutschland
Als Ergebnis der Londoner Separatkonferenz der Westmächte und der Beneluxstaaten wurden am 2.Juni 1948 die sogenannten „Londoner Empfehlungen“ bekanntgegeben. Diese bestätigten die Einbeziehung der Westzonen in den Marshallplan und verkündeten die Absicht, eine Internationale Ruhrbehörde der an der Konferenz beteiligten sechs Mächte bei Nichteinbeziehung der Sowjetunion zu errichten und ein Besatzungsstatut für die Westzonen zu erlassen. Zugleich kündigten sie an, „daß das deutsche Volk jetzt in den verschiedenen Ländern die Freiheit erhalten soll, für sich die politischen Organisationen und Institutionen zu errichten, die es ihm ermöglichen werden, eine regierungsmäßige Verantwortung soweit zu übernehmen, wie es mit den Mindesterfordernissen der Besetzung und der Kontrolle vereinbar ist, und die es ihm schließlich auch ermöglichen werden, die volle Verantwortung zu übernehmen“.¹ In verbrämter Form hieß dies, daß die Westmächte die militärische Besetzung der Westzonen unbefristet fortzusetzen gedachten und daß sie die westzonalen Politiker und Ministerpräsidenten aufforderten, einen unter Oberherrschaft der Westmächte stehenden westzonalen Staat zu bilden. Zu diesem Zweck, so hieß es weiter in den „Empfehlungen“, sollten „die Militärgouverneure eine gemeinsame Sitzung mit den Ministerpräsidenten der Westzonen Deutschlands abhalten“, um ihnen Vollmachten zu erteilen, „eine verfassunggebende Versammlung zur Ausarbeitung einer Verfassung einzuberufen …“.² Für den zu bildenden Staat wurde eine „föderative Regierungsform“ vorgeschrieben.
Das Präsidium des Deutschen Volksrates in Berlin verurteilte in einer am 7. Juni 1948 angenommenen Entschließung die „Londoner Empfehlungen“ für die „Bildung eines westdeutschen Separatstaates“³ als groben Bruch internationaler Verträge und als gravierenden Schritt zur Zerreißung Deutschlands. Zugleich wies das Präsidium darauf hin, daß die „Empfehlungen“ noch keine Wirklichkeit seien, und rief es das deutsche Volk auf, die Zerreißung Deutschlands nicht hinzunehmen, sondern einen entschlossenen Kampf gegen die Schaffung des westzonalen Separatstaates, für eine ungeteilte, demokratische deutsche Republik zu führen.
Die KPD war die einzige Partei in den Westzonen, die die „Londoner Empfehlungen“ grundsätzlich kritisierte und ablehnte. Sie stellte ihnen ein an den nationalen Interessen des deutschen Volkes ausgerichtetes Konzept entgegen, indem sie die Forderung nach einem Volksentscheid für die demokratische Einheit Deutschlands, die Bildung einer gesamtdeutschen Regierung, den Abschluß eines Friedensvertrages und den Abzug der Besatzungstruppen erhob.
Zum Ärger der Militärgouverneure der Westmächte reagierten CDU/CSU und SPD zunächst mit Kritik an bestimmten Aspekten oder Bestimmungen der „Londoner Empfehlungen“. Konrad Adenauer, der im Grunde nichts sehnlicher wünschte, als den Westzonenstaat so schnell als möglich zu errichten, wandte sich gegen die vorgesehene starken Einschränkungen der Entscheidungsbefugnisse der zukünftigen Regierung in Bezug auf die wirtschaftliche Entwicklung und suchte die Westmächte sogar mit einer Verweigerungsdrohung unter Druck zu setzen.
Der SPD-Vorstand artikulierte Einwände gegen das stark ausgebaute föderative Prinzip und gegen die dominierende Rolle, die den Ministerpräsidenten bei der Verfassungsvorbereitung zugewiesen wurde, sowie Bedenken, einen westdeutschen „Vollstaat“ mit einer Verfassung zu schaffen, da dies zu sehr nach endgültiger Teilung Deutschlands aussehe. Der SPD-Vorstand bekundete jedoch grundsätzliche Bereitschaft, an der Staatsbildung mitzuwirken.
Die Ministerpräsidenten der Länder der Westzonen während der Übergabe der „Frankfurter Dokumente“ durch die Militärgouverneure, 1. Juli 1948. V. r.n.l.: Leo Wohleb (Baden), Hans Ehard (Bayern), Wilhelm Kaisen (Bremen), Max Brauer (Hamburg), Christian Stock (Hessen), Karl Arnold (Nordrhein-Westfalen), Hinrich-Wilhelm Kopf (Niedersachsen), Reinhold Maier (Württemberg-Baden)
Die Militärgouverneure der USA, Frankreichs und Großbritanniens, die Generale Lucius D. Clay, Marie-Pierre Koenig und Brian H. Robertson (v. I. n. r.), nach der Übergabe der „Frankfurter Dokumente“
Am 1. Juli 1948 übergaben die drei Militärgouverneure im Frankfurter IG-Farben-Gebäude, dem Sitz von OMGUS, den westzonalen Ministerpräsidenten die „Frankfurter Dokumente“, mit denen die „Londoner Empfehlungen“ in Form von Direktiven übermittelt wurden. Die Ministerpräsidenten berieten darüber in Koblenz und versuchten mit ihren dort gefaßten Beschlüssen vom 10.Juli 1948 in einigen Punkten Modifizierungen der Direktiven zu erreichen, vor allem die Verantwortung für die Bildung des Westzonenstaates von sich weg und ausschließlich den Westmächten zuzuschieben. Dieses Motiv war eindeutig, wie der damalige Ministerpräsident von Württemberg-Baden, Reinhold Maier, rückblickend erkennen ließ: „Die Herren, mit denen ich damals zu tun hatte, sagen wir, Herr Kaisen aus Bremen, Herr Hinrich Wilhelm Kopf aus Hannover, Herr Arnold aus Düsseldorf – wir haben alle miteinander, als uns da am 1. Juli 1948 die Militärgouverneure das Dokument übergaben, wonach wir die Möglichkeit hatten, die Bundesrepublik zu begründen, wir haben alle miteinander, auch ich, wirkliche Manschetten davor gehabt, einen deutschen Beitrag zur Teilung Deutschlands zu leisten.“ 4
Doch die Westmächte wiesen die Koblenzer Stellungnahme brüsk zurück, nicht zuletzt, weil der US-Militärgouverneur, General Clay, befürchtete, daß Frankreich sie zum Anlaß für die Einberufung einer erneuten westalliierten Konferenz nehmen könnte.
Um die Ministerpräsidenten unter Druck zu setzen, beging OMGUS eine gezielte Indiskretion. Es ließ ihnen über den Chef der hessischen Staatskanzelei, Hermann Brill, die Mitteilung zukommen, daß der französische Militärgouverneur, General Koenig, erklärt habe, wenn die Westdeutschen nicht eindeutig bereit wären, „die Verantwortung für die Ausübung einer Regierungstätigkeit zu übernehmen“, dann „sollten die drei Oberbefehlshaber eine aus Deutschen bestehende Regierung ernennen, die dann unter der politischen Verantwortung der drei Besatzungsmächte arbeiten müsse“ – ohne deutsches Parlament.” Die westzonalen Ministerpräsidenten, die erkennen mußten, daß durch ihre Haltung die Schaffung des Westzonenstaates generell in Gefahr geriet, schwenkten auf ihrer folgenden Konferenz auf Schloß Niederwald bei Rüdesheim am 15. und 16. Juli 1948 nunmehr voll auf die westalliierten Direktiven ein, wenngleich von Seiten der SPD auch weiterhin der Provisoriumsgedanke betont wurde. Man einigte sich darauf, sich vom 10. bis 23. August 1948 auf der Insel Herrenchiemsee zu einem Verfassungskonvent zusammenzufinden.
Nach einer weiteren Zusammenkunft mit den Militärgouverneuren trafen sich die westzonalen Länderchefs am 21. und 22. Juli 1948 erneut auf Schloß Niederwald. Nur noch in zwei Punkten forderten sie jetzt Abänderungen an den alliierten Direktiven: Statt einer Verfassung sollte ein „Grundgesetz“ ausgearbeitet werden, und dieses sollte statt durch ein Referendum durch Abstimmung der Landtage Rechtskraft erlangen. In einer für die Militärgouverneure eigens zusammengestellten Argumentation wurden die politischen Gefährdungen beschworen, die mit einem Referendum verbunden sein würden. Man war sich keineswegs sicher, ob es gelingen würde, das Votum einer Mehrheit der westzonalen Bevölkerung für einen Westzonenstaat überhaupt bzw. für einen solchen, wie er zu entstehen im Begriff war, zu erhalten.
Am entschiedensten und hartnäckigsten für die schnelle Bildung des Westzonenstaates im Sinne eines deutschen „Kernstaats“ setzte sich der auf Schloß Niederwald als Berliner Oberbürgermeister auftretende Ernst Reuter (SPD) ein – nachdem sich die amtierende Oberbürgermeisterin Luise Schroeder (SPD) noch in Koblenz gegen den Westzonenstaat ausgesprochen hatte. Nunmehr signalisierten die Ministerpräsidenten, daß sie unter allen Umständen zu Verfassungsberatungen und zur Staatsgründung bereit seien.
Die Militärgouverneure registrierten das in der abschließenden Besprechung mit den Ministerpräsidenten am 26.Juli 1948 mit Genugtuung. Der die Zusammenkunft präsidierende General Koenig erklärte dazu abschließend: „Wenn Sie akzeptieren, die volle Verantwortung zu übernehmen, können wir Ihnen sagen: En avant!“ 6
Konkurrenzdemontage in den Westzonen. Sprengung von Fabrikanlagen in Watenstedt-Salzgitter
Doch die politische Situation war noch recht kompliziert und widersprüchlich. Einerseits war der von den Westmächten gewünschte und angestrebte antikommunistische und antisowjetische, monopolkapitalistische Westzonenstaat „westlichen Typs“ nicht ohne oder gar gegen das Gros der traditionellen deutschen „Eliten“ in Wirtschaft und Staat zu errichten. Sie sollten für seine Bildung aktiviert und zukünftig sogar für einen westdeutschen Beitrag zur westlichen Militärallianz gewonnen werden. Andererseits hatten die USA in Nürnberg noch zwölf Nachfolgeprozesse gegen Exponenten eben jener Kreise zu Ende zu führen. Nach der Verurteilung des Konzernherrn Friedrich Flick und dreier seiner Mitarbeiter zu Haftstrafen im Dezember 1947 erfolgte am 29. Juli 1948 die Verurteilung von 13 Verantwortlichen des IG-Farben-Konzerns und am 31. Juli 1948 die von Alfried Krupp von Bohlen und Halbach und elf seiner Mitarbeiter zu mehrjährigen Haftstrafen. In Bezug gesetzt zu dem erdrückenden Beweismaterial über die Schuld und die Verantwortung der Angeklagten für Nazi und Kriegsverbrechen fielen die Urteile skandalös milde aus. Dennoch war der Faktor der Verurteilung von politischer Bedeutung und Brisanz. Dies betraf auch die weiteren Nachfolgeprozesse. Im Oktober 1948 wurde das Urteil im Prozeß gegen das Oberkommando der Wehrmacht (OKW) gefällt. Und zur gleichen Zeit, als damit begonnen wurde, aus den Reihen der Mitarbeiter des ehemaligen Auswärtigen Amtes des Deutschen Reiches die Mannschaft für die Wahrnehmung der außenpolitischen Geschäfte des künftigen Westzonenstaates zu formieren, standen führende Mitarbeiter eben jenes Amtes im „Wilhelmstraßenprozeß“ vor einem US-Militärgericht. Ein Teil von ihnen wurde im April 1949 zu Freiheitsstrafen verurteilt. Weitere Prozesse, in deren Ergebnis auch Todesstrafen ausgesprochen wurden, richteten sich gegen eine Reihe militärischer Verantwortlicher, gegen faschistische Ärzte, Juristen und höhere SS-Führer. In der britischen und der französischen Zone – hier zum Beispiel gegen den Konzernherrn Hermann Röchling – fanden parallel dazu ebenfalls Nazi- und Kriegsverbrecherprozesse statt. Auch die Demontagen wurden gemäß den im Oktober 1947 bekannt gegebenen Listen – nicht selten auch aus Konkurrenzgründen – fortgesetzt.
Mitte 1948 hatten sich die internationalen Verhältnisse und die völkerrechtliche Situation in und um Deutschland, die Lage des deutschen Volkes wesentlich: verändert. Mit dem Ende des Alliierten Kontrollrates existierte das Dach der Viermächteverwaltung über den Besatzungszonen nicht mehr. Eine Vier-Mächte-Friedensregelung war nicht in Sicht, und die Chancen dafür schienen – wie es Mitte 1948 aussah – gering. Ein monopolkapitalistischer Westzonenstaat befand sich im Entstehen oder wurde vorbereitet.
Allerdings war dieser Staat noch längst nicht geschaffen, und es konnte keineswegs schon als sicher angesehen werden, daß die staatliche Aufspaltung des deutschen Volkes tatsächlich erreicht werden würde. Dennoch mußte den veränderten Bedingungen und Entwicklungsmöglichkeiten Rechnung getragen werden. Die KPD hatte aus der veränderten Situation bereits auf einer Delegiertenkonferenz am 27. April 1948 in Herne erste Schlußfolgerungen gezogen. Bei Festhalten an der Arbeitsgemeinschaft mit der SED beschloß sie die Bildung eines Parteivorstandes für die Westzonen. Vorsitzender wurde Max Reimann, der seit Kriegsende an der Spitze der KPD in der britischen Zone wirkte. Max Reimann, der der KPD schon kurz nach ihrer Gründung beigetreten war und seit 1920 als Bergarbeiter im Ruhrgebiet gearbeitet hatte, war von den Faschisten wegen seiner Widerstandsarbeit an der Ruhr 1939 verhaftet worden. 1945 hatte ihn die Rote Armee aus dem KZ Sachsenhausen befreit. Die KPD betonte, daß sie weiterhin für antiimperialistisch-demokratische Veränderungen in den Westzonen und für die demokratische Einheit Deutschlands und den Abschluß eines Friedensvertrages kämpfen werde.
Das Aktionsprogramm der Warschauer Außenministerkonferenz zur deutschen Frage
Da die Schaffung des Westzonenstaates die entscheidende Bedingung für die Realisierung der imperialistischen Pläne im globalen Maßstab war und die Verhinderung dieses Schrittes damit andererseits die Hauptvoraussetzung für das Zunichtemachen bzw. die Erschwerung dieser Politik darstellte, rückte die Deutschlandfrage Mitte 1948 eindeutig in den Vordergrund der weltpolitischen Auseinandersetzung. Am 23. und 24. Juni 1948 trafen sich auf Initiative der sowjetischen und der polnischen Regierung die Außenminister Albaniens, Bulgariens, Jugoslawiens, Polens, Rumäniens, der Tschechoslowakei, Ungarns und der UdSSR in Warschau. In der Erklärung der Warschauer Konferenz wurde die Londoner Separatkonferenz als offene Verletzung der bestehenden Deutschlandabkommen gebrandmarkt und auf die schwerwiegenden Folgen einer Realisierung der „Londoner Empfehlungen“ für die Gestaltung der internationalen Beziehungen, die Erhaltung des Friedens und die Entwicklung in Deutschland hingewiesen. Die Teilnehmer der Warschauer Konferenz erklärten, daß sie sich weigerten, „den Beschlüssen der Londoner Beratung Rechtskraft und irgendeine wie immer geartete moralische Autorität zuzuerkennen“.7 Sie schlugen demgegenüber vor:
1. die Durchführung von Maßnahmen zur endgültigen Entmilitarisierung Deutschlands entsprechend einer zwischen den vier Mächten zu treffenden Entscheidung;
2. die Errichtung einer befristeten Viermächtekontrolle über die Schwerindustrie des Ruhrgebietes, um die Wiederherstellung des deutschen Kriegspotentials zu verhindern und die Friedensindustrien der Ruhr zu entwickeln;
3. die Bildung einer provisorischen demokratischen und friedliebenden gesamtdeutschen Regierung aus Vertretern der demokratischen Parteien und Organisationen Deutschlands, die in der Lage ist, Garantien gegen die Wiederholung einer deutschen Aggression zu schaffen;
Europa 1948
Bild Seite 345
Die Warschauer Konferenz der Außenminister der UdSSR und der volksdemokratischen Staaten, Albaniens, Bulgariens, Jugoslawiens, Polens, Rumäniens, der Tschechoslowakei und Ungarns, 23. und 24. Juni 1948
4. den Abschluß eines Friedensvertrages mit Deutschland im Einklang mit den Potsdamer Beschlüssen und den Abzug aller Besatzungstruppen innerhalb eines Jahres nach Unterzeichnung des Friedensvertrages;
5. die Ausarbeitung eines Maßnahmeplans, der die Erfüllung der Reparationsverpflichtungen Deutschlands gegenüber den geschädigten Staaten sicherstellen sollte.
Damit entwickelte die Warschauer Konferenz ein Aktionsprogramm in der Deutschlandfrage, das die außenpolitische Aktivität der Sowjetunion und der an‚deren Staaten langfristig bestimmte und sich auf die Volkskongreßbewegung stützen konnte. Die Aussichten auf eine Verständigung mit den Westmächten über dieses Programm waren allerdings gering, denn für diese war eine Rückkehr zur Kooperation mit der Sowjetunion auf der Grundlage des Potsdamer Abkommens nicht mehr diskutabel, da das die Abkehr von ihren Westeuropa und Westblockplänen bedeutet hätte.
Die Westmächte ignorierten die Vorschläge der acht Staaten. Sie wurden ebenso wie die Erklärung des Präsidiums des Deutschen Volksrates in der Öffentlichkeit der Westzonen totgeschwiegen oder mit antikommunistischer Argumentation abgetan.
Angesichts der veränderten internationalen und nationalen Lage und gemäß den inneren Entwicklungszwängen der Ostzone mußten Entscheidungen darüber getroffen werden, wie es weitergehen sollte. Das Schicksal der Ostzone konnte auf keinen Fall von unbestimmten Entwicklungen in Westeuropa bzw. in den Westzonen und einem ungewissen Ausgang des Kampfes um die demokratische Einheit Deutschlands abhängig gemacht werden, die Ostzone nicht lediglich als in Wartestellung befindlicher Teil eines zu diesem Zeitpunkt nur als Kampfziel existierenden deutschen Staats- und Wirtschaftsverbandes behandelt werden.
Die Einteilung Deutschlands in Besatzungszonen war nicht unter dem Blickwinkel der Lebensfähigkeit dieser Zonen als autonome Gebilde erfolgt. Dieses Problem, das in der Ostzone vor allem im Fehlen der metallurgischen Basis und in der disproportionalen Wirtschaftsstruktur deutlich wurde, stellte sich jetzt mit voller Brisanz. Und es wurde noch verschärft durch die imperialistischen Embargomaßnahmen, die seit Frühjahr 1948 für den Handel mit der Sowjetunion, mit den volksdemokratischen Ländern und auch mit der sowjetischen Besatzungszone verhängt worden waren. Die Wirtschaft der Ostzone mußte zu einem lebensfähigen Organismus mit einer neuen Außenwirtschaftsstruktur umgebaut und planmäßig, bei Ausbau der volkseigenen Wirtschaft und unter Nutzung ihrer Vorzüge sowie aller anderen Ressourcen und Reserven dynamisch weiterentwickelt werden. Dies ergab sich gebieterisch aus dem nunmehr bestehenden Grad der Ost-West-Spaltung Deutschlands und aus den inneren Entwicklungsbedingungen der Ostzone. Aber auch deren Rolle als Vorkämpfer für demokratische Einheit, gerechten Frieden und sozialen Fortschritt gebot, der Bildung des Westzonenstaates eine lebens und entwicklungsfähige Bastion auf deutschem Boden entgegenzustellen. Hierin lag eine entscheidende Bedingung für die Fixierung der Ergebnisse des zweiten Weltkrieges in Europa und die Bewahrung des Friedens auf dem Kontinent. Es erhob sich die Frage, wann und wie dem Kurs auf den Westzonenstaat mit der Schaffung eines Ostzonenstaates begegnet werden müsse. Eine erste Antwort auf diese Frage gab der Parteivorstand der SED bereits im Mai 1948.
Die grundlegend veränderte Lage und die komplizierte Entscheidungssituation Mitte 1948
Auf seiner 10. (24.) Tagung, die am 12. und 13. Mai 1948 stattfand, unterzog der Parteivorstand der SED die grundlegend veränderte Lage einer gründlichen Analyse. Die Grundlage dafür gab Wilhelm Pieck mit seinem Referat „Die Verschärfung des Kampfes für die Einheit, Demokratie und einen gerechten Frieden“.8 Der Parteivorsitzende korrigierte gleich einleitend die Themenstellung und wies darauf hin, daß es „sich nicht nur um eine Verschärfung, sondern um eine strategische Änderung“ des Kampfes handelte, „die sich aus den Veränderungen in der politischen und staatlichen Situation in Deutschland ergibt“. Er stellte fest: „Deutschland wird durch die Bildung des Weststaates in zwei Teile zerrissen, von denen jeder sich nach eigenen Gesetzen entwickelt, die weit auseinanderstreben. Der Weststaat entwickelt sich nach den Gesetzen der kapitalistischen Bedingungen und befindet sich in völliger Abhängigkeit von den Westmächten …“ Wesentlich anders werde die Entwicklung in der Ostzone sein, die sich auf die Sowjetunion und die volksdemokratischen Länder orientiere. Es komme nunmehr darauf an, die Frage zu beantworten, welche Änderung sich für die Aufgabenstellung der SED ergeben werde, „wenn ein großer Teil Deutschlands vom Osten abgerissen“ wird und als Folge „ein selbständiges staatliches Gebilde im Umfange der jetzigen sowjetischen Besatzungszone entsteht. Das Leben und die Politik innerhalb dieses Staates wird nicht das gleiche sein wie bisher, sondern auf sich selbst gestellt, wird es seine Besonderheiten entwickeln.“ „Die SED als die Partei der Arbeiter, Bauern und fortschrittlichen Intelligenz wird zur führenden Kraft, die die volle Verantwortung für die Gestaltung der politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Lage übernimmt.“ Zugleich betonte Wilhelm Pieck, daß dies kein Ende der Zusammenarbeit mit anderen Parteien im Rahmen der Blockpolitik bedeuten werde, und kritisierte das immer noch vorhandene ungenügende Verständnis für die Blockpolitik. Als grundlegende Aufgabenstellung hob er hervor, „dafür zu sorgen, daß (sich – d. V.) nicht nur das wirtschaftliche Leben in der Richtung auf den Sozialismus entwickelt“. Dabei betonte er, die SED müsse gleichzeitig weiterhin „den Kampf um ganz Deutschland führen und dabei immer auf die Notwendigkeit der Entfaltung der Demokratie und der Verwirklichung des Sozialismus hinwirken.“ Die 10. (24.) Tagung des Parteivorstandes der SED gab damit den Auftakt und erste, grundlegende Orientierungen für die aus der veränderten Lage und aus den Entwicklungserfordernissen zu ziehenden Schlußfolgerungen.
Zur Entwicklungsperspektive der Ostzone waren somit Überlegungen und Festlegungen notwendig, wie sie bisher nicht ins Kalkül gezogen worden waren. Die eigenständige Weiterentwicklung der Ostzone sowie auch der erreichte Stand des Wirtschaftsaufbaus erforderten den Übergang zur längerfristigen Wirtschaftsplanung und stellten gebieterisch die Zentralisierung bzw. den zentralstaatlichen Ausbau auf die Tagesordnung, wie er mit der Umbildung der DWK und deren Ausstattung mit Verordnungsbefugnissen in Angriff genommen worden war. Auf eine weitergehende Zentralisierung im Rahmen der Ostzone, die bisher mit Blick auf die angestrebte Viermächteregelung der deutschen Frage bzw. die Herstellung der demokratischen Einheit Deutschlands zurückgestellt worden war, konnte nun nicht mehr verzichtet werden. In Verbindung damit mußte darüber Klarheit geschaffen, vor allem darüber entschieden werden, ob der Prozeß revolutionärer Umgestaltungen mit der Bewältigung der wesentlichen 1945 gestellten Aufgaben und der Schaffung einer antifaschistisch-demokratischen Ordnung abgeschlossen werden sollte – wozu die Mehrheit der sozialen und politischen Bündnispartner der Arbeiterklasse tendierte – oder weitergeführt werden mußte. Und wenn ja – wie? Für die SED galt es im Sinne ihrer „Grundsätze und Ziele“ und ihres theoretischen Verständnisses als sicher, daß in Richtung Sozialismus weitergeschritten werden mußte; denn die geschaffenen Verhältnisse trugen Übergangscharakter. Wurden sie nicht zum Ausgangspunkt für eine Entwicklung nach vorn genutzt, so mußten sie zwangsläufig zu einem solchen für die Restauration monopolkapitalistischer Verhältnisse werden. Doch die Frage des Weges zum Sozialismus nach erfolgter Lösung der wesentlichen Aufgaben der antifaschistisch-demokratischen Umgestaltung war nicht geklärt bzw. nicht zu Ende diskutiert worden, und es bestanden darüber auch in den Reihen der SED noch unterschiedliche Auffassungen. Das war um so mehr verständlich, als die Klärung der weiteren Perspektiven für die Ostzone bisher nicht gesondert erfolgt, sondern immer aufs engste mit der Herstellung der demokratischen Einheit Deutschlands verbunden worden war. Jetzt aber mußte geklärt werden, welche Bedingungen und Voraussetzungen für eine eigenständige Weiterentwicklung der Ostzone „nach vorn“ bestanden.
Die Arbeiterklasse der sowjetischen Besatzungszone hatte ihr Klassenbewußtsein erhöht und ihre Kampfkraft gestärkt und war als Hegemon der antifaschistisch-demokratischen Umwälzung gereift. Jeder fünfte Angehörige der Arbeiterklasse war Mitglied der SED. Die überwiegende Zahl der Arbeiter war im FDGB organisiert, wobei es zwischen dem Grad ihrer Organisiertheit in der volkseigenen Industrie und dem im privatkapitalistischen Sektor ein zum Teil beträchtliches Gefälle gab.
Es war jedoch auch nicht zu übersehen, daß die Arbeiterklasse der Ostzone in ihrer Gesamtheit ein in sich sehr differenziertes Bild bot. Neben den klassenbewußten, fortgeschrittenen Arbeitern gab es auch solche, die nicht organisiert waren und deren gesellschaftliches Bewußtsein nicht den Anforderungen der Zeit entsprach. Reformistisches Gedankengut war zum Teil noch weitverbreitet und wurde durch den intensiven ideologischen Klassenkampf, der insbesondere von Westberlin aus in die Ostzone hineingetragen wurde, täglich reaktiviert. Das gleiche galt für den Antisowjetismus.
Der auch in der Nachkriegszeit anhaltende Zustrom kleinbürgerlicher Elemente, vor allem aus Umsiedlerkreisen, von vorher nicht berufstätigen Frauen, die über keinerlei Klassenkampferfahrungen verfügten, sowie von ehemaligen Nazis trug dazu bei, die ideologische Anfälligkeit von Teilen der Arbeiterklasse gegenüber feindlichen Parolen, aber auch gegenüber der Resignation vor Schwierigkeiten und Erschwernissen, die mit dem revolutionären Prozeß und dem Aufbau aus eigener Kraft unter den Bedingungen des kalten Krieges verbunden waren, zu erhöhen. In der Arbeiterklasse der Ostzone gab es nicht nur Unsicherheiten über den weiteren Weg, sondern zum Teil auch beträchtliche politische Schwankungen. Sie hingen nicht zuletzt mit Unklarheiten über die Ursachen und das Wesen der gesellschaftlich-politischen Bipolarisierung auf deutschem Boden und über den gegensätzlichen Klasseninhalt der beiden deutlich auseinanderlaufenden Wege deutscher Nachkriegsentwicklung zusammen. Dennoch konnte die SED – und das war ausschlaggebend – davon ausgehen, daß sie sich auf eine zahlenmäßig starke, hochorganisierte und qualifizierte Arbeiterklasse stützen konnte, deren entscheidende Teile sich bereits als Hegemon des revolutionären Prozesses, in der Machtausübung und beim demokratischen Aufbau bewährt hatten und das Hauptpotential für dessen erfolgreiche Weiterführung verkörperten.
Die Bündnispartner der Arbeiterklasse befanden sich in einer zum Teil recht widersprüchlichen Situation. Bauern, Angehörige der bürgerlichen Intelligenz sowie des Kleinbürgertums und des Bürgertums waren nach der Befreiung vom Faschismus von Veränderungen in ihrer Umwelt und in ihrer Existenz erfaßt worden, die sie nicht weniger radikal und widersprüchlich erlebten als den Einschnitt des 8.Mai 1945. Das Sichzurechtfinden in dieser Situation, das Erkennen ihrer Lage und das Finden eines neuen politischen Standortes gemäß ihren sozialen und politischen Interessen war unter den in der Ostzone bestehenden Übergangsverhältnissen und unter den Einwirkungen der sich zuspitzenden Auseinandersetzungen zwischen den beiden Systemen in der Welt außerordentlich schwierig und kompliziert.
Das entscheidende Merkmal, das diese Klassen und Schichten in der Ostzone deutlich von denen in den Westzonen unterschied, bestand in den Erfahrungen, die sie im sozialen und politischen Bündnis mit der Arbeiterklasse gewonnen hatten, in ihrer Teilnahme an den antifaschistisch-demokratischen Umgestaltungen, in der von ihnen dabei übernommenen Mitverantwortung und in ihrer Teilhaberschaft an den Ergebnissen. Der dadurch bewirkte Klassenwandlungsprozeß war bereits weiter gehend und tiefer greifend, als es das Denken und das Bewußtsein der Bündnispartner der Arbeiterklasse reflektierten. Als besonders bedeutsam konnte eingeschätzt werden, daß sich rund 104000 Bauern, 115000 Handwerker und Gewerbetreibende, 60000 Vertreter der technischen Intelligenz, 30000 Ärzte, Juristen und Künstler und ebenso viele Lehrer als Mitglieder der SED direkt auf die Positionen der Arbeiterklasse gestellt hatten.
Ein Kennzeichen der antifaschistisch-demokratischen Verhältnisse Mitte 1948 war der erreichte hohe Grad der gesellschaftlich-politischen Organisiertheit der werktätigen Klassen und Schichten sowie – abgestuft davon – auch bürgerlicher Schichten. Neben den Vertretungskörperschaften und Volksausschüssen der Volkskongreßbewegung, den im Block zusammenarbeitenden Parteien und zum Teil auch schon Gewerkschaften existierte ein vielgestaltiges Netz von gesellschaftlichen Organisationen, wie FDJ, DFD, VdgB, Kulturbund, Volkssolidarität und andere. Breite Kreise der Bevölkerung wurden durch sie in die gesellschaftlich-politische Entwicklung einbezogen und zielgerichtet zu aufbauender und umgestaltender Aktion geführt und befähigt. Dieser Entwicklungsstand der politischen Organisation war es, der entscheidend die Stabilität der antifaschistisch-demokratischen Verhältnisse – auch und gerade unter den Bedingungen des kalten Krieges und zugespitzter Klassenauseinandersetzungen – gewährleistete. Diese Organisiertheit wirkte politischen Schwankungen entgegen oder fing sie ab. Über ihren Mechanismus gelang es, breite Massen mit unterschiedlichen Motivationen und differenziertem Bewußtsein zu geschichtlicher Aktion, zu fortschrittlicher Praxis zu führen und dadurch subjektive Wandlungsprozesse voranzutreiben.
In diesem System gesellschaftlich-politischer Organisation waren auch nicht wenige ehemalige Angehörige der NSDAP sowie ehemalige Berufssoldaten und Offiziere wirksam, die die notwendigen Sühnemaßnahmen auf sich genommen und sich mit meist körperlicher Arbeit auf dem Platz, auf den sie gestellt worden waren, beim demokratischen Neuaufbau bewährt hatten.
Insgesamt gab es entscheidende politisch-ideologische Grundlagen und Potentiale für die Festigung des sozialen und politischen Bündnisses bei der Weiterführung des revolutionären Prozesses und der allseitigen Durchsetzung der führenden Rolle der Arbeiterklasse. Doch zugleich wirkten dem nicht nur reaktionäre und konservative Kräfte entgegen, die zum Teil über einflußreiche Positionen in CDU und LDPD sowie in den Verwaltungen verfügten, sondern auch objektive, in den gesellschaftlichen Verhältnissen wurzelnde Tendenzen.
Nach der Lösung der wesentlichen antifaschistisch-demokratischen Aufgaben traten in der Ostzone die sozial bedingten Widersprüche zwischen der Arbeiterklasse bzw. ihrer Partei einerseits und den mit kapitalistischen Verhältnissen oder mit solchen der einfachen Warenproduktion verbundenen Klassen und Schichten bzw. ihren politischen Exponenten andererseits stärker hervor und spitzten sich zu. Neben der volkseigenen Wirtschaft gab es einen starken privatkapitalistischen Sektor. 36000 Privatbetriebe erbrachten ein Drittel der industriellen Bruttoproduktion. Der Großhandel lag fast gänzlich in Privathand. Gleiches galt für die Binnenschiffahrt und den Autotransport. In der Landwirtschaft bewirtschafteten 47000 Großbauern ein Viertel der landwirtschaftlichen Nutzfläche und erbrachten etwa ein Drittel der landwirtschaftlichen Bruttoproduktion. Der kapitalistische Wirtschaftssektor war allerdings der Kontrolle durch die antifaschistisch-demokratischen Machtorgane und in bestimmtem Maße auch einer Lenkung durch diese unterworfen. Die Ausbeutung war durch die Gesetzgebung und die betrieblichen Mitbestimmungsrechte der Belegschaften eingeschränkt.
Zum Sektor der kleinen Warenproduktion gehörten 300000 Handwerker und Gewerbetreibende, der größte Teil der Gaststätten und Einzelhandelsgeschäfte und etwa 730000 klein- und mittelbäuerliche Wirtschaften. Im Ergebnis der demokratischen Bodenreform bewirtschafteten klein- und mittelbäuerliche Betriebe 66 Prozent der landwirtschaftlichen Nutzfläche. Die wirtschaftliche Stabilisierung der meisten Neubauernhöfe hatte jedoch erst begonnen. Die antifaschistisch-demokratische Umgestaltung und Demokratisierung des Dorfes mußten fortgeführt werden, damit die werktätigen Bauern sich aus der ökonomischen Abhängigkeit von den Großbauern zu lösen vermochten und im Bündnis mit der Arbeiterklasse in allen Dörfern zur politisch dominierenden Kraft werden konnten.
Gesetzgebung und materielle Förderung der kleinen Warenproduzenten begrenzten zwar den sozialökonomischen Differenzierungsprozeß, hielten ihn aber nicht auf. Ein Teil der Bauernwirtschaften und Handwerksbetriebe entwickelten sich zu kapitalistischen Betrieben, andere blieben existenzgefährdet. Von dem umfangreichen privatkapitalistischen Sektor und auch von der einfachen Warenproduktion gingen erhebliche objektive Tendenzen zur Kräftigung des Kapitalismus und zur Ausdehnung kapitalistischer Verhältnisse aus – auch wenn sich die Besitzer der diese Sektoren bildenden Betriebe in der Mehrzahl loyal verhielten.
Unternehmer, Großbauern und Großhändler waren nach der Beseitigung der Monopole und des Großgrundbesitzes und im Zuge des demokratischen Wiederaufbaus erstarkt, suchten ihre wirtschaftlichen Positionen auszubauen und diese auch in politischen Einfluß umzumünzen. Ein Teil von ihnen lehnte die antifaschistisch-demokratischen Verhältnisse ab, sabotierte den wirtschaftlichen Aufstieg und verbrachte Vermögenswerte, Dokumentationen und auch Erzeugnisse und industrielle Anlagen illegal in die Westzonen oder nach Westberlin. Der privatkapitalistische Sektor und der Sektor der einfachen Warenproduktion waren in der Ostzone, wo keine lediglich an ökonomischen Kriterien ausgerichteten Nationalisierungsmaßnahmen durchgeführt worden waren, unvergleichlich größer als in den volksdemokratischen Ländern beim Übergang von der demokratischen zur sozialistischen Etappe des revolutionären Prozesses. Auch aus diesem Grunde konnten für das weitere Voranbringen dieses Prozesses in der Ostzone nicht einfach Methoden von dorther übertragen werden, sondern galt es, neue, den gegebenen Bedingungen gemäße Wege ausfindig zu machen. Die Tendenzen zur Restauration bzw. zum Ausbau des kapitalistischen Sektors mußten zurückgedrängt, Wirtschaftssabotage und Spekulationstätigkeit unterbunden werden. Darüber hinaus erhoben sich die Fragen, ob der kapitalistische Sektor systematisch eingeschränkt werden sollte und – wenn ja – ob über weitere Enteignungen oder durch wirtschaftspolitische Maßnahmen bzw. – wenn nicht – wie dann in der Praxis die notwendigen Restriktionen gegen das Vordringen des Kapitalismus und die Maßnahmen zur Unterbindung von Wirtschaftsschädigung von solchen zur systematischen Einschränkung zu trennen und von den Betroffenen zu unterscheiden waren.
Präsidium der ersten zentralen Konferenz der DBD in Schwerin, 16. und 17. Juli 1948. Am Rednerpult: der Vorsitzende der DBD, Ernst Goldenbaum
Die Gründung der DBD und der NDPD
Mitte 1948 waren Bedingungen herangereift, um Teilen der Bevölkerung der Ostzone, die bisher noch keine parteipolitische Bindung eingegangen waren bzw. hatten eingehen können, eine solche zu ermöglichen. SMAD und SED unterstützten deshalb die Initiative zur Bildung zweier neuer Parteien. Im Mai 1948 konstituierten sich die Demokratische Bauernpartei (DBD) und die Nationaldemokratische Partei Deutschlands (NDPD).
Die DBD, mit der erstmals die werktätige Bauernschaft über eine eigene Partei als politische Interessenvertretung verfügte, hob – zusammen mit den Errungenschaften der Bodenreform – die historische Bedeutung des Bündnisses von Arbeiterklasse und Bauernschaft hervor, das es zu erhalten und zu festigen gelte. In diesem Sinne bestimmte die DBD ihren Platz als Bündnispartner der SED auch bei der Weiterführung des revolutionären Prozesses, ohne allerdings bereits sozialistische Perspektivvorstellungen zu entwickeln und die Führungsrolle der Arbeiterklasse und ihrer marxistisch-leninistischen Partei direkt anzuerkennen. Ihr Vorsitzender wurde Ernst Goldenbaum. Im Jahre 1920 Mitglied der KPD geworden, hatte der ehemalige Landarbeiter als Redakteur und seit 1935 als Landwirt gearbeitet. Während der Zeit des Faschismus war er wiederholt wegen antifaschistischer Tätigkeit inhaftiert worden. Nach der Befreiung hatte er als Bürgermeister in Parchim, dann als Geschäftsführer der Landesbodenkommission in Mecklenburg-Vorpommern und seit 1946 als Landesvorsitzender der VdgB aktiv an der antifaschistisch-demokratischen Umwälzung teilgenommen.
Die NDPD entstand wie die DBD als kleinbürgerlich-demokratische Partei. Sie bekannte sich eindeutig zur Blockpolitik und zu den antifaschistisch-demokratischen Errungenschaften, ohne allerdings zu dieser Zeit bereits deren sozialistische Perspektive zu bejahen und von einer Führungsrolle der Arbeiterklasse auszugehen. Ihr Vorsitzender wurde Lothar Bolz, ein bewährter Antifaschist. Seit 1926 als Anwalt tätig, war er 1933 wegen der Verteidigung von Antifaschisten aus der Anwaltschaft ausgeschlossen worden und ins Exil nach Polen, später in die Sowjetunion gegangen. Hier hatte er als Chefredakteur des NKFD-Organs „Freies Deutschland“ gewirkt. 1947 war er nach Deutschland zurückgekehrt.
Lothar Bolz (rechts), Vincenz Müller (links) und Heinrich Homann (Mitte), die auf dem Ersten Parteitag der NDPD vom 23. bis 25. Juni 1948 in Halle als Vorsitzender, als Politischer Geschäftsführer und als Mitglied des Geschäftsführenden Hauptvorstandes gewählt wurden
In der NDPD organisierten sich vor allem Angehörige des Mittelstandes und Angestellte. Darunter gab es viele, denen es bisher nicht gestattet gewesen war, parteipolitisch aktiv zu werden, oder die sich von den Umtrieben reaktionärer Politiker in CDU und LDPD abgestoßen fühlten. Bei ersteren handelte es sich um solche ehemaligen nominellen NSDAP-Mitglieder und Offiziere, die sich keiner Verbrechen schuldig gemacht hatten und sich bei den antifaschistisch-demokratischen Umgestaltungen bewährt hatten.
Durch die Gründung von DBD und NDPD konnten somit ein beträchtlicher Teil’ bisher Abseitsstehender oder von politischer Mitwirkung Ausgeschlossener aktiviert und integriert, die politische Organisation ausgebaut und ihre Basis verbreitert werden. Bedeutsam war, daß sich DBD und NDPD uneingeschränkt auf den Boden der antifaschistisch-demokratischen Verhältnisse und der Blockzusammenarbeit und mit aller Kraft hinter die Ziele der Volkskongreßbewegung stellten, daß sie für die Freundschaft mit der Sowjetunion eintraten und somit in der weltpolitischen Auseinandersetzung eindeutig zugunsten des sozialistischen und Friedenslagers optierten.
Die Bildung der beiden Parteien trug dazu bei, die Blockkrise – seit Februar 1948 war der zentrale Blockausschuß nicht mehr zusammengetreten – zu überwinden. Entscheidend für die Weiterführung des Klassen- und Parteienbündnisses war vor allem das gemeinsam Erreichte und Geschaffene. Das Zusammenwirken der verschiedenen sozialen und politischen Kräfte mit der Arbeiterklasse und ihrer Partei hatte sich in einem solchen Maße bewährt, daß darauf bei der sozialen Konfliktbewältigung aufgebaut werden konnte. Darüber hinaus wirkten objektive Bedingungen und Zwänge in diese Richtung. Die Bündnispartner saßen – ob sie wollten oder nicht – „in einem Boot“. Die Umstände diktierten den gemeinsamen Kampf um die Einheit Deutschlands und um einen Friedensvertrag, aber auch die Weiterentwicklung der antifaschistisch-demokratischen Verhältnisse, und zwar – das begann sich abzuzeichnen – bis zur Staatwerdung, sowie die Annäherung an die Sowjetunion und das entstehende sozialistische Weltsystem. Auf alle in jenem „einen Boot“ befindlichen Kräfte wirkte so etwas wie ein Anpassungs- und Kooperationszwang angesichts der unwirschen See, der Stürme, denen es standzuhalten galt, und der Klippen, die unter größter Anspannung der Kräfte umschifft werden mußten. In diesem Sinne betrachtet, war die politische Praxis der Bündnispartner der Arbeiterklasse weiter fortgeschritten als die von ihnen bezogenen politischen Positionen bzw. als ihre Reflexionen. Und auch für die SED gingen von der praktizierten Bündnis- und Blockpolitik wichtige Impulse für die schöpferische Weiterentwicklung ihrer Politik aus.
Die Intelligenz vor neuen gesellschaftlichen Aufgaben und Entwicklungsproblemen
Bei der Eröffnung des Ersten Kulturtages der SED im Mai 1948 hob Wilhelm Pieck hervor, daß seine Partei in ihrer Bündnispolitik gegenüber der Intelligenz vor sehr ernsten Aufgaben stünde, die bislang noch keineswegs mit genügender Klarheit gesehen worden wären. Es gelte, die fortschrittlichen Intellektuellen „hereinzuziehen in den großen Kampf für die geistige Befreiung und in den Umbildungsprozeß, an dessen Ende das neue, demokratische und friedliche Deutschland stehen soll“.9
Schon im Februar 1948 hatte sich die 7. (21.) Tagung des Parteivorstandes der SED mit bündnispolitischen Fragen beschäftigt und eine Entschließung „Intellektuelle und Partei“ angenommen, die dem Bestreben verpflichtet war, Wissenschaftler, Techniker, Künstler und Kulturschaffende in noch größerem Umfang für die Mitarbeit am demokratischen Neuaufbau zu gewinnen und zwischen Arbeiterklasse und Intelligenz ein echtes Vertrauensverhältnis herzustellen.
Die Notwendigkeit, diese Aufgaben dezidiert anzugehen, ergab sich aus der veränderten politischen Lage und aus den steigenden Anforderungen, die die antifaschistisch-demokratische Umwälzung in ihrer neuen Etappe stellte. Wichtige Grundprozesse der antifaschistisch-demokratischen Erneuerung der deutschen Kultur waren unter Hegemonie bzw. starker Beteiligung der Arbeiterklasse gemeinsam mit Intellektuellen erfolgreich bewältigt oder auf den Weg gebracht worden. Angehörige der Intelligenz hatten bei der Seuchenbekämpfung wie bei der medizinischen Versorgung überhaupt, beim Wiederingangsetzen der Industrie und bei der Wiedereröffnung von Kunst- und Wissenschaftseinrichtungen Bedeutendes geleistet. Auch künftige Fortschritte im sozialen, wirtschaftlichen und kulturellen Leben konnten nur in engem Bündnis mit ihnen erzielt werden.
Die Intelligenz befand sich jedoch zu diesem Zeitpunkt – sieht man von einem kleinen Kreis sozialistischer und aktiver demokratischer Intellektueller sowie fortgeschrittener Gruppen der Neulehrer ab – weiterhin in einer äußerst widerspruchsvollen Phase ihrer politischen und sozialen Entwicklung. In ihrer Mehrheit war sie bürgerlichen Denk- und Lebenshaltungen verhaftet, ging sie von individualistisch-elitären Ansprüchen aus und beobachtete sie die revolutionären Umwälzungen in der Ostzone abwartend, oft mit Skepsis, nicht selten ablehnend. Konservative Professoren und Studenten der Jenenser Universität forderten ganz offen, der marxistisch-leninistischen Philosophie keinen Platz an den Hochschulen zu geben. In den Landtagen Sachsens und Thüringens machten reaktionäre Kräfte Front gegen die Benutzung der Schriften Franz Mehrings in Schulunterricht und Lehrerbildung. Vor allem schwer zu ersetzende Spezialisten sahen ihre weitere Perspektive oft nur in einer bürgerlichen Welt.
Der kalte Krieg verunsicherte viele Intellektuelle noch mehr und beunruhigte und desorientierte selbst solche, die die antifaschistisch-demokratischen Aktivitäten der neuen Verwaltungsorgane, der SED und anderer Massenorganisationen als akzeptabel ansahen und sie angesichts des Elends der Nachkriegszeit aus humanistischen und ethischen Beweggründen unterstützten. Mit der wissenschaftlichen Theorie der Arbeiterklasse freundeten sich in jenen Jahren Angehörige der alten Intelligenz kaum an. Hingegen wurden bürgerliche Varianten der Auseinandersetzung mit Faschismus, Nationalismus und Militarismus sowie der geistigen Bewältigung der Nachkriegssituation von vielen Intellektuellen bereitwillig aufgenommen. Auch den Vormarsch der revolutionären Weltbewegung betrachteten diese meist aus dem ihrer bisherigen Klassengeschichte geschuldeten Blickwinkel des Bürgertums.
Auf der anderen Seite hegten viele Arbeiter und andere Werktätige ein tiefverwurzeltes Mißtrauen gegenüber der meist mit der Großbourgeoisie verbunden gewesenen Intelligenz, und es mangelte nicht selten an Verständnis für deren spezifische Leistungen, Arbeits- und Lebensformen.
Nicht zuletzt deshalb forderte die SED ihre Mitglieder auf, sich intensiver mit den Lebens- und Schaffensproblemen von Intellektuellen zu befassen. Zugleich aber betonte sie die Notwendigkeit einer gründlicheren Beschäftigung und Auseinandersetzung mit bürgerlichen Anschauungen und Denkweisen und rief sie zu einer verstärkten Darlegung und Popularisierung des wissenschaftlichen Sozialismus auf. Zum 100. Jahrestag der Revolution von 1848 erschien erstmals der Sammelband „Marx und Engels über Kunst und Literatur“. Auch bot das Jubiläum Möglichkeiten, revolutionäre und demokratische Traditionen des deutschen Bürgertums transparent zu machen.
Der Kulturtag der SED, der vom 5. bis 7.Mai 1948 stattfand und etwa 2000 Vertreter aller werktätigen Klassen und Schichten, vor allem jedoch Intellektuelle, sowie zahlreiche ausländische Gäste zusammenführte, analysierte das kulturell Erreichte und lenkte die Aufmerksamkeit der gesamten Öffentlichkeit auf die neuen Anforderungen in der Kultur- und Bündnispolitik. Als Hauptredner des Kongresses traten neben Otto Grotewohl der Pädagoge Heinrich Deiters und das Mitglied des Zentralsekretariats der SED Anton Ackermann auf. Otto Meier, ebenfalls Mitglied des Zentralsekretariats der SED, hielt den Festvortrag anläßlich des 130. Geburtstages von Karl Marx.
Otto Grotewohl befaßte sich mit der geistigen Situation nach 1945 und erläuterte Rolle und Bedeutung des Marxismus. Streitbar und kenntnisreich setzte er sich mit der faschistischen Ideologie und ihren theoretischen Wegbereitern, wie Chamberlain, Gobineau, Nietzsche und Spengler, auseinander und warnte vor restaurativen Kräften, die erneut mit dem antisowjetisch ausgerichteten, christlich verbrämten Schlachtruf zur „Rettung des Abendlandes“ Haß gegen Sozialismus und revolutionäre Demokratie zu schüren suchten. Ausgehend von den „Feuerbach-Thesen“ von Karl Marx kennzeichnete er die historische Mission der Arbeiterklasse als Entwicklungsgesetz der Geschichte und forderte die Kulturschaffenden auf, nicht abseits zu stehen, sondern sich aktiv an der Veränderung der Gesellschaft zu beteiligen. Mit Blick auf dieses Anliegen formulierte er eine Absage an die bürgerliche Modephilosophie der Nachkriegszeit, den Existentialismus, der die Verlorenheit des Individuums in einer unsicheren Welt und seine Angst als Grundbefindlichkeit des Menschen charakterisierte, ohne nach den konkret-historischen gesellschaftlichen Ursachen menschlicher Daseinsnöte zu fragen.
Erster Kulturtag der SED in Berlin, 5. Mai 1948. Eröffnung durch Wilhelm Pieck
Angesichts der materiellen und geistigen Nachkriegsprobleme bestärkte die Existenzphilosophie nicht zuletzt Intellektuelle und die studierende Jugend in fatalistischen Gedankengängen. In der Ostzone wirkte sie vor allem in Gestalt des französischen Existentialismus, dessen Vertreter antifaschistische Elemente in diese philosophische Richtung einbrachten, wie nicht zuletzt der auf Positionen der Résistance stehende Dramatiker Jean-Paul Sartre. Anfang 1948 war Sartre nach Berlin gekommen und hatte sich im Hebbel-Theater den Auseinandersetzungen um sein Drama „Die Fliegen“ gestellt. Die Sartres Gesamtwerk allerdings nicht gerecht werdende Diskussion entzündete sich in erster Linie an dessen These, daß der Mensch an keinerlei Normen und Notwendigkeiten gebunden sei und deshalb eine unbegrenzte Freiheit und Selbstverantwortung besitzen solle. Einem solchen übersteigerten Subjektivismus setzten die Marxisten ihren Freiheitsbegriff entgegen und wiesen nach – wie auch Grotewohl und Deiters auf dem Kulturtag – daß die menschliche Freiheit durch natürliche und soziale Gesetzmäßigkeiten determiniert ist.
In seinem Referat „Marxistische Kulturpolitik“, das auch eine kritische Auseinandersetzung mit der Ziegenhainer Kulturtagung der SPD einschloß, verwies Anton Ackermann auf die wachsende Geltung der Lehre von Karl Marx im Bemühen um Faschismusbewältigung und um die Schaffung einer friedliebenden demokratischen Gesellschaft, als deren soziale Hauptkraft er die Arbeiterklasse benannte. Er würdigte den Marxismus als lebendige, schöpferische, nie ruhende, nie stillstehende, sondern sich stets mit der gesellschaftlichen Entwicklung, mit der Entwicklung des menschlichen Geistes vorwärtsbewegende Wissenschaft und erklärte unter Zurückweisung bürgerlicher und sozialdemokratischer Auffassungen vom Marxismus als rein ökonomistischer Gesellschaftstheorie: „Der wissenschaftliche Sozialismus ist eine allseitige Gesellschaftslehre. Sein tiefster und letzter Sinn ist der Mensch, seine Befreiung aus Armut, Ausbeutung, Demut und Knechtschaft. Unser Streben ist die Erfüllung des berechtigten Glücksverlangens der Menschheit, die Herstellung der Würde des Menschen. Die Kraft des Marxismus ist das Wissen um die Kraft der Menschlichkeit und des menschlichen Fortschritts. – So ist der wissenschaftliche Sozialismus der neue, reale Humanismus … Die Entfaltung des Kampfes der Arbeiterklasse, die Organisierung ihres Sieges, das ist der Weg in das Reich der Freiheit und des Friedens.“ 10 Diese Sichtweise korrespondierte mit einer weiten marxistisch-leninistischen Kulturauffassung.
Die SED suchte der geschichtlichen Vorwärtsbewegung zu entsprechen, indem sie die führende Rolle der Arbeiterklasse und ihrer Partei auch im geistig-kulturellen Leben beschleunigt durchzusetzen begann. Damit verband sie eine Offensive des Marxismus-Leninismus. Fragen der marxistischen Philosophie, wie die der Einheit von dialektischem und historischem Materialismus, rückten stärker ins Zentrum der ideologischen Arbeit.
Der Kulturtag selbst bildete im Ringen um die Durchsetzung des wissenschaftlichen Sozialismus einen Höhepunkt. Seine Teilnehmer beschlossen ein breitgefächertes kulturpolitisches Programm, das den neuen gesellschaftlichen Bedingungen in der sowjetischen Besatzungszone weitgehend entsprach. Das Dokument bezeichnete den freien Menschen in einer freien und gerechten Ordnung ohne Ausbeutung, ohne Krieg und Hunger, ohne Unterdrückung und Rechtlosigkeit des Volkes als das anzustrebende Ziel einer kulturellen Wende. Die detailliert ausgearbeiteten kulturellen Aufgabenstellungen bezogen sich auf die Pflege und die Förderung von Kunst, Bildung und Wissenschaft, die Herausbildung und Festigung der Bündnisbeziehungen mit der Intelligenz, die Freisetzung der geistigen Kraft des Marxismus, die Weiterführung der Bildungsreform, die Pflege und Förderung der Volksverbundenheit der Kunst und die Ausbildung neuer sozialer Inhalte des künstlerischen Schaffens, die Gesundheits- und die Rechtspflege. Ausgehend hiervon erklärten die Teilnehmer des Kulturtages in einer Entschließung: „Die neue Epoche der Kultur wird die Kultur des Sozialismus sein!“ 11
Die separate Währungsreform und die Berliner Krise
Im Gefolge der Beschlüsse der Londoner Separatkonferenz führten die Westmächte am 20. Juni 1948 für ihre Besatzungszonen eine separate Währungsreform durch. Die Schaffung einer westzonalen Währung war ein weiterer Akt zur Konstituierung eines Westzonenstaates, und die sozialen Prinzipien der Reform prägten zugleich dessen Charakter. Es war eine Währungsreform im Interesse der Reichen, der Grund-, Produktionsmittel- und Sachwertbesitzer, der Profitinteressen und der Kapitalbildung, zu Lasten der kleinen Vermögen und kleinen Sparer. Die Arbeiter hatten das Nachsehen und wurden um die Früchte ihrer Wiederaufbauarbeit betrogen.
Während Bargeld und alle Sparguthaben im Verhältnis 10:1 abgewertet wurden, konnten die Aktionäre ihre Aktien im Verhältnis 1:1 umstellen. Seit langem hatten Produzenten und Händler Waren zurückgehalten und große Warenlager angelegt. Nach der Währungsreform nun brachten sie diese auf den Markt. Die vollen Schaufenster bereits am Tage nach dem Geldumtausch erschienen wie ein Wunder. Sie sorgten jedoch auch für Erbitterung und sozialen Sprengstoff; denn gleichzeitig hob Bizonen-Wirtschaftsdirektor Ludwig Erhard die bisher in den wichtigsten Bereichen bestehende Preisbindung auf. Ein sprunghafter Anstieg der Preise, hinter dem die Lohnerhöhungen beträchtlich zurückblieben, war die Folge. Der Parteivorstand der KPD erhob schärfsten Protest gegen „die diktierte kapitalistische Währungsreform. Sie bedeutet die Aufspaltung Deutschlands und die Abwälzung der Lasten des Krieges und des Marshallplanes auf die Schultern der deutschen Werktätigen.“ 12
Währungsreform in den Westzonen, 20. Juni 1948. Schlangestehen vor den Umtauschstellen
Gefüllte Schaufenster nach der Währungsreform in den Westzonen, Juni 1948
Mit der Währungsreform erfolgte eine Weichenstellung, die die wirtschaftliche Rekonstruktion mit der Festigung und dem Ausbau der monopolkapitalistischen Strukturen und Machtverhältnisse verband. Der seit Herbst 1947 – nach Überwindung der Transportkrise – in den Westzonen vorangeschrittene, durch die Warenhortung aber verdeckte Produktionsaufschwung brach sich nun ungehemmt Bahn. Den aus der Währungsreform entstehenden sozialen Konflikten wirkten der Wirtschaftsaufschwung und das spürbare Zuendegehen der Hungerjahre zunehmend entgegen. Wirtschaftlicher Wohlstand rückte für viele tatsächlich oder vermeintlich in greifbare Nähe. In Verbindung mit den Verheißungen des Marshallplans einerseits und den Auswirkungen des kalten Krieges andererseits führte das zu beträchtlichen Veränderungen in der Mentalität breiter Bevölkerungsschichten. Obwohl sich entstandene Hoffnungen angesichts der Lohn-Preis-Schere nur zum Teil erfüllten, der wirtschaftliche Aufschwung langsamer und widersprüchlicher voranschritt, als weithin erwartet, stellte sich die überwiegende Mehrheit der Westzonenbevölkerung auf den Boden der neuen Gegebenheiten, suchte sich einzurichten und individuell voranzukommen. Eine echte und wünschenswerte Alternative schien nicht mehr vorhanden zu sein. Der KPD gelang es unter diesen Bedingungen nicht, ihren Einfluß zu erhöhen und ein Massenpotential für die Durchsetzung einer alternativen Politik gegenüber der restaurativen Neuordnung und dem Kurs auf den Westzonenstaat zu formieren. Der im wesentlichen auf die unsozialen Auswirkungen der Währungsreform begrenzte Protest der Westzonengewerkschaften kulminierte am 12. November 1948 in einem eindrucksvollen 24stündigen Generalstreik. Die Gewerkschaften festigten damit ihre Positionen in der Mitbestimmungsfrage und im Kampf um Lohnverbesserungen. Die Grundfragen und -entscheidungen wurden davon nicht berührt. Der Zug, auf dessen Trittbrettern die Westzonengewerkschaften mitfuhren, dampfte auf restaurativen Geleisen immer schneller in Richtung Westzonenstaat.
Die separate Währungsreform war ein folgenschwerer Akt der Zerreißung Deutschlands und zugleich der Schädigung der Wirtschaft der Ostzone, in der die in den Westzonen entwertete Reichsmark weiterhin Zahlungsmittel war. Die Sowjetunion sah sich genötigt, Gegenmaßnahmen zu ergreifen. Der Personen- und Güterverkehr zwischen den Westzonen und der Ostzone bzw. Berlin wurde unterbrochen und eine Währungsreform für die Ostzone beschleunigt vorbereitet, um deren Überschwemmung mit entwerteter Reichsmark entgegenzuwirken. Die Sowjetunion, die SED und andere demokratische Kräfte gingen davon aus, daß Berlin als Bestandteil der sowjetischen Besatzungszone in diese Währungsreform einbezogen werden muß.
Die Militärgouverneure der Westmächte hatten im Zusammenhang mit ihren Befehlen zur separaten Währungsreform zunächst versichert, daß die D-Mark der Westzonen nicht in Berlin eingeführt würde. Als der sowjetische Oberbefehlshaber, Marshall Sokolowski, in seinem Befehl Nr. 111 zur Durchführung einer demokratischen Währungsreform in der sowjetischen Besatzungszone vom 23. Juni 1948 auch Groß-Berlin mit einbezog, verboten die westlichen Militärkommandanten die Durchführung dieses Befehls in den Westsektoren und führten hier vom 25. Juni 1948 an die D-Mark der Westzonen – mit einem besonderen Stempel versehen – ein, zunächst neben der Währung der sowjetischen Besatzungszone. Die Magistratsmehrheit stellte sich – mit Ausnahme der drei Vertreter der SED – hinter diese Maßnahme und übte darüber hinaus Kritik an den Westmächten, weil diese die D-Mark (West) nicht als alleiniges Zahlungsmittel für die Westsektoren eingeführt hatten. Die Magistratsmehrheit wollte Berlin oder zumindest die Westsektoren um den Preis der Spaltung der Stadt unbedingt in den entstehenden Westzonenstaat integrieren und so eine „Frontstadt“ des kalten Krieges inmitten der Ostzone schaffen. Hier lagen die eigentlichen Wurzeln der sogenannten Berliner Krise.
Die Westmächte reagierten auf die unbedingt notwendigen sowjetischen Schutz- und Sicherungsmaßnahmen gegen die Auswirkungen ihres einseitigen und vertragsbrüchigen Vorgehens außerordentlich heftig und konfrontativ. Der amerikanische Militärgouverneur Clay drohte mit dem Durchbruch eines Panzerkonvois von Helmstedt nach Westberlin, wofür er allerdings von Washington kein grünes Licht erhielt. Schon am 25.Juni 1948 wurde – die Währungsreform in der Ostzone war eben erst begonnen worden – unter dem Codenamen „Operation Vittles“ die sogenannte Luftbrücke eingerichtet, über die die Westsektoren mit dem Dringendsten beliefert werden sollten. Die eintreffenden Lieferungen hätten allerdings keineswegs ausgereicht, um eine Katastrophe zu verhindern. Viele Westberliner nahmen jedoch die Möglichkeit wahr, sich im demokratischen Sektor zu versorgen, bzw. unternahmen in verstärktem Maße „Hamsterfahren“ in die Ostzone. Außerdem wurden zunehmend illegal Versorgungsgüter aus der Ostzone und dem Ostsektor nach den Westsektoren verbracht, die hier zu überhöhten Preisen gehandelt wurden.
Die Position der Westmächte war in bezug auf Berlin und die Berliner Krise rechtlich nicht abgedeckt und politisch schwach. Das suchten sie durch eine Politik der Stärke und der Konflikteskalation zu kaschieren. Die bereits weit fortgeschrittene Konfrontation des kalten Krieges und die damit in der „westlichen Welt“ geschürte Antisowjethetze begünstigten das. In ihrer Note an die Regierung der USA zur Westberlinfrage stellte die sowjetische Regierung am 14. Juli 1948 fest, daß Berlin „im Zentrum der Sowjetischen Besatzungszone“ liegt und „einen Teil dieser Zone“ darstellt.13 Die Anwesenheit der Westmächte in Berlin und ihre Beteiligung an der Verwaltung der Stadt begründeten sich einzig und allein in dem mit der Sowjetunion für die Behandlung Deutschlands während der Kontrollperiode getroffenen Vereinbarungen über die Viermächteverwaltung bzw. über den Kontrollmechanismus, insbesondere über die Tätigkeit des Alliierten Kontrollrates in bezug auf Deutschland als Ganzes. Mit ihrer Abkehr von den Potsdamer Beschlüssen, ihrer Separat- und Spaltungspolitik, der „Deutschland als Ganzes“ geopfert wurde, hatten die Westmächte ihrer Anwesenheit in Berlin die völkerrechtliche Grundlage entzogen.
Die Westmächte konnten zumindest den Teil der Argumentation, daß Berlin Teil der sowjetischen Zone sei, nicht völlig ignorieren, denn dies war eine reale Gegebenheit, die sie selbst wiederholt – zuletzt im Bericht des Alliierten Kontrollrates an den Rat der Außenminister vom 25.Februar 1947 – anerkannt hatten. Nichts lag daher näher als dieser Tatsache durch die eindeutige Einbeziehung Berlins in das Währungssystem der Ostzone Rechnung zu tragen.
Die damit verbundene Möglichkeit, die Berliner Krise beizulegen, stieß jedoch in den herrschenden Kreisen der Westmächte auf massive Ablehnung. Auch die Magistratsmehrheit machte dagegen mobil.
Eine viermotorige „Douglas Skymaster“ vom Typ C-54 während der „Luftbrücke“ beim Anflug auf den Flughafen Berlin-Tempelhof, 1948
Nicht eine Beilegung, sondern die Beibehaltung und Eskalation der Berliner Krise lag im Interesse der Politik des kalten Krieges und der Erreichung solcher Ziele wie Westblock, NATO und Westzonenstaat.
In zahlreichen, seit 1946 erstellten geheimen britischen und amerikanischen Memoranden über die Folgen einer einseitigen, die alliierte Viermächteverwaltung obsolet machenden Westzonenpolitik war eingeräumt worden, daß unter diesen Umständen ein Verbleiben der Westmächte in Berlin rechtlich nicht länger legitimiert war, und aus diesen und anderen Gründen deren Rückzug aus Berlin empfohlen worden. Am 20. Juli 1948 sprach sich auch der britische Militärgouverneur, Brian H. Robertson, in einem Schreiben an das Foreign Office dafür aus. Doch Washington und London beschlossen im Ergebnis intensiver Diskussionen – ein angebliches Recht des Siegers formulierend – dennoch in Westberlin zu bleiben. Damit wurde der Grundstein für einen internationalen Dauerkonflikt sowie dafür gelegt, daß Westberlin für unbestimmte Zeit zu einem latenten Spannungs- und Kriegsherd, zur „Frontstadt“ des kalten Krieges inmitten der sowjetischen Besatzungszone wurde, von dem eine ständige Bedrohung und zusätzliche Erschwerung des demokratischen Neuaufbaus und der Gestaltung des neuen Deutschlands ausging. Die von der Sowjetunion weiter aufrechterhaltenen Sperrmaßnahmen gegenüber den Verbindungswegen zwischen den Westzonen und den Westsektoren von Berlin erwiesen sich allerdings als ungeeignet, die Westmächte zu bewegen, von der weiteren Durchführung der Londoner Beschlüsse – und sei es auch nur zeitweilig, bis zu einer neuen Konferenz des Rates der Außenminister 14 – Abstand zu nehmen. Sie bewirkten eher das Gegenteil.
Das über Monate währende Alltagserlebnis der „Luftbrücke“, kombiniert mit einer entfesselten psychologischen Kriegführung, hinterließ in der Mentalität der Westberliner Bevölkerung tiefe Spuren. Die „Luftbrücke“ brachte in den USA, zunächst in der Flugzeugindustrie, die Rüstungsspirale in Schwung. Sie konnte als Rechtfertigung für die beschleunigte Bildung des Westzonenstaates genutzt werden und lieferte dafür zugleich eine Art Rauchvorhang.
Die separate Währungsreform, ihre Aus- und Folgewirkungen vertieften die Ost-West-Spaltung Deutschlands und Berlins in entscheidendem Maße. Die zwei zunächst unterschiedlichen, dann zunehmend verschiedenen, schließlich gegensätzlichen Wege der Nachkriegsentwicklung auf deutschem Boden führten nach der gesellschaftlich-politischen und administrativ-territorialen nunmehr auch zu einer währungspolitischen Abgrenzung zwischen Westzonen und Ostzone, als seien sie füreinander Ausland.
Banknoten mit Kupon
Die demokratische Währungsreform in der Ostzone
Den Auswirkungen der separaten Währungsreform konnte wirksam nur durch die umgehende Durchführung einer Währungsreform auch in der sowjetischen Besatzungszone begegnet werden. Das war jedoch nicht ohne weiteres möglich. Die Sowjetunion hatte im Alliierten Kontrollrat bzw. in dessen Finanzdirektorat bis zuletzt auf eine einheitliche Währungsreform in Deutschland hingewirkt. Die Pläne hierfür waren weit gediehen, und Anfang 1948 schien sogar eine Lösung in Reichweite zu liegen. Während die für die separate Währungsreform benötigten Banknoten insgeheim bereits im Herbst 1947 in den USA gedruckt worden waren, hatte die Sowjetunion keine gleichgeartete Sonderpolitik betrieben. Neue Banknoten standen deshalb, als es nunmehr galt, die Währungsreform so schnell wie möglich durchzuführen, nicht zur Verfügung. So mußte improvisiert werden. Ein Teil der bisher im Umlauf befindlichen Scheine wurden mit einem Kupon versehen und übte die Funktion der neuen Währung solange aus, bis sie gegen neue Geldscheine bzw. neues Hartgeld ausgetauscht werden konnten. Das geschah nach einem Monat.
Anders als die Westmächte übertrug die SMAD die Verantwortung für die Durchführung der Währungsreform dem dafür in Frage kommenden deutschen Organ, der Deutschen Wirtschaftskommission. Die DWK, insbesondere ihr Sekretariat, wurden vor eine große Bewährungsprobe gestellt. In kürzester Zeit. Mußte von ihnen eine „Verordnung über die Währungsreform in der sowjetischen Besatzungszone Deutschlands“ fertiggestellt und der SMAD eingereicht werden, die sie ihrem am 23. Juni 1948 erlassenen Befehl Nr. 111 „Über die Durchführung der Währungsreform in der Sowjetischen Besatzungszone Deutschlands 15 – einschließlich Berlins – zugrunde legte. Korrespondierend mit diesem Befehl veröffentlichte das Zentralsekretariat der SED bereits am 22.Juni 1948 einen Beschluß zur Währungsreform, in dem deren Ziele und Hauptaspekte, ihr sozial gerechter, demokratischer Charakter dargelegt wurden.
In der Präambel des Befehls Nr. 111 wurde festgestellt: „Die Währungsreform in der sowjetischen Besatzungszone soll das im Umlauf befindliche Geldvolumen stark vermindern, es den Bedürfnissen der Wirtschaftsentwicklung anpassen. Gleichzeitig soll ihre Durchführung der werktätigen Bevölkerung möglichst geringe Verluste verursachen. Die Hauptlast der bei der Währungsreform unvermeidlichen Verluste sollen diejenigen tragen, die sich am Kriege, an Spekulationen, an illegalen Operationen auf dem schwarzen Markt bereichert haben. Die Währungsreform muß weitgehende Möglichkeiten schaffen für die weitere Entfaltung der Industrie und Landwirtschaft, vor allem auf der Basis der Festigung der dem Volke gehörenden entscheidenden Industriezweige, auf der Basis der Festigung der werktätigen Bauernwirtschaften, sowie für die Ausnutzung der privaten Unternehmerinitiative, die auf die Entwicklung der Friedenswirtschaft gerichtet ist.“ 16 Die Hauptaufgabe der Währungsreform bestand darin, das gesamte Bar- und Girogeld im Verhältnis 10:1 von RM zu DM umzuwerten. Jedem Bürger in der Ostzone wurde ein Betrag von 70 RM an Bargeld im Verhältnis 1:1 in DM umgetauscht. Angehörigen der Besatzungsmacht wurde erlaubt, einen Betrag in Höhe eines zweiwöchigen bzw. monatlichen Gehaltes zu den gleichen Bedingungen einzutauschen. Im Verhältnis 1:1 erfolgte auch der Umtausch der baren Geldmittel der deutschen Banken in Höhe ihres Grund- und Rücklagekapitals. Die seit dem 9. Mai 1945 entstandenen Spareinlagen bis zu 100 RM wurden ebenfalls im Verhältnis 1:1, die bis zu 1000 RM im Verhältnis 5:1 umgewertet.
Die laufenden Konten der volkseigenen Betriebe, der staatlichen Verwaltungen, der Parteien und der Gewerkschaften wurden 1:1 umgewertet, die Konten der Sozialversicherung 2:1 und die der Versicherungen 5:1. Die Konten der anderen Betriebe und Organisationen konnten in Höhe des wöchentlichen Umsatzes bzw. der wöchentlichen Lohnsumme im Verhältnis 1:1 eingetauscht werden. Nicht umgewertet wurden die von den Landesregierungen 1946 zum Kauf angebotenen mit 4 Prozent verzinsten Anleihen. Die Währungsreform ließ die vor dem Kriege entstandene innere und äußere Staatsschuld sowie die Schuldverpflichtungen der geschlossenen Banken unberührt. Die vor dem 9. Mai 1945 angelegten, aber blockierten Spareinlagen und Banknoten wurden im Verhältnis 10:1 umgewertet und in eine Altguthabenanleihe der Länder verwandelt.
Es wurde festgelegt, alle alten Konten über 3000 RM im Zuge der Währungsreform nach Kriegsgewinnen zu überprüfen. Konten, die nach dem 8.Mai 1945 angelegt worden waren und 5000 RM überstiegen, sollten ebenfalls überprüft werden, um Gewinne aus Spekulationen und Schwarzmarktgeschäften festzustellen und diese unrechtmäßig erworbenen Gelder einzuziehen.
In einer großen Aktion gelang es in der Zeit vom 24. bis 28. Juni 1948, die demokratische Währungsreform in den Ländern der Ostzone und in den zum sowjetischen Sektor gehörenden Stadtbezirken von Berlin durchzuführen. Im Ergebnis reduzierte sich die im Umlauf befindliche Geldmenge auf weniger als ein Siebentel, ohne daß allerdings damit der Geldüberhang vollständig beseitigt war. Die volkseigene Wirtschaft wurde gefestigt. Es entstanden günstige Bedingungen für die Einschränkung des schwarzen Marktes. Die Lage der Werktätigen verbesserte sich, bzw. es wurde dafür eine stabile Grundlage geschaffen. Die Rolle des Lohnes und damit des Anreizes, durch höhere Leistung ein höheres Einkommen zu erzielen, erfuhr eine grundlegende Veränderung.
Die Auswirkungen der Währungsreform stellten das private Handwerk, den privaten Handel, die Privatindustrie und auch die private Landwirtschaft vor zum Teil schwierige Probleme. Einerseits gerieten nicht wenige Unternehmen, die ein Produkt der spezifischen Nachkriegsverhältnisse waren oder davon ungerechtfertigt profitiert hatten, durch die „Normalisierung“ der Verhältnisse und den Verlust von Spekulationsgewinnen in Bedrängnis. Der Konkurs oder die Liquidation solcher Betriebe lagen im volkswirtschaftlichen Interesse. Andererseits kamen aber auch viele durchaus seriöse und volkswirtschaftlichen Interessen dienende Betriebe durch die Umwertung ihrer Mittel in finanzielle Schwierigkeiten, die nicht über Kreditfinanzierungen behoben werden konnten. Das war eine der Wurzeln für Betriebsaufgaben in größerer Zahl, wie sie im 2. Halbjahr 1948 erfolgten.
Die weltpolitischen Konstellationen und die Herausbildung des sozialistischen Weltsystems
Die Sowjetunion und die volksdemokratischen Länder beantworteten die imperialistische Westblock- und Konfrontationspolitik mit verstärkten Anstrengungen, ihren Wirtschaftsaufbau aus eigener Kraft und durch Zusammenarbeit zu fördern, die Volksmacht in den volksdemokratischen Ländern zu festigen und auszubauen und die Entwicklung in Richtung Sozialismus zu beschleunigen. Hatten konterrevolutionäre Kräfte in den volksdemokratischen Ländern durch den kalten Krieg zunächst Auftrieb erhalten, so erlitten ihre Umtriebe schließlich, wie die Prager Februarereignisse 1948 besonders deutlich machten, einen Mißerfolg.
Angesichts der vom Weltimperialismus ausgehenden Kriegsdrohungen und konterrevolutionären Einmischungsakte schlossen sich Angehörige aller Klassen und Schichten zum Kampf um die Erhaltung des Weltfriedens und zur Stärkung ihrer Länder auf dem Wege des gesellschaftlichen Fortschritts enger um die führende Arbeiterklasse zusammen. Die sozialdemokratischen Parteien, in denen sich die revolutionären Kräfte durchsetzten, vereinigten sich im Verlaufe des Jahres 1948 mit den kommunistischen Parteien. In Rumänien, Bulgarien, Ungarn, der Tschechoslowakei und Polen entstanden revolutionäre Einheitsparteien der Arbeiterklasse auf marxistisch-leninistischer Grundlage. Die revolutionär-demokratische Staatsmacht entwickelte sich fast in allen diesen Ländern in Form der Volksdemokratie zur Diktatur des Proletariats. Soweit eine umfassende Nationalisierung in der Industrie, im Finanz-, im Verkehrs- und im Nachrichtenwesen nicht schon erfolgt war, wurde sie 1948 vollzogen. Der staatliche und der genossenschaftliche Sektor erreichten einen Anteil von über 80, zum Teil auch über 90 Prozent an der industriemäßigen Bruttoproduktion. Mit Ausnahme Rumäniens hatten die obengenannten Länder schon 1947 den Übergang zur längerfristigen Planung der Wirtschaft vollzogen.
Ausgehend von den erreichten Erfolgen bei der Wiederherstellung der Volkswirtschaft und vom Stand der politischen und sozialökonomischen Entwicklung orientierten die marxistisch-leninistischen Parteien Rumäniens, Ungarns, Albaniens, Bulgariens und Polens auf ihren Parteitagen, die sie im Laufe des Jahres 1948 durchführten, auf den Aufbau der Grundlagen des Sozialismus in ihren Ländern. Im Mai 1949 formulierten auch die Kommunisten der Tschechoslowakei eine dementsprechende Generallinie ihrer Politik.
Diese sozialistische Orientierung war mit der Klärung grundlegender Fragen in bezug auf Ziele und Wege der weiteren Entwicklung verbunden. Auf dem V. Parteitag der bulgarischen Kommunisten im Dezember 1948 gab Georgi Dimitroff die bedeutsame Einschätzung, daß das Regime der Volksdemokratie unter den bestehenden Bedingungen die Funktion der Diktatur des Proletariats ausüben könne und müsse. Damit wurden zugleich Vorstellungen, daß die volksdemokratische Entwicklung eine Art „dritter Weg“ zwischen Kapitalismus und Sozialismus darstellt, zurückgewiesen und der historische Platz der Volksdemokratie eindeutig dem Übergang vom Kapitalismus zum Sozialismus zugeordnet. Die Einschätzung Georgi Dimitroffs traf – trotz des unterschiedlichen Entwicklungsstandes – voll und ganz auch für die Übergangsverhältnisse in der Ostzone zu und war damit für die Politik der SED von grundlegender Bedeutung.
Die Sowjetunion unterstützte die Entwicklung der volksdemokratischen Länder tatkräftig und auf vielfältige Weise. Sie schloß 1948 mit Bulgarien, Rumänien und Ungarn Verträge über Freundschaft, Zusammenarbeit und gegenseitigen Beistand ab, wie sie bereits mit Polen, der Tschechoslowakei und Jugoslawien bestanden. Außerdem schlossen in den Jahren 1947 bis 1949 fast alle volksdemokratischen Länder untereinander ähnliche Verträge. Im Januar 1949 gründeten die Sowjetunion, die Volksrepublik Bulgarien, die Volksrepublik Polen, die Rumänische Volksrepublik, die Tschechoslowakische Republik und die Ungarische Volksrepublik den Rat für Gegenseitige Wirtschaftshilfe (RGW).
In China hatte die Volksbefreiungsarmee bis Mitte 1948 große Teile des Landes befreit, und die endgültige Niederlage des von den USA gestützten TschiangKai-schek-Regimes zeichnete sich ab. Im September 1948 wurde die Koreanische Demokratische Volksrepublik gegründet, und in Vietnam, insbesondere im Norden des Landes, festigte sich die Volksmacht.
Der Sozialismus entwickelte sich zu einem Weltsystem sozialistischer Staaten. Das war der nach der Großen Sozialistischen Oktoberrevolution bedeutendste Erfolg der Arbeiterklasse bei der Verwirklichung ihrer welthistorischen Mission, das wichtigste Ergebnis der Befreiungstat des Sowjetvolkes im zweiten Weltkrieg und des Kampfes der Völker der Antihitlerkoalition für eine friedliche, fortschrittliche und gerechte Weltordnung. Die internationalen Beziehungen wurden damit auf eine neue, völlig veränderte Grundlage gestellt.
Der Weltimperialismus hatte dieses Ergebnis des zweiten Weltkrieges und der Nachkriegsentwicklung nicht erwartet und nicht verhindern können. Mit der Entfesselung und Eskalation des kalten Krieges war es ihm im kapitalistischen Teil der Welt jedoch gelungen, seine Positionen durch eine konterrevolutionäre Gegenoffensive zu festigen, die revolutionäre Arbeiterbewegung und andere fortschrittliche Kräfte zurückzudrängen, eine Linkswende zu verhindern und sein Herrschaftssystem zu konsolidieren. Dies war, wie in den USA, mit Schürung politischer Hysterie und einem organisierten Kesseltreiben, einer wahren „Hexenjagd“ gegen alle Kommunisten oder als solche verdächtigten Personen verbunden, der neben progressiven auch liberale und andere Persönlichkeiten zum Opfer fielen. Den Zusammenbruch seines Kolonialsystems konnte der Weltimperialismus nicht aufhalten. Nach Indien, das 1947 von Großbritannien aufgegeben werden mußte, erlangten weitere ehemalige Kolonien ihre Unabhängigkeit. Durch den Übergang zu neuen Praktiken gelang es jedoch dem Imperialismus, weiterhin starken Einfluß auf die Mehrzahl dieser Länder auszuüben. Mit der Eskalation des kalten Krieges erhob sich zugleich immer drohender die schreckliche Gefahr eines vom Imperialismus geführten atomaren Krieges.
Die Sowjetunion stand unter dem Druck der Herausforderung, im Interesse der Friedenssicherung das Atomwaffenmonopol der USA durchbrechen zu müssen und gemeinsam mit den anderen sozialistischen Ländern längerfristig einer militärischen Überlegenheit des Imperialismus entgegenzuwirken. Die sich daraus ergebenden wirtschaftlichen Anforderungen erwiesen sich um so belastender, als sie sich mit noch nicht überwundenen Folgen des zweiten Weltkrieges, den Auswirkungen des imperialistischen Wirtschaftskrieges und der Tatsache einer noch unzureichend entwickelten materiell-technischen Basis verbanden.
Die Entstehung und Entwicklung des sozialistischen Weltsystems wurden wesentlich von der historisch bedingten industriellen Rückständigkeit des überwiegenden Teils der dazu gehörenden Länder geprägt. Die Sowjetunion war durch die riesigen Kriegsverluste und -zerstörungen vieler Ergebnisse ihres sozialistischen Aufbauwerkes verlustig gegangen. Unvermeidlich setzten dieser Rückschlag bzw. die noch nicht überwundene Rückständigkeit Bedingungen, die Wege und Formen des sozialistischen Aufbaus in erheblichem Maße beeinflußten. Die Entwicklung des sozialistischen Weltsystems und der einzelnen Länder wurde vor allem durch die vom kalten Krieg diktierte zugespitzte Konfrontation, durch imperialistische Embargo- und andere Maßnahmen schwer beeinträchtigt. Nachteilig wirkten sich die Erscheinungen und Folgen des Personenkultes um J. W. Stalin, schwerwiegende Verletzungen der sozialistischen Gesetzlichkeit und Konsequenzen der gestörten Beziehungen zu Jugoslawien aus. Der Mangel an qualifizierten Kadern, an Erfahrungen und theoretischem Vorlauf kam hinzu. So dominierten in jenen Jahren vereinfachte und historisch verkürzte Vorstellungen von einem Sieg des Sozialismus im Weltmaßstab und – damit verbunden – eine undifferenzierte Sicht auf das „andere Lager“, auf die Möglichkeiten und Potenzen des Imperialismus. Die Notwendigkeit äußerster Anspannung aller Kräfte und rigoroser Ausnutzung aller Ressourcen förderte Tendenzen, die sozialistischen Entwicklungsprozesse zu forcieren und sie zugleich stark zu zentralisieren, und dies wiederum wirkte zurück auf die Entwicklung der sozialistischen Demokratie. Die Übertragung von Meinungsverschiedenheiten zwischen den Parteien des Kominform auf die zwischenstaatlichen Beziehungen, wie im Falle Jugoslawiens, und die dabei angewandten schroffen Formen der Auseinandersetzung; im Kampf gegen tatsächliche oder vermeintliche nationalistische Abweichungen auftretende. Einseitigkeiten und Fehler; Verengungen und Überziehungen in ideologischen Auseinandersetzungen, wie in der Formalismusdiskussion, führten ebenfalls seit 1948 zu schweren Belastungen. Dies alles beeinträchtigte die Entwicklung und die politisch-ideologische Ausstrahlung des sozialistischen Weltsystems.
So zeichnete sich eine Zeit harter Bewährungsproben und größter Anstrengungen sowie scharfer internationaler Auseinandersetzungen ab, in der es galt, das sozialistische Weltsystem auszubauen und wirksam zu schützen und so die Langzeitwirkung der mit seiner Entstehung verbundenen grundlegenden Veränderungen zum Tragen zu bringen. Dies war für die Erhaltung des Weltfriedens, die Bewahrung der Menschheit vor einem sie vernichtenden Atomkrieg und damit für ihre Zukunft und ihren Fortschritt das Entscheidende.
Die Entstehung des sozialistischen Weltsystems und die Gründung des RGW eröffneten auch dem deutschen Volk, vor allem der Arbeiterklasse und ihren Verbündeten in der Ostzone, neue Perspektiven, stellten ihren Kampf gegen die imperialistische Kriegspakt- und Spaltungspolitik auf eine neue Grundlage.
Erste Reise einer Delegation der SED in mehrere volksdemokratische Länder und nach Österreich, Juni 1948. Wilhelm Pieck bei Georgi Dimitroff und Rosa Dimitrovca in Sofia
Das von der Warschauer Konferenz beschlossene Aktionsprogramm zur Deutschlandfrage wurde von wirksamen Maßnahmen zur Stärkung der antifaschistischen Demokratie in der sowjetischen Besatzungszone flankiert. Mit Hilfe der SMAD und gestützt auf die internationalistischen Traditionen der Kommunisten, konnte das neue Deutschland, das sich hier formierte, seine politischen und wirtschaftlichen Beziehungen zur Sowjetunion und zu den volksdemokratischen Ländern ausbauen. Die demokratischen Organisationen entwickelten enge Beziehungen zu einer Reihe internationaler Verbände. Dabei kam den sich verstärkenden Kontakten der SED zu Bruderparteien eine besondere Bedeutung zu.
Im Juni 1948 unternahmen die beiden Parteivorsitzenden eine zwölftägige Reise nach Ungarn, Bulgarien, der Tschechoslowakei, Rumänien und Österreich. Sie führten mit Vertretern der Bruderparteien in diesen Ländern einen Meinungsaustausch über Fragen des gemeinsamen Kampfes gegen den Imperialismus und für die Sicherung des Friedens und vermittelten bei der Schaffung einer revolutionären Einheitspartei der Arbeiterklasse gewonnene Erfahrungen. Dabei kam es zu wichtigen Vereinbarungen über den Ausbau von Wirtschaftsbeziehungen der Ostzone mit den volksdemokratischen Ländern und über eine Intensivierung des Zusammenwirkens.
In Sofia hatte Wilhelm Pieck eine herzliche Unterredung mit Georgi Dimitroff, an dessen Seite er im Exekutivkomitee der Kommunistischen Internationale tätig gewesen war. In diesem Gespräch betonte Georgi Dimitroff mit dem Gewicht seiner Autorität die Notwendigkeit, die Ostzone wie ein neues Deutschland zu behandeln, gegenüber dem das Mißtrauen aufhören müsse, das durch den Faschismus und seine Kriegspolitik hervorgerufen worden sei und durch die Entwicklung in den Westzonen Deutschlands neuen Nährstoff erhalte.
Im Oktober 1948 weilte eine Delegation der SED in Polen. Ihr gehörten Walter Ulbricht, Bruno Leuschner, Josef Orlopp und Willi Stoph an. Auf der 14. (28.) Tagung des Parteivorstandes der SED berichtete Walter Ulbricht: „Es war das erste Mal, daß ein deutscher Genosse in deutscher Sprache in Warschau vor einem Parteiaktiv sprach, in der Stadt, der die Deutschen so unermeßliches Leid zugefügt haben. Das war nicht leicht. Wir haben erreicht, daß die Genossen zu unserer Partei und unserer Parteiführung Vertrauen gewonnen haben.“17 Dieses Vertrauen zu festigen erfordere, daß die gesamte Partei, die Werktätigen der sowjetischen Besatzungszone eine eindeutige positive Haltung zum neuen Polen und vor allem zur Oder-Neiße-Grenze einnehmen. Die vom Parteivorstand der SED bald darauf herausgegebene Broschüre „Die Grundlagen der deutsch-polnischen Freundschaft“ leistete hierzu einen wichtigen Beitrag. Eine besondere Bedeutung für die Entwicklung der deutsch-polnischen Beziehungen und des Freundschaftsgedankens kam der auf Initiative der SED Mitte 1948 gegründeten „Hellmut-von-Gerlach-Gesellschaft“ zu.
Im Dezember 1948 konnten erstmals Gastdelegationen der SED an Parteitagen kommunistischer Parteien teilnehmen: am V.Parteitag der Bulgarischen Arbeiterpartei (Kommunisten) in Sofia und am Gründungsparteitag der Polnischen Vereinigten Arbeiterpartei (PVAP) in Warschau.
Die Annäherung der Ostzone an die Sowjetunion und die volksdemokratischen Länder war schwer. Besonders grausam hatten die Mordkommandos der SS und der Gestapo und die faschistische Soldateska in der Sowjetunion, in Polen und in anderen dieser Länder gewütet. Es gab dort kaum eine Familie, die infolge des vom faschistischen Deutschland geführten Krieges nicht gefallene, verhungerte, ermordete oder auf andere Weise umgekommene Angehörige zu beklagen hatte. Trotz der Bemühungen der marxistisch-leninistischen Kräfte in diesen Ländern um eine differenzierte, klassenmäßige Sicht, blieb ein undifferenzierter Deutschenhaß weit verbreitet und konnte nur mühsam und allmählich zurückgedrängt werden.
Trotz des im Frühjahr 1948 einsetzenden imperialistischen Embargos konnte die Ostzone ihren Außenhandel 1948 gegenüber 1947 um 32,5 Prozent vor allem durch eine wesentliche Erweiterung des gegenseitigen Warenaustausches mit der Sowjetunion, Polen und anderen volksdemokratischen Ländern erhöhen. Die Ostzone erhielt für ihre Exporte in diese Länder dringend benötigte Steinkohle, Koks, Guß- und Walzeisen, Mineraldünger und auch Lebensmittel.
Die verstärkte Zusammenarbeit der SED mit der KPdSU(B) und anderen Bruderparteien schuf zugleich Voraussetzungen für die Erweiterung der internationalen Beziehungen des FDGB, der FDJ, des DFD, der VVN und anderer Massenorganisationen. Der FDGB und die FDJ bauten ihre Beziehungen zu den sowjetischen Gewerkschaften bzw. zum Komsomol sowie zu den Gewerkschaften bzw. Jugendverbänden volksdemokratischer Länder aus. Im Mai 1948 wurde die VVN Mitglied der Internationalen Vereinigung der Widerstandskämpfer gegen den Faschismus (FIAPP); der Weltbund der Demokratischen Jugend nahm im August 1948 die FDJ, die Internationale Demokratische Frauenföderation im Dezember 1948 den DFD und der Weltgewerkschaftsbund wenig später den FDGB als Mitglied auf.
Der Halbjahrplan 1948 und die Weiterentwicklung der Politik der SED
Inhaltsverzeichnis
- 1 Der Halbjahrplan 1948 und die Weiterentwicklung der Politik der SED
- 1.1 Die Verwirklichung des Halbjahrplans 1948. Die beispielgebende Tat Adolf Henneckes
- 1.2 Schwierige Kursbestimmung in Vorbereitung der 1. Parteikonferenz der SED
- 1.3 Die 1. Parteikonferenz der SED
- 1.4 Die Festigung des antifaschistisch-demokratischen Blocks
Die Verwirklichung des Halbjahrplans 1948. Die beispielgebende Tat Adolf Henneckes
Als am 1.Juli 1948 die volkseigene Industrie nach den im Produktionsplan für das 2. Halbjahr 1948 festgelegten Kennziffern zu arbeiten begann, konnte sie sich auf die seit dem Herbst 1947 in ihren Betrieben beim Umsetzen des wirtschaftspolitischen Kurses der SED und des SMAD-Befehls Nr. 234 erzielten, zum Teil beträchtlichen Fortschritte stützen. Ein entscheidender Durchbruch bei der Steigerung der Arbeitsproduktivität war jedoch noch nicht erzielt worden.
Das zeigte sich vor allem in der Haltung der Belegschaften der volkseigenen Betriebe, deren Angehörige in ihrer überwiegenden Mehrheit noch nicht bereit waren, dem Beispiel jener Arbeiter, Ingenieure und Wissenschaftlern zu folgen, die durch Übererfüllung der Arbeitsnorm und durch Verbesserungsvorschläge zur Steigerung der Produktion beitrugen. Die Einstellung zur Arbeit und zum Volkseigentum war im allgemeinen noch nicht von der Erkenntnis getragen, daß die Früchte ihrer Arbeit den Werktätigen selbst zugute kommen werden. Die Arbeitsbummelei, ein Ausdruck dieser Einstellung, konnte zwar zurückgedrängt werden, war aber keineswegs aus den volkseigenen Betrieben verbannt. Die Bereitschaft, im Leistungslohn zu arbeiten, hatte sich gegenüber dem Herbst 1947 noch nicht wesentlich erhöht. Vom Oktober 1947 bis zum September 1948 war die Anzahl der Arbeiter, an deren Arbeitsplätzen der Leistungslohn eingeführt werden konnte, lediglich um 10 Prozent auf 35 Prozent der gesamten Industriearbeiterschaft gestiegen. Unter diesen Umständen erhöhte sich das Niveau der Arbeitsproduktivität nur langsam. Es belief sich auf 50 Prozent des Vorkriegsstandes.
Für die zögernde Hinwendung der Arbeiter zum Leistungslohn gab es verschiedene Gründe. Nach wie vor spielte die ökonomisch-technische Situation der Betriebe, insbesondere deren unregelmäßige materiell-technische Versorgung, die Unzulänglichkeit der verfügbaren Materialsortimente und der teilweise veraltete Maschinenpark, eine Rolle. Aber auch überholte oder falsch ermittelte Arbeitsnormen, die undifferenzierte Übernahme ganzer Belegschaften in den Leistungslohn, das Fehlen von Lohngruppenkatalogen in den Betrieben, ein von den Erfahrungen im kapitalistischen Ausbeutungssystem geprägtes Arbeitsverhalten, Besteuerung der besonderen Arbeitsleistung und andere Faktoren behinderten die Einführung dieser Lohnform. Hinzu kam, daß vom Lohn auch nach der Währungsreform noch nicht voll die ihm innewohnende stimulierende Wirkung ausging, da das Warenangebot unzureichend blieb und viele Werktätige einen Teil ihrer Lebensbedürfnisse weiterhin über den schwarzen Markt oder auf dem Tauschwege befriedigen mußten.
Die kranke Maschine. Gemälde von Magnus Zeller, 1949. Heimatmuseum Potsdam
Im Herbst 1948 zeichneten sich Bedingungen und Möglichkeiten ab, die materiell-technische Versorgung der volkseigenen Betriebe und die Versorgung ihrer Belegschaften zu verbessern sowie den schwarzen Markt weiter einzuschränken. Mit den „Richtlinien für die Lohngestaltung in den SAG- und volkseigenen Betrieben“, die das Sekretariat der DWK am 20. September 1948 herausgab, wurde eine weitere Voraussetzung dafür geschaffen, daß der auf technisch begründeten Arbeitsnormen basierende Leistungslohn durchgesetzt werden und daß sich die Aktivistenbewegung ausbreiten konnte.
Seit den Sommermonaten 1948 blieb die Steinkohlenförderung unter den im Jahresproduktionsplan vorgesehenen Kennziffern. Das gefährdete die Erfüllung des gesamten Halbjahrplans 1948. Eine Kommission aus Mitarbeitern der DWK sowie Funktionären der SED und des FDGB untersuchte in den Steinkohlenrevieren die Ursachen für den Produktionsrückgang und erarbeitete Vorschläge für deren Beseitigung. Am 9. Oktober 1948 entschieden die Mitglieder der Kommission, daß den Bergleuten durch ein besonderes Beispiel gezeigt werden sollte, welche Möglichkeiten für eine höhere Kohlenförderung bestanden. Sie baten den Hauer Adolf Hennecke, der an dieser Sitzung teilnahm, am 13. Oktober 1948 – dem Tag, an dem ein Jahr zuvor der Befehl Nr.234 erlassen worden war – in der Grube „Karl Liebknecht“ des Werkes „Gottes Segen“ in Lugau/Oelsnitz eine diesen Möglichkeiten entsprechende Hochleistungsschicht zu fahren. Die Bitte wurde an einen Mann gerichtet, der seit Anfang der zwanziger Jahre als Bergmann unter Tage arbeitete, als Mitglied der SPD die Gründung der SED mit vollzogen hatte und aktiv an der Enteignung der Kriegs- und Naziverbrecher beteiligt gewesen war. Adolf Hennecke gehörte der Gewerkschaftsleitung seines Betriebes an und gab als Arbeitsinstrukteur seine reichen Arbeitserfahrungen und -fertigkeiten an Kollegen weiter. Er erfüllte regelmäßig seine Arbeitsnorm mit 150 bis 200 Prozent. Als er der an ihn herangetragenen Bitte zustimmte, war er sich bewußt, damit bei sehr vielen Kollegen auf Unverständnis und Ablehnung zu stoßen. Nach gründlicher Vorbereitung fuhr er trotzdem am 13. Oktober 1948 die Hochleistungsschicht und erfüllte die Arbeitsnorm mit 387 Prozent. Das war das Ergebnis einer wohlüberlegten Kombination von effektiven Arbeitsmethoden, guter Arbeitsorganisation, rationellem Einsatz technischer Hilfsmittel und physischer Anstrengungen des Hauers und seiner Kollegen vor Ort. Diese Hochleistungsschicht war nachvollziehbar und schuf neue Vergleichsmaßstäbe für technisch begründete Normen.
Rundfunk und Presse sorgten für eine rasche, umfassende und wirksame Popularisierung des von Adolf Hennecke gegebenen Beispiels. SED, FDGB und FDJ organisierten eine gründliche Auswertung seiner außerordentlichen Leistung in den Betrieben. Viele Betriebsgruppen der SED, Gewerkschaftsgruppen und FDJ-Gruppen folgten in ihrem Bereich dem Beispiel Henneckes. Die Belegschaften vieler Betriebe führten unmittelbar nach dem 13. Oktober Aktivistenschichten durch. Im November wurde zentral eine Hennecke-Woche organisiert. Die DWK beriet mit zahlreichen Aktivisten, wie die Bewegung verbreitert werden konnte. Der Bundesvorstand des FDGB erklärte auf seiner Bitterfelder Tagung im November 1948 die Gewerkschaften zum Träger der Aktivistenbewegung. Der Zentralrat der FDJ rief zu einem organisierten Berufswettbewerb der Lehrlinge auf.
Der Bergmann Adolf Hennecke bei seiner Hochleistungsschicht im Oelsnitzer Karl-Liebknecht-Schacht, 13. Oktober 1948
Das Echo auf die Tat Adolf Henneckes erwies, daß der Zeitpunkt und das impulsgebende Beispiel gut gewählt worden waren. Immer mehr klassenbewußte Arbeiter, insbesondere Mitglieder der SED, folgten dem aufrüttelnden Beispiel des Hauers aus Lugau/Oelsnitz – trotz der maßlosen Hetzkampagne der Westberliner Sender und obwohl, wie zu erwarten, auch viele Werktätige Hennecke und die seinem Beispiel Folgenden als „Normbrecher“ beschimpften. Zu den Hennecke-Aktivisten gehörten die Hauer Paul Berndt aus dem Freitaler, Franz Franik aus dem Zwickau/Oelsnitzer und Fritz Himpel aus dem Mansfelder Revier, der Maurerpolier Paul Sack von der Bau-Union Stralsund, der erste Aktivist der Deutschen Reichsbahn, Paul Heine, und Franz Striemann, der in der Textilindustrie dazu beitrug, die Aktivistenbewegung voranzubringen. Auf Aktivistenkonferenzen wurden Erfahrungen ausgetauscht. Die Aktivistenbewegung entwickelte sich zu einer Massenbewegung, in der neben den Arbeitern, die regelmäßig ihre Norm übererfüllten, auch Ingenieure und Wissenschaftler ein zunehmendes Gewicht erlangten, die durch ihr Schöpfertum dazu beitrugen, den Produktionsprozeß in den volkseigenen und SAG-Betrieben zu vervollkommnen, neue Erzeugnisse zu entwickeln, Material und Energie einzusparen und die Arbeitsorganisation zu verändern.
Die Aktivistenbewegung verflocht sich mit der Bewegung der Produktionswettbewerbe in und zwischen den volkseigenen und SAG-Betrieben. Eine besondere Rolle spielte der Leistungswettbewerb, der im Dezember 1948 zwischen dem VEB Stahl- und Walzwerk Riesa, dem VEB Eisen- und Stahlwerk Gröditz, dem VEB Hüttenwerk Hennigsdorf und dem VEB Maxhütte Unterwellenborn ausgetragen wurde und an dem 13000 Arbeiter und Ingenieure beteiligt waren. Die Ergebnisse bestanden für den VEB Maxhütte, den Sieger des Wettbewerbs, in einem Anwachsen der bisherigen Monatsleistungen auf 221,6 Prozent, für den VEB Eisen- und Stahlwerk Gröditz auf 220,9 Prozent, für den VEB Hüttenwerk Hennigsdorf auf 184,4 Prozent und für den VEB Stahl- und Walzwerk Riesa auf 138,5 Prozent.
Ein wichtiger Stimulus für die Erhöhung der Arbeitsleistungen war die Einrichtung sogenannter „freier Läden“ und „freier Gaststätten“. Am 3.November 1948 beschloß das Sekretariat der DWK, „freie Läden“ zu eröffnen, in denen die Bevölkerung ohne Abgabe von Lebensmittelmarken oder Bezugsscheinen gegen einen höheren Preis spezielle Nahrungs- und Genußmittel sowie hochwertige Gebrauchsgüter kaufen konnte. Neben den staatlichen „freien Läden“ boten auch staatliche Gaststätten ebenfalls gegen einen höheren Preis markenfreie Speisen an. Im Dezember 1948 wurden die „freien Läden“ und „freien Gaststätten“ zur Staatlichen Handelsorganisation (HO) zusammengefaßt. Ihre Preise wurden so gebildet, daß einerseits der Käufer das Interesse am schwarzen Markt verlor und andererseits für den Verkäufer das riskante Geschäft auf dem schwarzen Markt nicht mehr lohnend war. Außerdem trug all dies mit dazu bei, den auch nach der Währungsreform noch bestehenden Kaufkraftüberhang abzuschöpfen.
Die Preise dieser Einrichtungen waren im November 1948 – bezogen auf das Arbeitseinkommen – noch sehr hoch, konnten aber in den folgenden Monaten schrittweise beträchtlich gesenkt werden.

Die dem Finanzhaushalt zugeführte Akzise aus den Läden und Gaststätten der HO trug wesentlich zu dessen Stabilisierung bei.
Einen wichtigen Beitrag zur Erfüllung des Halbjahrplans 1948, vor allem auch zur Zurückdrängung des schwarzen Marktes, zur Bekämpfung von Wirtschaftssabotage und Kompensationsgeschäften leisteten die staatlichen Kontrollkommissionen und die Volkskontrollausschüsse. Das Schwergewicht der Kontrolltätigkeit verlagerte sich auf die systematische staatliche Kontrolltätigkeit durch die Zentrale Kontrollkommission und die Landeskontrollkommissionen.
Auf Grund von Beschwerden der Bevölkerung führte die Zck im September 1948 in 13 Textilbetrieben im Raum Glauchau-Meerane Untersuchungen durch und deckte schwerwiegende Wirtschaftsverbrechen auf. Ein seit 1945 bestehender illegaler Unternehmerring hatte mit Hilfe korrupter Elemente in der Landesverwaltung Sachsens Textilien und Stoffe im Wert von rund 10 Millionen DM nach Westberlin und in die Westzonen verschoben und größere illegale Warenbestände angelegt. Die Gerichtsverhandlung gegen die Schuldigen fand unter großer Anteilnahme der Öffentlichkeit statt. Die Angeklagten wurden entsprechend der Schwere ihrer Verbrechen zu hohen Strafen verurteilt.
Um Wirtschaftsverbrechen und -vergehen wirkungsvoll verfolgen zu können, erließ die DWK am 23. September 1948 eine Verordnung über die Bestrafung von Verstößen gegen die Wirtschaftsordnung, die zu einem wichtigen Bestandteil des Strafrechts wurde.
Bei der Durchführung des Halbjahrplans 1948 machte sich zunehmend negativ bemerkbar, daß die erfolgte Zentralisierung der leistungsstarken und volkswirtschaftlich bedeutsamen volkseigenen Betriebe nicht von einer entsprechenden Zentralisation in der Zirkulationssphäre begleitet wurde. Das Bewirtschaftungssystem blieb ebenso wie der Großhandel mit Produktionsmitteln und gewerblichen Verbrauchsgütern regionalisiert. Ausgenommen davon waren lediglich der Brennstoff-, der Düngemittel- und der Baustoffhandel. Die zentralen Produktionsverwaltungen verfügten über keinen eigenen Verteilungsapparat. Zunehmend traten Schwierigkeiten bei der Versorgung der ihnen unterstellten volkseigenen Betriebe mit Rohstoffen und Materialien auf, die noch in den Händen der Landesverwaltungen lag. Die DWK bemühte sich nach Kräften, diese zur vorrangigen Versorgung auch der nicht in den Lieferländern angesiedelten volkseigenen Betriebe anzuhalten. Um die Hauptprojekte des Halbjahrplans zu sichern, bildete sie bei ihrer Hauptverwaltung Materialversorgung eine besondere Abteilung, deren Aufgabe es war, die erforderlichen Materialien, Produktionsmittel usw. zu beschaffen.
Der Absatz der von den volkseigenen Betrieben produzierten Waren gestaltete sich ebenfalls kompliziert. Das resultierte vor allem aus der Tatsache, daß in der Zirkulationssphäre das Privatkapital nach wie vor vorherrschte. Hinzu kam, daß der Großhandel überbesetzt war. Die Kapitalisten im Lebensmittel-, im Produktionsmittel- und im gewerblichen Verbrauchsgüterhandel nutzten, obgleich sie unter Kontrolle der demokratischen Verwaltungsorgane standen, alle Möglichkeiten, um einen maximalen Handelsprofit zu realisieren. Das geschah zu Lasten der volkseigenen Betriebe und der werktätigen Bevölkerung. Hierzu stellte der Präsident der Deutschen Zentralverwaltung für Handel und Versorgung, Georg Handke, am 1. Dezember 1948 auf der 5.Vollsitzung der DWK fest: „Bei einem solchen Umfang des Großhandels, der leben und existieren will, ist es doch ganz selbstverständlich, daß er nur leben und existieren kann, wenn er sich eben nicht an die Vorschriften und Bestimmungen hält und, sagen wir das ganz offen, schwarze Geschäfte macht.“ 64
Jungaktivistenkongreß des Landes Sachsen in Zwickau, 21. bis 22. November 1948. Adolf Hennecke spricht
Der zwischen Produktions- und Zirkulationssphäre bestehende Widerspruch und seine negativen Auswirkungen auf die antifaschistisch-demokratischen Verhältnisse veranlaßten die DWK, nach Wegen zu suchen, um die Kontrolltätigkeit der demokratischen Verwaltungsorgane und das Bewirtschaftungssystem effektiver zu gestalten und die volkseigene Industrie zu fördern. Schon die am 1.Juni 1948 erfolgte Gründung der Deutschen Handelsgesellschaft (DHG) als zonale Dachorganisation der in den Ländern wirkenden halbstaatlichen Handelsunternehmen zielte in diese Richtung. Die DWK erarbeitete im Verlauf des Herbstes als weiteren Schritt eine Anordnung über die Verteilung von industriellen und gewerblichen Waren, die am 1. Dezember 1948 beschlossen wurde und am 1.Januar 1949 in Kraft trat.
Die Entwicklung der Industrie im 2. Halbjahr 1948 war nicht nur durch das Anwachsen des Produktionsvolumens, sondern auch durch eine Veränderung in der Erzeugnisstruktur gekennzeichnet. Während 1948 gegenüber 1947 die Industrieproduktion insgesamt um 32,9 Prozent anstieg, erreichten die Grundstoff- und die Leichtindustrie mit 35,1 bzw. 32,3 Prozent ein überdurchschnittliches Wachstum. Die Steigerung in den volkseigenen- und den SAG-Betrieben betrug 36 Prozent, in der Privatindustrie 11 Prozent. Die Arbeitsproduktivität erhöhte sich um 15 Prozent, der Durchschnittslohn um 17,3 Prozent. In der Produktion von Roheisen und Rohstahl sowie in der Schwefelsäureproduktion wurden die Planziele nicht erreicht. Auch bei der Erzeugung landwirtschaftlicher Maschinen gab es Rückstände, was sich auf den beginnenden Aufbau von staatlichen Maschinenausleihstationen negativ auswirkte.
In der Landwirtschaft konnten 1948 – begünstigt auch durch gute klimatische Bedingungen – höhere Erträge als im Jahr zuvor erreicht werden. Die durchschnittlichen Hektarerträge im Gebiet der Ostzone machten nun 70 bis 80 Prozent des Vorkriegsniveaus aus, wobei aber infolge der noch immer geringeren Anbaufläche die Gesamterträge noch stärker zurücklagen. Insgesamt betrug die Agrarproduktion 55 Prozent der der Vorkriegsjahre. Begrenzender Faktor war vor allem die noch geringe Tierhaltung. Doch begann die Stabilisierung der landwirtschaftlichen Erzeugung.
Im Jahre 1948 gelang es allen Widerständen und Schwierigkeiten zum Trotz, das Neubauernbauprogramm in dem durch den Befehl Nr.209 vorgegebenen Umfang durchzuführen. 1948 konnten 36533 Wohnhäuser, 31653 Ställe und 16401 Scheunen errichtet werden, wodurch fast 37000 Neubauern einen Wirtschaftshof erhielten, aus den Notunterkünften herauskamen und mit dem Aufbau einer intensiven Viehwirtschaft beginnen konnten. Angesichts des allgemeinen Baustoffmangels, großer Transportprobleme und des Fehlens von Facharbeitern war dieses umfangreiche Bauprogramm eine hervorragende Leistung.
In einem freien Laden, November 1948
Es hatte vielfach große Überzeugungskraft gekostet, Neubauern zum Bauen zu bewegen. Der Gedanke, neben den die Kraft der Familie fast gänzlich fordernden Feld- und Stallarbeiten auch noch Bauarbeiten bewältigen zu müssen, schreckte viele. Auch ließen sich manche ehemaligen Landarbeiter von den Drohungen ihrer einstigen „Herren“ einschüchtern und wagten es zunächst nicht, die Gutsgebäude anzutasten, um Baumaterial zu gewinnen. Viele Umsiedler wiederum hegten noch immer Hoffnungen auf Rückkehr in die früheren Heimatorte. Trotzdem gelang es, das Bauprogramm zu einer Volksaktion zu entwickeln. Die Endabrechnung ergab, daß die Neubauern 70 Prozent der Ausschachtarbeiten, 40 Prozent der Arbeiten zur Materialgewinnung und 30 Prozent der Anfuhrleistungen und sogar 10 Prozent der eigentlichen Bauarbeiten selbst geleistet hatten.
Neubauernsiedlung in Breitenfeld, Landkreis Leipzig, 1949
Dazu hatte die Gemeinschaftshilfe der VdgB viel beigetragen. Mobilisiert durch die Gewerkschaften, engagierten sich auch Belegschaften von Betrieben für die Bauaufgabe. In Sonderschichten produzierten sie Baumaterialien, so vor allem den dringend benötigten Zement und Schnittholz. Zehntausende Arbeiter und Angestellte beteiligten sich in Feierabend- und Wochenendeinsätzen bei der Baustoffgewinnung und halfen bei der Errichtung von Bauten. Arbeiter der Firma Schott in Jena zum Beispiel bauten 14 Gehöfte auf. An dem von der SED gemeinsam mit den anderen Parteien, den Massenorganisationen und mit Verwaltungsorganen organisierten Solidaritätssonntag in Mecklenburg am 17. Juli 1948 waren fast 16000 Helfer mit Pferdegespannen, LKW und Traktoren im Einsatz. Derartige Aktionen fanden in allen Ländern statt. Mitglieder der Volkssolidarität im Land Brandenburg sammelten 4 Tonnen Nägel, die es infolge der in der Ostzone fehlenden Produktionskapazität so gut wie gar nicht gab. Die FDJ initiierte einen Jugendwettbewerb. FDJler aus dem Land Sachsen übernahmen den Wiederaufbau der im zweiten Weltkrieg zerstörten Ortschaft Adelsdorf im Kreis Großenhain als „Dorf der Jugend“.
Die bis Ende 1948 erbrachten Leistungen förderten die Fundierung der Neubauernstellen. Das Gesicht vieler ehemaliger Gutsdörfer begann sich zu verändern. Initiative und Selbstbewußtsein großer Teile der werktätigen Landbevölkerung wuchsen, und Arbeiter und Bauern kamen sich näher.
Der wirtschaftliche Aufschwung spiegelte sich in der Entwicklung von Import und Export wider. Gegenüber 1947 stieg 1948 der Export der sowjetischen Besatzungszone von 143 Millionen auf 681 Millionen DM und der Import von 55 Millionen auf 202 Millionen DM. Umfangreichere Importe verhinderte die imperialistische Embargopolitik. Durch die Verstärkung des Warenaustausches mit der Sowjetunion, mit Polen und der Tschechoslowakei konnten 1948 vor allem wesentlich mehr Guß- und Walzeisen, Steinkohle und Koks, Schwefel und Mineraldünger importiert werden.
Die wirtschaftlichen Ergebnisse mußten mit zum größten Teil veralteten Maschinen erzielt werden. Es bestanden nur geringe Möglichkeiten zur Erneuerung des Produktionsapparates. Die weitestgehenden Erneuerungs- und Ausbauinvestitionen erfolgten in den SAG-Betrieben. Kennzeichnend für diese Wiederaufbauphase war, daß – volkswirtschaftlich gesehen eine negative Akkumulation stattfand, das heißt, daß mehr verbraucht als erzeugt bzw. ersetzt und neugeschaffen wurde. Das Verhältnis von Verbrauch zu Erzeugung betrug 1948 schätzungsweise 17,2 Milliarden zu 13,8 Milliarden DM.65 Die wirtschaftliche Lage der sowjetischen Besatzungszone blieb schwierig, aber als entscheidend trat hervor, daß sich im Ringen um die Erfüllung des Halbjahrplans 1948 ein deutlicher Um- und Aufschwung Bahn brach.
Schwierige Kursbestimmung in Vorbereitung der 1. Parteikonferenz der SED
Entsprechend einer Entschließung der 13. (27.) Tagung des Parteivorstandes der SED berief das Zentralsekretariat der SED am 27.September 1948 für Anfang Dezember 1948 eine Parteikonferenz ein, an der der Parteivorstand und ein großer Kreis von Delegierten teilnehmen sollten. Nicht nur die Mitglieder der SED, sondern weite Kreise der Bevölkerung der Ostzone sahen der Parteikonferenz gespannt entgegen, erwarteten sie doch eine klärende Antwort auf viele wichtige Fragen, die sie tief bewegten.
Das Zentralsekretariat der SED orientierte darauf, die Beschlüsse der 11. (25.) bis 13. (27.) Tagung des Parteivorstandes zur Grundlage für die Diskussionen auf den Delegiertenkonferenzen zu machen, und formulierte für die in Vorbereitung der Konferenz zu führenden Diskussionen in einem Fragenkatalog inhaltliche Schwerpunkte.
Darin stand „die Aufklärung über die imperialistische Politik der USA“ und über „die führende Rolle der Sowjetunion im Kampfe um Frieden und Fortschritt“ 66 obenan, gefolgt von Problemen der Volksdemokratie und des „Übergangs von der Volksdemokratie zum Sozialismus“ 67, Fragen der „Verschärfung des Klassenkampfes“ 68 und der Entlarvung der „Aktivität der kapitalistischen Kräfte“ 69 in der Ostzone, schließlich die Diskussion von Fragen der wirtschaftlichen bzw. der demokratischen Entwicklung der Ostzone und Parteifragen. Viele Mitglieder der SED äußerten in den Diskussionen ihre Erwartung, daß der direkte Übergang zum Sozialismus auch in der Ostzone auf die Tagesordnung gestellt werde.
Neubauer. Gemälde von Otto Nagel, 1949. Gemäldegalerie Neue Meister, Dresden
Die umfassende Analysetätigkeit, die von der SED geleistet wurde, bestärkte Zentralsekretariat und Parteivorstand jedoch darin, den erreichten objektiven und subjektiven Entwicklungsstand in der Ostzone noch deutlicher vom Entwicklungsstand der volksdemokratischen Staaten abzuheben. Auch waren die Bedingungen bei weitem noch nicht herangereift, die Blockpolitik auf einer sozialistischen Grundlage weiterzuführen. Angesichts der äußeren Bedrohung und Gefährdung durch die imperialistische Politik zur Bildung eines Westblocks und eines Westzonenstaates sowie angesichts der Notwendigkeit, den Kampf um die demokratische Einheit Deutschlands und um die Sicherung des Friedens auf deutschem Boden weiter-zuführen, durfte ein Auseinanderbrechen des Blocks durch Überforderung der Bündnispartner auf keinen Fall riskiert werden. Davon ließ sich, wie Marschall Sokolowski in Gesprächen mit den Vorständen von CDU und LDPD deutlich machte, auch sehr stark die SMAD leiten.
In Vorbereitung der 1. Parteikonferenz, die auf Ende Januar 1949 verschoben wurde, weilten Wilhelm, Pieck, Otto Grotewohl, Fred Oelßner und Walter Ulbricht vom 12. bis zum 24. Dezember 1948 zu Besprechungen mit J.W. Stalin und Mitgliedern des Politbüros der KPdSU(B) in Moskau. Die hier geführten Gespräche, in denen die Lage und die Perspektive der sowjetischen Besatzungszone in ihrem Zusammenhang mit der internationalen Politik gründlich beraten wurden, bekräftigten die Richtigkeit des Kurses auf Festigung und Ausbau der antifaschistisch-demokratischen Verhältnisse. Sie führten aber vor allem zu der Einsicht, daß die Schaffung einer deutschen demokratischen Republik im Rahmen der Ostzone nur als äußerste Reaktion auf die Bildung des Westzonenstaates vollzogen und soweit wie möglich hinausgeschoben werden sollte. Die Sowjetunion unternahm in ihrer Politik – auch was die Berliner Krise betraf – große Anstrengungen um die Westmächte wenigstens zu einem zeitweiligen Aussetzen der Londoner Beschlüsse und zu erneuten Viermächteverhandlungen über die deutsche Frage zu bewegen.
Das Zentralsekretariat der SED hielt es für notwendig, daß Wilhelm Pieck die wichtigsten Ergebnisse der Moskauer Besprechungen in einem Interview mit dem „Neuen Deutschland“ darlegte. Das geschah in sehr akzentuierter Weise, weil eingeschätzt wurde, daß bei Funktionären und Mitgliedern der SED sowie in der Bevölkerung verbreitete Auffassungen korrigiert werden mußten. Viele erwarteten von der Parteikonferenz Beschlüsse oder Orientierungen auf die Vorbereitung zur Bildung eines eigenen Staates, der dem Westzonenstaat notwendigerweise entgegengestellt werden mußte, und die Formulierung in Richtung des Sozialismus zielender Aufgabenstellungen.
Wilhelm Pieck betonte in seinem Interview den unterschiedlichen Entwicklungsstand der volksdemokratischen Staaten und der Ostzone und wandte sich gegen Auffassungen, „daß in der Ostzone bereits die Herrschaft der Arbeiterklasse und damit die Volksdemokratie bestände“.70 Die Frage, ob der deutsche Volksrat die Absicht habe, „für die Ostzone eine selbständige Regierung zu schaffen“ 71, verneinte er und betonte, daß der Deutsche Volksrat seinen Kampf für die Einheit Deutschlands und für einen gerechten Frieden unbeirrt und verstärkt fortsetzen werde.
Ausführlich erläuterte Wilhelm Pieck am 24. Januar 1949 auf der 16. (30.) Tagung des Parteivorstandes das strategische Konzept des Kampfes um demokratische Einheit Deutschlands und Friedenssicherung sowie der Festigung und des Ausbaus der antifaschistisch-demokratischen Ordnung in der Ostzone und setzte sich mit anderen Auffassungen auseinander. In bezug auf sein Interview hob er hervor, daß es notwendig gewesen sei, „etwas geradezubiegen, was in den Ländern und Kreisen vollkommen verbogen wurde, nämlich daß man die Lage vollkommen überschätzte und bereits annahm, wir hätten bereits die Herrschaft der Arbeiterklasse in der Zone“.72 Während das Zentralsekretariat und die SED-Vertreter im Volksrat um die Entwicklung der Zusammenarbeit bemüht seien, werde – so stellte Wilhelm Pieck kritisch fest – in einigen Kreisen und Ländern eine andere Politik betrieben. Darauf hätten die Vertreter der bürgerlichen Parteien zu Recht immer wieder aufmerksam gemacht. In dem von Hermann Matern erstatteten Bericht des Zentralsekretariats wurde kritisch eingeschätzt, daß die mehrmalige Verschiebung der Parteikonferenz zu Schwierigkeiten geführt habe und daß auf den Landeskonferenzen ungenügend die politischen Grundfragen beraten worden seien.
Die 1. Parteikonferenz der SED
Die 1. Parteikonferenz der SED tagte vom 25. bis 28. Januar 1949 im Hause der Deutschen Wirtschaftskommission in Berlin. An ihr nahmen 384 Delegierte teil. Die Anwesenheit von Gästen aus 15 Ländern, darunter die von M.A.Suslow geleitete Delegation der KPdSU, zeugte von der Bedeutung, die dem Kampf der SED in der kommunistischen Weltbewegung zugemessen wurde, und der Beachtung, die er in der internationalen Öffentlichkeit fand. Es referierten Wilhelm Pieck über den Kampf um den Frieden, Otto Grotewohl über die Politik der SED und deren Entwicklung zur Partei neuen Typs und Walter Ulbricht über Probleme der Staats- und Wirtschaftspolitik.
In den Referaten wurde als Generallinie die gemäß den veränderten Bedingungen auf neue Weise hergestellte Verbindung des Kampfes um Frieden und demokratische Einheit Deutschlands mit der Fortführung des revolutionären Prozesses unter der Losung der allseitigen Festigung der antifaschistisch-demokratischen Ordnung begründet. Dabei wurden deren grundlegende Übereinstimmungen mit der volksdemokratischen Ordnung, aber auch die Unterschiede verdeutlicht. Otto Grotewohl betonte aus der Sicht des weltrevolutionären Prozesses und des Kampfes um den Weltfrieden gegen die imperialistische Kriegspolitik besonders die Bedeutung und Rolle, „die ein einheitliches, fortschrittliches, friedliebendes und demokratisches Deutschland in ganz Europa erfüllen kann“, und stellte dazu fest: „Das ist keine taktische, sondern eine strategische Aufgabe unserer Partei.“ 73
Wilhelm Pieck verdeutlichte, daß die Einheit Deutschlands nur „auf einer den Frieden sichernden Grundlage wieder erkämpft werden“ kann. „Die Einheit eines friedlichen Deutschlands ist nur möglich, wenn die monopolistischen Kriegsprovokateure und die militaristischen Junker geschlagen und jeden Einflusses in Deutschland beraubt werden, wie dies in der Ostzone geschehen ist. Solange diese Aufgabe nicht erfüllt ist, kann von einem einheitlichen Deutschland als europäischer Friedensfaktor nicht die Rede sein.“ 74 Mit diesen Ausführungen arbeitete Wilhelm Pieck den Klasseninhalt der nationalen Frage heraus und steckte er zugleich den Rahmen der Verständigungs- und Kompromißbereitschaft der SED, wie er sich aus der entstandenen Lage ergab, ab. Ein Konsens mit der von reaktionären Kräften vertretenen Gegenposition, die Einheit Deutschlands nach dem Muster des westzonalen Weges anzustreben, war ausgeschlossen, denn dies hätte die Preisgabe der antifaschistisch-demokratischen Errungenschaften und den Verzicht auf die aus den Erfahrungen der Geschichte gebotenen und von den Potsdamer Beschlüssen verlangten Friedensgarantien auf deutschem Boden bedeutet. Der Prozeß der Auseinanderentwicklung war bereits weit gediehen. Die demokratische Einheit Deutschlands setzte nunmehr eine Kurskorrektur der Westmächte, deren Verzicht auf die Schaffung des antisowjetischen Westblocks und das Rückgängigmachen der restaurativen Ergebnisse des westzonalen Nachkriegsweges voraus.
In der Entschließung der Parteikonferenz zu den nächsten Aufgaben hieß es dazu:
„Wir fordern die Wiederherstellung der Einheit Deutschlands und die Bildung einer gesamtdeutschen Regierung aus den demokratischen Parteien und Organisationen!
Wir fordern den Abschluß eines Friedensvertrages mit Deutschland und den Abzug der Besatzungstruppen nach Abschluß des Friedensvertrages!
Wir fordern die restlose Ausrottung des Militarismus und Nazismus und den Aufbau eines friedlichen demokratischen Deutschland!
Wir fordern den Aufbau einer deutschen Friedenswirtschaft, die es möglich macht, die materielle Lage des deutschen Volkes zu verbessern und die berechtigten Reparationsforderungen der Opfer der Hitleraggression zu befriedigen!“ 75
1. Parteikonferenz der SED im Haus der DWK in Berlin, 25. bis 28. Januar 1949
Die Ostzone bildete die entscheidende Basis des Kampfes der deutschen Arbeiterklasse und ihrer Verbündeten um demokratische Einheit Deutschlands und Friedenssicherung. In ihr waren bereits wesentliche Grundlagen für den künftigen demokratischen deutschen Friedensstaat in Übereinstimmung mit den Potsdamer Beschlüssen geschaffen worden, die es zu verteidigen und auszubauen galt. „Die Sozialistische Einheitspartei Deutschlands“, hieß es daher in der Entschließung, „steht vor der großen historischen Aufgabe, den demokratischen Neuaufbau in der Ostzone zu festigen und von dieser Basis aus den Kampf für die demokratische Einheit Deutschlands, für den Frieden und für die fortschrittliche Entwicklung zu verstärken“.76
Die Entschließung endete mit der perspektivischen Feststellung: „Vorwärts für die Einheit Deutschlands, für einen gerechten Frieden, für Demokratie und Sozialismus!“ 77 Die Parteikonferenz bekannte sich darin zur Weiterführung des revolutionären Prozesses im Osten Deutschlands unter der Losung der „allseitigen Festigung der antifaschistisch-demokratischen Ordnung“ 78. Gleichzeitig wurde betont, daß die „antifaschistisch-demokratische Ordnung“ in der Ostzone „keine volksdemokratische Ordnung“ 79 sei und daß daher in der Ostzone „nicht unmittelbar zum Aufbau der sozialistischen Gesellschaftsordnung übergegangen“ werden könne.80 Auf der Tagesordnung stehe daher „weder die Frage der Nationalisierung des Grund und Bodens noch die Frage der Beseitigung des kapitalistischen Eigentums …“ 81
Als wichtigste Aufgabe wurde die Durchsetzung der führenden Rolle der Arbeiterklasse auf allen Gebieten genannt. Zugleich forderte die Entschließung „die allseitige Festigung und Entwicklung der Blockpolitik der SED“ 82 Des weiteren wurde darauf orientiert, eine einheitliche Verwaltungsstruktur durchzusetzen und die politische Wirksamkeit der Volksvertretungen zu erhöhen; den volkseigenen Sektor vorrangig weiterzuentwickeln und seine Überlegenheit im ökonomischen Wettbewerb mit dem privatkapitalistischen Sektor zu gewährleisten; die Aktivistenbewegung und den Massenwettbewerb breit zu entfalten; den Aufbau von Maschinenausleihstationen fortzusetzen und diese zu den entscheidenden Stützpunkten der Arbeiterklasse auf dem Lande und ihres Bündnisses mit den werktätigen Bauern zu machen; das allgemeine Bildungs- und Kulturniveau anzuheben, Wissenschaft und Kunst zu fördern, das Bündnis mit den fortschrittlichen Intellektuellen zu festigen und die kulturelle Massenarbeit zu entwickeln. Die Parteikonferenz bekräftigte die vom Ersten Kulturtag der SED entwickelte Orientierung für die Kulturpolitik. Sie bezeichnete es als wichtige Aufgabe der Partei, die Arbeit in den Massenorganisationen zu verstärken.
Einen gewichtigen Platz nahmen in den Referaten und Beratungen der Parteikonferenz die Bestimmung des Platzes der SED in der kommunistischen Weltbewegung, ihre feste Verbundenheit mit der KPdSU und dem Kampf der Völker für Frieden, Demokratie und Sozialismus ein. In der Entschließung hieß es, die SED „erkennt die führende Rolle der Sowjetunion und der KPdSU(B) im Kampf gegen den Imperialismus an und erklärt es zur Pflicht jedes Werktätigen, die sozialistische Sowjetunion mit allen Kräften zu unterstützen“.83 Und in seinem Schlußwort hob Wilhelm Pieck hervor: „Es gab bisher in der Partei wohl keine Veranstaltung, die so vom Geiste des Internationalismus, so vom Geiste des Marxismus-Leninismus durchdrungen war wie diese Konferenz.“ 84
Den unterschiedlichen Kampfbedingungen in Deutschland Rechnung tragend, erklärte die Parteikonferenz ihr Einverständnis mit der organisatorischen Trennung von SED und KPD und mit dem Ausscheiden der 20 Genossen der KPD aus dem Parteivorstand der SED. In einem Manifest „An das gesamte schaffende deutsche Volk“ 85 wandten sich die Delegierten entschieden gegen die imperialistische Politik der Zerreißung Deutschlands, gegen Antisowjetismus und Kriegshetze und riefen zum gemeinsamen Kampf des deutschen Volkes um demokratische -Einheit und gerechten Frieden auf.
Die Parteikonferenz beschloß eine Reihe von Maßnahmen, um die Entwicklung der SED als marxistisch-leninistische Partei zu beschleunigen. Einmütig und ohne Auseinandersetzungen stimmten die Delegierten dem Vorschlag zu, das Prinzip der paritätischen Besetzung der leitenden Funktionen – mit Ausnahme des Vorsitzes der Partei – aufzuheben; sie bestätigten die Bildung und die Aufgaben der Parteikontrollkommissionen und die Schwerpunkte der Schulungsarbeit und stimmten der Einführung einer Kandidatenzeit für neue Mitglieder zu. Beim Parteivorstand wurde zur wirksameren operativen Leitung und zur Erhöhung der Kollektivität der Parteiführung das Politische Büro gebildet, in das neben den beiden Parteivorsitzenden, Wilhelm Pieck und Otto Grotewohl, als weitere Mitglieder Franz Dahlem, Friedrich Ebert, Helmut Lehmann, Paul Merker und Walter Ulbricht und als Kandidaten Anton Ackermann und Karl Steinhoff gewählt wurden.
Mit ihrer Generallinie des allseitigen Ausbaus und der Festigung der antifaschistisch-demokratischen Verhältnisse im Kampf um die demokratische Einheit Deutschlands und um Friedenssicherung gelang es der SED, ihre Politik gemäß der neuen Lage in Deutschland und Europa und der sich daraus ergebenden neuartigen Dialektik von äußeren und inneren Bedingungen, von Nationalem und Internationalem weiterzuentwickeln. Nunmehr bestand diese Dialektik vor allem darin, daß sich der revolutionäre Prozeß im Osten Deutschlands in Abwehr der imperialistischen, friedensfeindlichen Politik des kalten Krieges und der Teilung Deutschlands bzw. in Konfrontation dazu, in Abgrenzung gegenüber der restaurativen Entwicklung in den Westzonen und zugleich als demokratische Alternative dazu vollzog.
Die grundsätzliche Übereinstimmung des weiteren Ausbaus und der Festigung der antifaschistisch-demokratischen Verhältnisse mit den Zielen und Beschlüssen der Antihitlerkoalition wirkte in nicht unbeträchtlichem Maße als ein Faktor der politisch-moralischen Stabilisierung der progressiven gesellschaftlichen Verhältnisse in der Ostzone.
Ganz im Leninschen Sinne hatte die SED eine Generallinie ihrer Politik entwickelt, die es ermöglichte, die sozialistischen Keime und Elemente in den antifaschistisch-demokratischen Verhältnissen zu stärken und weiterzuentwickeln – und zwar auf eine solche Art- und Weise, daß die Arbeiterklasse und ihre Bündnispartner in einem längeren Prozeß, über ihre eigenen Erfahrungen die Notwendigkeit des Aufbaus des Sozialismus zu erkennen vermochten. Das erwies sich auch deshalb als politisch wichtig und für die Stabilisierung der antifaschistisch-demokratischen Verhältnisse sowie für die Weiterführung des sozialen und politischen Bündnisses günstig, weil durchaus noch nicht alle Grundfragen des Übergangs zum Sozialismus zureichend geklärt worden waren. Hierzu gehörten insbesondere die soziale und die politische Perspektive bürgerlicher Schichten und des Mittelstandes.
Mit den Beschlüssen der 1. Parteikonferenz mobilisierte die SED die Arbeiterklasse und ihre Bündnispartner, die Aufgaben des Volkswirtschaftsplans 1949 tatkräftig in Angriff zu nehmen, die antifaschistischdemokratischen Verhältnisse zu festigen, das Ringen um den Frieden und um die demokratische Einheit in Deutschland zu verstärken.
Die Festigung des antifaschistisch-demokratischen Blocks
Unmittelbar nach der 1. Parteikonferenz begann auf Kreiskonferenzen und in Mitgliederversammlungen der Grundorganisationen der SED eine gründliche Auswertung ihrer Beschlüsse. Dabei ging es allenthalben darum, Schlußfolgerungen zu ziehen und entsprechende Maßnahmen festzulegen. Der Parteivorstand schätzte am 10. März 1949 auf seiner 17. (31. Tagung) den von Walter Ulbricht erstatteten Bericht des Politbüros dazu gründlich ein. Er konnte feststellen, daß die von der Konferenz entwickelte Generallinie der Politik der SED „der großen Mehrheit unserer Funktionäre und Mitglieder verständlich geworden“ 86 sei. Zugleich lenkte der Parteivorstand die Aufmerksamkeit auf eine Reihe von Schwächen und Mängeln, die sich bei der Auswertung der Konferenz gezeigt hatten. So würden oftmals die einzelnen Bestandteile des strategischen Konzepts nicht als geschlossenes Ganzes bzw. in ihrer inneren Verbindung miteinander verstanden, vor allem was die Fortsetzung des Kampfes um Einheit und Frieden einerseits und die Orientierung auf die Festigung der demokratischen Ordnung in der Ostzone andererseits anbelange. Der Blockpolitik werde nicht die erforderliche Aufmerksamkeit gewidmet, und es sei versäumt worden, Maßnahmen zu ihrer Entwicklung in den Orten und Kreisen festzule-gen. Die Bedeutung des Bündnisses mit der Intelligenz werde noch nicht allgemein verstanden. Was den Kampf gegen sozialdemokratische Auffassungen sowie gegen offene und versteckte Anhänger der politischen Linie Kurt Schumachers anbelange, so sei dieser nur ungenügend geführt worden.
Im Bericht des Politbüros an die Tagung war darauf verwiesen worden, daß einige Mitglieder offensichtlich „weitergehende Beschlüsse von der Parteikonferenz erwartet“ hätten.87 Auf den Konferenzen und Versammlungen zur Auswertung der Beschlüsse der Parteikonferenz habe es einige Diskussionsredner gegeben, die die Meinung vertraten, daß die „Spaltung Deutschlands als vollzogene Tatsache zur Kenntnis genommen werden müßte und daß man deshalb in der Ostzone sozusagen unmittelbar den Übergang zum Sozialismus verwirklichen könne“.88 „Wir sind demgegenüber der Meinung“, wurde im Bericht des Politbüros hervorgehoben, „daß wir mit allen uns zu Gebote stehenden Mitteln den Kampf um die Einheit Deutschlands weiterführen, d.h., daß wir in der Ostzone eine solche Politik verwirklichen, die in ganz Deutschland realisierbar ist, von der die Mehrheit der Bevölkerung in Deutschland überzeugt werden kann.“ 89
Um diese strategische Linie wirklich zum Allgemeingut aller Mitglieder der SED zu machen und die dabei auftauchenden Fragen zu klären, war eine intensive Arbeit zu leisten. So wurden die Lehrprogramme der Parteischulen gemäß den neuen Erfordernissen und Aufgaben umgestaltet und qualifiziert sowie entsprechend einem Beschluß des Zentralsekretariats vom 29. März 1949 beim Parteivorstand das Marx-Engels-Lenin-Instituts geschaffen und verstärkt grundlegende Werke des Marxismus-Leninismus herausgegeben.
Am 13. und 14. März 1949 führte das Politbüro beim Parteivorstand der SED in Berlin eine staatspolitische Konferenz über die Verwirklichung der Beschlüsse der Parteikonferenz auf dem Gebiet der wirtschaftlichen und staatlichen Verwaltung durch. Walter Ulbricht setzte sich in seinem Referat energisch mit Funktionären des Verwaltungsapparates auseinander, die die Beschlüsse der Parteikonferenz lediglich als Taktik bzw. als Politik des Augenzwinkerns interpretierten und dann doch so weitermachten wie bisher. Mit Nachdruck betonte er, daß eine solche Haltung schädlich sei und nicht geduldet werden dürfe. Otto Grotewohl hob als wichtigsten Aspekt des strategischen Konzepts hervor, daß es gelte, die Politik der SED international in einen weiten Zusammenhang einzuordnen: „Die großen Reichtümer im Westen Deutschlands dürfen nicht in die Hände der ausländischen Imperialisten und Monopolisten und ihrer deutschen Helfershelfer fallen.“ Das müsse unbedingt verhindert werden, „weil davon die Sicherung des Friedens für ganz Deutschland, aber auch für Europa und – das kann man wohl sagen – darüber hinaus für die ganze Welt abhängt“.90 Otto Grotewohl gab außerdem zu bedenken, daß ein ostdeutscher Staat, ohne wirtschaftliches Fundament an Stahl und Eisen, für die entstehende sozialistische Staatengemeinschaft, wirtschaftlich gesehen, auch Belastungen herbeiführen würde.
In seinen weiteren Ausführungen wies Otto Grotewohl darauf hin, daß die schon von der ersten Staatspolitischen Konferenz in Werder im Juli 1948 beschlossene 20prozentige Personaleinsparung im Verwaltungsapparat noch nicht erfolgt und daß der Kampf gegen den Bürokratismus unzureichend geführt worden sei. Er betonte, daß die Beschlüsse dieser Konferenz nach wie vor die grundlegende Orientierung bildeten.
Ausgehend von den durch die Parteikonferenz gestellten Aufgaben, berieten die Konferenzteilnehmer eingehend über Erfahrungen aus der Tätigkeit der Zentralen Kontrollkommission, über eine Reihe von Wirtschaftsgesetzen, über das Vertragssystem zwischen Privatwirtschaft und volkseigenen Betrieben sowie über Grundsätze der Finanzpolitik und Fragen der Verbesserung der Schulungstätigkeit.
FDGB, FDJ, DFD, Kulturbund und andere gesellschaftliche Organisationen, in deren Reihen die SED-Mitglieder aktiv dafür eintraten, begrüßten die Beschlüsse der Parteikonferenz und ergriffen Maßnahmen, um gemäß ihren spezifischen Aufgaben alle ihre Mitglieder für die Verwirklichung dieser Beschlüsse zu gewinnen und zu mobilisieren.
Auch bei den anderen Blockparteien fanden die Beschlüsse der Parteikonferenz der SED einen lebhaften, überwiegend positiven Widerhall. Insbesondere war das von seiten der DBD und der NDPD der Fall, die sich zu einem gewichtigen Faktor der politischen Organisation der Ostzone entwickelten. Die DBD war dabei, in der werktätigen Bauernschaft Fuß zu fassen. Die NDPD erwarb sich vor allem in den städtischen Mittelschichten, unter Angestellten und Teilen der Intelligenz Anerkennung und Einfluß. Die Konstellation der Blockpolitik hatte sich auf diese Weise geändert, der Einfluß der reaktionären Kräfte in der CDU und in der LDPD wurde auch dadurch weiter zurück gedrängt.
Unter dem Vorsitz von Otto Nuschke gewannen in der CDU fortschrittliche Kräfte wie August Bach, Friedrich Burmeister, Hans-Paul Ganter-Gilmans, Gerald Götting, Reinhold Lobedanz und Luitpold Steidle einen maßgeblichen, von der Mehrheit der Mitgliedschaft getragenen Einfluß. Das schlug sich auch in der Stellungnahme des Hauptvorstandes der CDU zu den Beschlüssen der 1. Parteikonferenz nieder, die er bereits am 31.Januar 1949 abgab und in der es hieß: „Die Christlich-Demokratische Union beurteilt die Entscheidungen der Parteikonferenz der SED als eine begrüßenswerte Klärung der politischen Lage in der Ostzone. Ihr Wille, die Arbeit der SED in erster Linie auf die Politik der nationalen Selbsthilfe zu konzentrieren, die Blockarbeit zu aktivieren, mit allen anderen fortschrittlichen, demokratischen Kräften an der Festigung der deutschen Demokratie und der Sicherung ihrer gesetzlichen und rechtlichen Basis zusammenzuarbeiten, und schließlich die Anerkennung des rechtlichen Schutzes und der Betätigungsfreiheit im privaten Sektor der deutschen Wirtschaft sind geeignet, vorhandene Zweifel und entstandene Unruhe zu überwinden und die demokratische Ordnung in der Ostzone im Sinne des Verfassungsentwurfs des Deutschen Volksrates zu festigen.“ 91
Wenn dies auch auf eine eigenwillige Interpretation der Beschlüsse der Parteikonferenz hinauslief: wesentlich war die zum Ausdruck gebrachte Bereitschaft, auf deren Basis mit der SED weiter zusammenzuarbeiten, wie es dem Willen der progressiven Kräfte in den bürgerlichen Parteien, der Interessenlage der überwiegenden Mehrheit ihrer Mitglieder – Mittelständler, Angehörige der Intelligenz und Angestellte – entsprach. Mit dieser Stellungnahme und mit seiner Entschließung vom Dezember 1948 „Für Freundschaft mit der Sowjetunion“ hatte der Hauptvorstand der CDU fünf Markierungspunkte der politischen Position seiner Partei formuliert, die für deren weitere Entwicklung und die Perspektive der Blockpolitik von entscheidender Bedeutung waren: grundsätzliche Zustimmung zu dem von der 1. Parteikonferenz der SED entwickelten wirtschaftspolitischen Konzept und Bereitschaft zur Mitarbeit am Zweijahrplan; Weiterführung der Blockpolitik; Bekenntnis zum Dokument „Verfassung der deutschen demokratischen Republik“ und damit zu einer „über Weimar hinaus“ gehenden gesellschaftlichen und politisch-staatlichen Ordnung; Weiterführung des Kampfes um die demokratische Einheit Deutschlands und um Frieden an der Seite der SED; Freundschaft zur Sowjetunion und damit entschiedene Parteinahme in der weltpolitischen Auseinandersetzung.
In seiner politischen Bedeutung trat dahinter zurück, daß dies alles mit mehr oder weniger ausgeprägten Vorstellungen von einem Mittelweg zwischen „westlichem“ Monopolkapitalismus und „östlichem“ Sozialismus, mit dem Einspruch gegenüber der Führungsrolle der Arbeiterklasse und ihrer Partei sowie mit dem Festhalten an bürgerlich-parlamentarischen Gepflogenheiten verbunden war und daß die fünf politischen Markierungspunkte innerhalb der CDU nicht nur von den reaktionären Kräften, zu deren Wortführer sich der sächsische Landesvorsitzende Hugo Hickmann machte, abgelehnt wurden, sondern auch bei manchen anderen keine volle Unterstützung fanden.
Auch in der LDPD gewannen seit Herbst 1948 die progressiven Kräfte deutlich an Boden, die nicht länger hinnehmen wollten, daß die Interessen von Unternehmern, die nur 0,9 Prozent der Mitgliedschaft ausmachten, den Kurs der Partei maßgeblich beeinflußten. Ihre Ansichten artikulierte Ende 1948 eine von Mitgliedern des Stadtvorstandes Erfurt der LDPD – Angehörigen des Mittelstandes und der Intelligenz sowie Angestellten – abgefaßte „Denkschrift“. Diese enthielt die Forderung nach einem klaren Parteiprogramm, das sich nicht länger der Einsicht verschließt, „daß der Gedanke des Sozialismus im siegreichen Vormarsch ist“.92
Mit der „Erfurter Denkschrift“ wurden bemerkenswerte, nach vorn weisende Positionen bezogen, die das fortschrittliche Potential verdeutlichten, daß unter den kleinbürgerlich-demokratischen, den werktätigen Kräften in der LDPD tatsächlich vorhanden war. Der LDPD-Landesvorstand Thüringen stellte sich hinter die Denkschrift. Einer der Exponenten des rechten Flügels der Partei, Finanzminister Leonhardt Moog, trat als Landesvorsitzender zurück. Sein Nachfolger wurde Hans Loch, unter dem sich in Thüringen die fortschrittlichen Kräfte innerhalb der LDPD durchsetzten.
Auf dem im Februar 1949 veranstalteten 3. Parteitag wurden die tiefgreifenden Wandlungsprozesse deutlich, die die LDPD durchlief. Immer klarer artikulierte sich die Einsicht vieler Liberaldemokraten, daß die antifaschistisch-demokratische Ordnung keine Übergangsordnung zu Verhältnissen darstellte, die denen der Weimarer Republik ähnelten, sondern daß sie zu einer neuen gesellschaftlichen Qualität führte. Die progressiven Kräfte in der Partei, wie Johannes Dieckmann, die diese Einsicht hatten, bestimmten auf dem Parteitag die Richtung der Diskussion um Wirtschaftsfragen, in der die volkseigenen Betriebe anerkannt wurden und die Mitarbeit der Liberaldemokraten an deren Entwicklung Befürwortung fand. Auch die planmäßige Lenkung der Wirtschaft blieb unwidersprochen.
Insgesamt jedoch hinterließ der Parteitag mit seiner starken Hinwendung zu wirtschaftspolitischen Fragen den Eindruck einer gewissen Ratlosigkeit. Die LDPD brauchte eine wirtschaftspolitische Konzeption. Als Bestandteil einer solchen Konzeption konnte schon die Entschlossenheit gelten, an der Lösung der von der SED formulierten volkswirtschaftlichen Aufgaben mitzuwirken. Dazu wurden die Parteimitglieder in einem Parteiaufruf aufgefordert. Daneben machte sich in der LDPD unübersehbar die Tendenz bemerkbar, abzuwarten, wie sich die wirtschaftspolitische Entwicklung im Rahmen des Zweijahrplans konkret vollziehen würde. Die SED sollte zeigen, was sie in wirtschaftspolitischer Hinsicht zu leisten imstande war. Die LDPD sah sich noch „im Wächteramt“.93 Auch hier wirkten unübersehbar Vorstellungen von einem „dritten Weg“. Zu Parteivorsitzenden der LDPD wurden Karl Hamann und Hermann Kastner gewählt, zu ihren Stellvertretern gehörten Hans Loch und Johannes Dieckmann.
Verschiedene führende CDU- und LDPD-Politiker vollzogen den Wandlungsprozeß ihrer Parteien nicht mit, sondern verstanden sich als bürgerlich-parlamentarische Opposition gegenüber der SED und ihrer Politik. Manche gingen noch weiter und fanden sich zu praktischer Gegenarbeit auch im Staatsapparat zusammen.
Von großer Wichtigkeit für die Weiterentwicklung von .CDU und LDPD war die Tätigkeit des DWK-Plenums in neuer Zusammensetzung. Im Plenum und in anderen Organen der DWK waren die Vertreter der mit der SED verbündeten Parteien an Beschlüssen und Entscheidungen beteiligt, die maßgeblich auf dem wirtschaftspolitischen Konzept der SED basierten. Durch ihre Mitgliedschaft im Plenum der DWK in die Pflicht genommen und mitverantwortlich für gefaßte Beschlüsse, sahen sie sich veranlaßt, eine Linie zu vertreten, die im Interesse der Mehrheit der Mitglieder und Anhänger ihrer Parteien lag.
Insgesamt trugen die Beschlüsse der 1. Parteikonferenz und ihre Umsetzung wesentlich dazu bei, die Blockpolitik auf der Grundlage eines breiten sozialen und politischen Bündnisses zu festigen. Die Blockparteien führten auf der Sitzung des zentralen Blockausschusses am 22. Februar 1949 eine umfassende Aussprache über die gemeinsame politische Plattform für die Weiterführung der Blockzusammenarbeit. Walter Ulbricht brachte die Gemeinsamkeiten und Unterschiede, die dabei. Deutlich wurden, auf den Nenner: „Wir verlangen nicht von der LDP, daß sie für den Sozialismus ist, und Sie verlangen von uns nicht, daß wir den Sozialismus aufgeben … Wir sind der Meinung, daß das Wesentliche. Die Festigung der demokratischen Ordnung ist. Wenn darüber zwischen allen Parteien und den Gewerkschaften Übereinstimmung besteht, ist das ein großer Fortschritt.“ 94
Im Ergebnis der Diskussion wurde ein Ausschuß zur Ausarbeitung neuer Blockrichtlinien eingesetzt, der am 3. März 1949 seine Arbeit aufnahm.
Der verstärkte Kampf um die demokratische Einheit Deutschlands und um Friedenssicherung. Das Ringen um die Verwirklichung des Zweijahrplans
Inhaltsverzeichnis
- 1 Der verstärkte Kampf um die demokratische Einheit Deutschlands und um Friedenssicherung. Das Ringen um die Verwirklichung des Zweijahrplans
- 1.1 Das Entstehen einer weltweiten Friedensbewegung gegen die imperialistische Kriegspolitik
- 1.2 Aktivitäten des Deutschen Volksrates für die Verwirklichung des Zweijahrplans. Die Fertigstellung der Verfassung der deutschen demokratischen Republik
- 1.3 Die Aktivisten und Wettbewerbsbewegung im Ringen um die Erfüllung des Volkswirtschaftsplans 1949. Der Aufschwung der volkseigenen Industrie
- 1.4 Die Einführung des Vertragssystems für die privatkapitalistische Industrie und das Handwerk. Die Schaffung eines staatlichen Großhandels
- 1.5 Die Festigung der antifaschistisch-demokratischen Verhältnisse auf dem Lande
- 1.6 Der Ausbau des volkseigenen Sektors in der Landwirtschaft
- 1.7 Neue Erfordernisse im Bereich der Kulturpolitik und die „Kulturverordnung“ der DWK
- 1.8 Alltag nach Überwindung der Hungerjahre. Jugend im Aufbruch
- 1.9 Die Fortführung der Bildungsreform
- 1.10 Freizeitkultur und Künste
Das Entstehen einer weltweiten Friedensbewegung gegen die imperialistische Kriegspolitik
Mit der Verwirklichung der Londoner Beschlüsse, dem weiteren Anheizen der Berliner Krise, den Vorbereitungen für einen „nordatlantischen“ Militärblock und auch bereits für eine Wiederbewaffnung des entstehenden Westzonenstaates sowie mit ihrer offenen Kriegshetze und ihren Kriegsdrohungen gegen die Sowjetunion eskalierten die aggressiven Kräfte des Imperialismus den kalten Krieg. Das führte zu einer schweren Bedrohung und Gefährdung des Weltfriedens.
Mit dem Voranschreiten der imperialistischen Militärblockpläne und der Wiederaufrüstung wurde immer deutlicher, daß es diesen.Kräften nicht um eine „Verteidigung der freien Welt“, nicht nur um die viel beschworene „Eindämmung“, sondern um das „Zurückrollen“ der Sowjetunion und des Sozialismus mittels militärischer Gewalt ging, nicht, wie behauptet wurde, um den Frieden, sondern um die Schaffung einer imperialistisch dominierten und von den USA „befriedeten“ Welt. Der psychologischen Kriegführung des Imperialismus gelang es jedoch in seiner Hemisphäre, breite Bevölkerungskreise darüber zu täuschen und antisowjetisch zu beeinflussen. Dabei wurden Ursachen und Wirkungen oft geschickt vertauscht und sowjetische Reaktionen auf die Politik des kalten Krieges, wie die hinsichtlich der Berliner Krise, militärische und politisch-ideologische Gegenmaßnahmen als Bestätigung von Bedrohungslüge und Totalitarismusdoktrin propagandistisch ausgeschlachtet. Doch so sehr in der internationalen Arena und in Deutschland die Gegensätze aufeinanderprallten und in welch hohem Maße der Imperialismus die internationalen Beziehungen auch nach dem Grundmuster des kalten Krieges gestaltete: die herrschenden Kreise des Imperialismus konnten nicht verhindern, daß auch eine gegenläufige Entwicklungstendenz hervortrat – die Entstehung einer weltweiten antiimperialistischen Friedensbewegung. Die beharrlich auf Verhandlungslösungen drängende Außenpolitik der sozialistischen Länder und die antiimperialistische Friedensbewegung erschwerten den aggressiven Kräften des Imperialismus die Verwirklichung ihrer Pläne erheblich bzw. stellten diese sogar in Frage.
Die Sowjetunion verband die notwendigen Maßnahmen zur Verteidigung des Friedens und zum zuverlässigen militärischen Schutz des Sozialismus mit intensiven Anstrengungen zur Entlarvung der imperialistischen Kriegspläne und mit der Weiterführung ihrer eigenen, auf die Festigung des Friedens gerichteten Außenpolitik. Sie forderte das Verbot der Atomwaffen, die Einschränkung von Rüstungen und die Verringerung von Streitkräften sowie die Lösung strittiger internationaler Fragen auf dem Wege von Verhandlungen. Die Regierungen der volksdemokratischen Länder unterstützten diese Bestrebungen der UdSSR nach Kräften.
Am 9. September 1948 einigten sich die Vertreter der Länder des Brüsseler Paktes, der USA und Kanadas in Washington nach zweimonatigen Verhandlungen in einem Memorandum95 auf die ebenso falsche wie friedensgefährdende These, daß eine „friedliche Koexistenz“ mit der Sowjetunion „unmöglich“ sei. Sie faßten den Beschluß, ein „gemeinsames Verteidigungsbündnis“ zu schaffen und begannen mit den Vorbereitungen für den Abschluß eines Militärpaktes, auf die Bildung der „Nordatlantischen Verteidigungsorganisation“ (NATO).
Das sowjetische Außenministerium gab am 29. Januar 1949 eine Erklärung zur bevorstehenden Errichtung der NATO ab. Darin charakterisierte es diese als einen gegen die Sowjetunion gerichteten, bestehende Verträge verletzenden, aggressiven Militärpakt und als Machtmittel des USA-Imperialismus zur Erlangung der Weltherrschaft. Am 31. März 1949 richtete die Sowjetunion in diesem Sinne ein Memorandum an die künftigen NATO-Mitgliedstaaten. Sie wies darauf hin, daß das Zustandekommen dieses Militärpaktes den Frieden nicht sicherer mache, sondern im Gegenteil die internationale Lage verschärfe und eine Kriegshysterie schüre, „an der alle Arten von Brandstiftern eines neuen Krieges so sehr interessiert sind“.96
Wenn die dänische und die norwegische Regierung daraufhin der sowjetischen Regierung versicherten, sie würden sich keiner Politik anschließen, die aggressive Ziele verfolge, so war das insofern bedeutsam, als dadurch sichtbar wurde, daß es den aggressiven, imperialistischen Kräften nicht unbedingt leicht fallen würde, den NATO-Pakt als Instrument ihrer Politik zu nutzen. Dennoch dominierte diese Politik – und nicht das Selbstverständnis einiger Politiker und der Regierungen kleinerer Mitgliedstaaten wie Norwegen und Dänemark – das Wesen und die Funktion des Paktes in dem von der Sowjetunion charakterisierten Sinne.
Weltweit wuchs der Widerstand gegen die imperialistische Kriegspolitik. Im Februar 1949 warnte der Generalsekretär der Französischen Kommunistischen Partei, Maurice Thorez, vor der drohenden Gefahr eines Krieges gegen die Sowjetunion und erklärte den imperialistischen Kriegsbrandstiftern den entschiedenen Kampf. Die Italienische Kommunistische Partei und andere kommunistische Parteien schlossen sich an. Das Politbüro des Parteivorstandes der SED veröffentlichte am 1. März 1949 die bedeutsame Erklärung „Gegen Aggression – für Unterstützung der Sowjetarmee“, in der es hieß: „Auch das deutsche Volk fühlt sich eng verbunden mit allen Völkern, die die Kriegshetze gegen die Sowjetunion bekämpfen und keinen neuen Krieg wollen. Das deutsche Volk muß sich dabei bewußt sein, daß der Krieg gegen die Sowjetunion in erster Reihe auf deutschem Boden ausgefochten und dabei der Rest von Deutschland zerstört werden würde, der noch vom Hitlerkrieg übergeblieben ist. Die Sowjetunion ist kein Aggressor, sondern die stärkste Friedensmacht der Welt. Das Politbüro der SED ruft deshalb das deutsche Volk auf, sich mit aller Entschiedenheit gegen die Kriegshetze und die Kriegsvorbereitungen der Westmächte gegen die Sowjetunion zur Wehr zu setzen. Im Falle der Aggression muß das deutsche Volk gegen die Aggressoren kämpfen und die Sowjetarmee in der Herbeiführung des Friedens unterstützen.“ 97
Die Delegation zum Weltfriedenskongreß bei ihrer Verabschiedung in Berlin, 20. April 1949. V.I.n.r.: Ella Rumpf, Karl Kleinschmidt, Arnold Zweig und Otto Nuschke (sitzend); Stephan Heymann, Ottomar Geschke, Max Rauer und Alexander Abusch (stehend)
Weltweit entfaltete sich eine antiimperialistische Bewegung für die Erhaltung und Sicherung des Weltfriedens. Bedeutsame Initiativen gingen bereits vom Weltkongreß der Kulturschaffenden aus 46 Ländern aus, der vom 25. bis 28. August 1948 in Wroctaw stattfand und an dem auf Vorschlag des Kulturbundes auch eine dreizehnköpfige deutsche Delegation teilnehmen konnte. Dieser Delegation gehörten so bedeutende Repräsentanten des Kulturlebens der sowjetischen Besatzungszone wie Alexander Abusch, Bertold Brecht, Anna Seghers, Friedrich Wolf, Ernst Legal und andere an. In Presse und Rundfunk sowie in zahlreichen Veranstaltungen wurde umfassend über den Kongreß informiert. Das auf Beschluß des Kongresses gebildete Internationale Verbindungskomitee der Geistesschaffenden zum Schutze des Friedens und die Internationale Demokratische Frauenföderation riefen am 25. Februar 1949 zu einem Weltkongreß der Friedensanhänger auf.
Auch der Deutsche Volksrat machte sich diesen Appell zu eigen. Die 10. Sitzung seines Friedensausschusses am 29. März 1949 diente der Vorbereitung auf den Weltfriedenskongreß. In seinem Referat machte der Vorsitzende der CDU, Otto Nuschke, die Größe der Kriegsgefahr deutlich und stellte dazu fest, daß es ein dringendes Gebot dieses Friedensnotstandes sei, sich – ungeachtet aller weltanschaulichen und politischen Meinungsverschiedenheiten – zum gemeinsamen Kampf für die Abwendung der Kriegsgefahr und die Erhaltung des Friedens auf deutschem Boden zusammenzuschließen. Nach ausführlicher Diskussion wurde eine Resolution angenommen, die die Bedeutung des Weltfriedenskongresses hervorhob und zur Unterstützung der Weltfriedensbewegung aufrief.
Auf dem ersten Weltkongreß der Kämpfer für den Frieden im April 1949 in Paris, der wegen diskriminierender Einreisebeschränkungen durch die französische Regierung mit einer Parallelveranstaltung in Prag stattfand, nahmen Delegierte aus 72 Ländern teil. Die Liste der zwanzigköpfigen Delegation der Ostzone – eine gesamtdeutsche Delegation kam wegen der Kürze der Zeit nicht zustande –, die das deutsche Vorbereitungskomitee dem Organisationskomitee des Weltfriedenskongresses einreichte, wurde von der französischen Regierung auf acht von ihr ausgewählte Delegationsmitglieder reduziert. Danach setzte sich die Delegation der Ostzone aus Alexander Abusch (Kulturbund), Ottomar Geschke (VVN), Stefan Heymann (Deutscher Volksrat), Domprediger Karl Kleinschmidt, Otto Nuschke (Deutscher Volksrat), Max Rauer (katholische Kreise), Ella Rumpf (FDGB) und Arnold Zweig zusammen.
Die Delegierten nahmen die Repräsentanten des anderen, neuen Deutschlands gleichberechtigt in ihre Reihen auf. Der Mitvorsitzende des Deutschen Volksrates, Otto Nuschke, gab vor dem Plenum eine vielbeachtete Erklärung ab, die sich entschieden dagegen wandte, daß der Imperialismus mit der Zerstückelung Deutschlands und der Einbeziehung der Westzonen in den Nordatlantikpakt eine Kriegsbasis auf deutschem Boden gegen die Sowjetunion und die volksdemokratischen Länder schaffen wollte.
Die Delegierten des Weltkongresses appellierten an alle friedliebenden Menschen, sich ungeachtet unterschiedlicher Weltanschauung und unterschiedlicher politischer Standpunkte gegen die Gefahr eines neuen Krieges, für das Verbot der Atombombe, die Reduzierung der Streitkräfte und die Senkung der Rüstungsausgaben sowie für das friedliche Zusammenwirken der Großmächte zusammenzuschließen. Es wurde ein Ständiges Komitee des Weltkongresses der Friedensanhänger gebildet – der spätere Weltfriedensrat. In dem vom Kongreß angenommenen Manifest hieß es: „Wir haben uns auf diesem großen Weltkongreß der Friedensanhänger zusammengefunden und erklären laut und vernehmlich, daß wir uns die Freiheit unserer Anschauung bewahrt haben und daß uns die Kriegspropaganda nicht die Vernunft getrübt hat. Uns ist bekannt, wer das von den Großmächten geschlossene Abkommen zerrissen hat, das die Möglichkeit einer Koexistenz verschiedener sozialer Systeme bestätigte. Die Anstifter des kalten Krieges sind von einfacher Einschüchterung mit einem Kriege zu dessen offener Vorbereitung übergegangen.“ 98
Der zweite Weltgewerkschaftskongreß im Juli 1949 billigte die Beschlüsse des Weltfriedenskongresses und rief seine Mitglieder zum aktiven Friedenskampf auf. In vielen Ländern fanden nationale oder regionale Kongresse von Friedensanhängern statt. Das Informationsbüro kommunistischer Parteien wertete auf seiner Tagung im November 1949 die beim Aufbau einer organisierten Front der Friedenskämpfer erzielten Erfolge und gesammelten Erfahrungen aus und orientierte darauf, daß der Kampf um den Weltfrieden und für den Zusammenschluß aller Kriegsgegner in den Mittelpunkt der Politik kommunistischer Parteien rücken müsse.
Die organisierte Weltfriedensbewegung war in den meisten kapitalistischen Ländern einem großangelegten Kesseltreiben und einer Vielzahl von Unterdrückungsmaßnahmen ausgesetzt. Mit einem ins maßlose gesteigerten politisch-psychologischen Kreuzzug gelang es dem Imperialismus, die Weltfriedensbewegung in den Augen breiter Kreise als kommunistisch abzustempeln und damit zu diffamieren. Das erschwerte es außerordentlich, ein breites, die Grenzen der beiden Lager überbrückendes Friedensbündnis zu realisieren.
Dazu trugen allerdings auch Tendenzen bei, die innerhalb der Friedensbewegung wirkten, wie eine weitgehend undifferenzierte Sicht auf das imperialistische Lager, das bisweilen sogar mit dem Faschismus verglichen wurde, und eine damit verbundene Sprachdiktion, die eher geeignet war, bestimmte bürgerliche Friedenskräfte vor den Kopf zu stoßen, denn sie als Bündnispartner zu gewinnen. Im Zuge der Formalismusdiskussion gegen Schriftsteller wie Dos Passos und andere vorgetragene scharfe Attacken sowie die Form der Austragung der ideologischen Meinungsverschiedenheiten mit dem „Titoismus“ erschwerten ebenfalls eine Verbreiterung der Friedensbewegung. Es machte sich ein Theoriedefizit bemerkbar. So wurden einerseits – von der Unausweichlichkeit imperialistischer Kriege ausgehend – die Möglichkeiten der Friedenserhaltung vielfach skeptisch beurteilt, andererseits zum Eintreten für den Frieden zu gewinnende Kräfte mit dem Verlangen nach einer eindeutigen Parteinahme für das sozialistische Lager überfordert.
In der Ostzone wurde in Presse und Rundfunk über den Weltkongreß ausführlich berichtet. Nach ihrer Rückkehr vermittelten die deutschen Delegierten in Wort und Schrift ihre Eindrücke und Erfahrungen. Der Deutsche Volksrat rief zum Kampf um die Verwirklichung der Beschlüsse des Weltkongresses auf und fand damit ein lebhaftes Echo. Im Mai 1949 nahm ein dreizehnköpfiger Arbeitsausschuß, das Deutsche Komitee der Kämpfer für den Frieden, als Vorläufer des Deutschen Friedensrates seine Arbeit in Berlin auf.
Da die Schaffung eines westzonalen Separatstaates ein unverzichtbarer Bestandteil der imperialistischen Westblock- und Kriegspaktpläne war, wurde der Kampf gegen die Zerreißung Deutschlands zu einem entscheidenden Erfordernis des Kampfes um den Weltfrieden.
Die SED und die mit ihr in der Volkskongreßbewegung vereinten Parteien, Organisationen und politischen Kräfte waren sich der hohen Verantwortung bewußt, die sie im Ringen um die Erhaltung des Weltfriedens trugen. Die gesamte Arbeit des Deutschen Volksrates, seiner Ausschüsse und Unterausschüsse war im Frühjahr und Frühsommer 1949 davon bestimmt, die Gründung des westzonalen Separatstaates nicht als unausweichlich hinzunehmen, sondern alle Kräfte gegen die jenen Kurs steuernden Mächte zu mobilisieren, alles zu tun, um die Gründung des Westzonenstaates, und sei es – wie Wilhelm Koenen auf der 18. (32.) Tagung des Parteivorstandes der SED Anfang Mai 1949 sagte „noch 5 Minuten vor zwölf Uhr“ zu verhindern.99 Das war um so mehr geboten, als nicht nur eine Konferenz des Rates der Außenminister in Paris bevorstand, sondern zugleich auch der westzonale Staatsbildungsprozeß gewissermaßen eine Art Talsohle durchlaufen mußte und „die tatsächliche Ausrufung eines besonderen westdeutschen Staates in Zweifel“ gezogen werden konnte, wie Koenen argumentierte.100
Aktivitäten des Deutschen Volksrates für die Verwirklichung des Zweijahrplans. Die Fertigstellung der Verfassung der deutschen demokratischen Republik
Die Tätigkeit des Deutschen Volksrates, seines Präsidiums und seiner Ausschüsse wurde 1949 weiter verstärkt. All ihre Aktivitäten prägte die von der 1.Parteikonferenz der SED geforderte organische Verbindung des Kampfes um Frieden und demokratische Einheit Deutschlands mit dem Ringen um den Ausbau der Ostzone.
Der Wirtschaftsausschuß und seine Unterausschüsse erarbeiteten Empfehlungen für den Zweijahrplan und beschäftigten sich mit dem Volkswirtschaftsplan 1949 und in diesem Zusammenhang speziell mit der Perspektive der Maschinenbau- und Elektroindustrie, mit der Rolle der technischen Intelligenz sowie mit der Problematik von Leistungslohn und Arbeitsproduktivität. Der Ausschuß erarbeitete und veröffentlichte ein Memorandum „Folgen der Spaltung für die deutsche Wirtschaft“ 101, in dem zugleich die großen Möglichkeiten herausgearbeitet wurden, die sich der deutschen Wirtschaft in einem auf antifaschistisch-demokratischer Grundlage geeinten Deutschland boten.
Der Sozialpolitische Ausschuß befaßte sich mit der Sozialpolitik im Zweijahrplan und speziell mit Leistungslohn und Tarifpolitik, Arbeitslenkung und Sozialversicherung. Ausführlich beschäftigte er sich auch mit der Frage der deutschen Kriegsgefangenen. In einem für den Deutschen Volksrat vorbereiteten Resolutionsentwurf verlieh er dem Bedauern Ausdruck, „daß sich die Hoffnung des deutschen Volkes, bis zum 31.Dezember 1948 den letzten Kriegsgefangenen in der Heimat zu begrüßen, leider nicht erfüllt hat“.102 Den Regierungen der UdSSR und Polens wurde für die Zusicherung gedankt, alle noch auf den Territorien dieser Staaten befindlichen deutschen Kriegsgefangenen bis Jahresende 1949 zu entlassen. Zugleich wurde – da insbesondere von Frankreich viele ehemalige Kriegsgefangene in die Fremdenlegion gepreßt worden waren – auf das „entschiedenste gegen die Verwendung ehemaliger deutscher Kriegsgefangener als Kanonenfutter in-den imperialistischen Kolonialkriegen“ protestiert.103
Der Agrarpolitische Ausschuß befaßte sich mit der Agrarpolitik im Zweijahrplan, speziell mit der Aktivistenbewegung auf dem Lande und mit Problemen des Wald- und Landschaftsschutzes.
Der Rechtsausschuß erarbeitete Grundsätze für die Demokratisierung der Justiz, befaßte sich mit Rechtsfragen in bezug auf die Gleichberechtigung der Frauen und die Gleichstellung von ehelichen und nichtehelichen Kindern und mit der Herabsetzung der Minderjährigkeit.
Der Kulturausschuß verabschiedete die kultur- und schulpolitischen Verfassungsartikel sowie Richtlinien für einen gesamtdeutschen Kulturplan und beschäftigte sich mit dem Bibliotheks- und Verlagswesen in der Ostzone.
Der Verfassungsausschuß wertete 503 Präzisierungs- und Änderungsvorschläge aus, die aus der seit der Vorlage des Verfassungsentwurfs für die deutsche demokratische Republik Ende Oktober 1948 geführten umfassenden Diskussion hervorgegangen waren. In ganz Deutschland, vorwiegend jedoch in der Ostzone, hatten insgesamt mehr als 9000 Versammlungen darüber beraten und rund 15000 zustimmende Resolutionen dazu angenommen. Im Ergebnis der Diskussion, die den Entwurf in seinem Grundgehalt bestätigte, wurden 52 Artikel zum Teil erheblich verändert. „Deutschlands Stimme“, das Wochenblatt der Volkskongreßbewegung, veröffentlichte am 20. März 1949 die geänderten Texte. Der Verfassungsausschuß berichtete am 4. März 1949 dem Präsidium des Deutschen Volksrates über seine Arbeit und reichte die überarbeitete Verfassung ein. Es wurde beschlossen, sie dem Deutschen Volksrat zur Diskussion und Beschlußfassung vorzulegen.
6. Tagung des Deutschen Volksrates im Haus der DWK in Berlin, 18. und 19. März 1949
Für die gesamte Tätigkeit des Deutschen Volksrates wie seiner Ausschüsse war charakteristisch, was Bernhard Göring im Bericht des Sozialpolitischen Ausschusses vor dem Präsidium des Volksrates in die Worte gekleidet hatte: „Wir stützten uns bei unserer Arbeit selbstverständlich in erster Linie auf die Veränderungen, die in der sowjetischen Besatzungszone vor sich gegangen sind. Unsere Entschließungen und Beratungen waren aber darauf abgestellt, auch die Verhältnisse im Westen Deutschlands zu berücksichtigen.“ 104
Der Deutsche Volksrat und seine Ausschüsse wuchsen immer mehr in die Aufgaben und Funktion einer Volksvertretung für die Ostzone hinein – auch wenn sie nicht direkt und unmittelbar gesetzgeberisch tätig werden konnten, sondern nur über die DWK, die Deutsche Verwaltung des Innern und die DZV für Justiz, für Gesundheitswesen und für Volksbildung sowie auch über die Länderregierungen.
Die 6. Tagung des Deutschen Volksrates, die am 18. und 19. März 1949 stattfand, konstatierte den Friedensnotstand, der unter den gegebenen Umständen zugleich ein nationaler Notstand war. Sie bekräftigte das vom Präsidium des Volksrates veröffentlichte Manifest „Schließt Frieden mit Deutschland“, nahm einstimmig den vom Verfassungsausschuß vorgelegten Entwurf für die „Verfassung der deutschen demokratischen Republik“ an und beschloß, diese einem 3. Deutschen Volkskongreß zur Bestätigung vorzulegen. Sie beauftragte das Präsidium, diesen einzuberufen und Wahlen hierfür auszuschreiben.
Wilhelm Pieck begründete das mit den Worten: „Die Maßnahmen der westlichen Besatzungsmächte sind auf die Zerreißung Deutschlands, die Verweigerung eines gerechten Friedensvertrages und auf einen neuen Krieg gerichtet. In Anbetracht der ernsten politischen Lage, die durch diese Maßnahmen herbeigeführt wurde, sehen wir uns zu diesem Vorschlag veranlaßt, den Deutschen Volkskongreß einzuberufen … Der jetzt veröffentlichte Nordatlantikpakt ist ein weiterer verhängnisvoller Schritt auf dem Wege der Teilung der Menschheit in ein Kriegslager und in ein Friedenslager. Es ist die Aufgabe aller demokratisch und sittlich gesinnten Menschen, diese große Katastrophe eines neuen Krieges abzuwenden, und es ist vor allen Dingen die Aufgabe des deutschen Volkes, diese Katastrophe von Deutschland fernzuhalten … Dieser Aufgabe soll auch der Deutsche Volkskongreß dienen. Er soll die großen Arbeiten fortsetzen, die wir bisher durch den Deutschen Volksrat in der Ausarbeitung der Verfassung, mit dem Vorschlag des Friedensmanifestes und im Kampf für die nationale Selbsthilfe geführt haben, und diese Arbeiten auf eine noch höhere Stufe heben.“ 105
Der Deutsche Volksrat unterbreitete zugleich dem Frankfurter Wirtschaftsrat und dem Parlamentarischen Rat in Bonn das Angebot, „mit einer aus 60 Mitgliedern bestehenden Vertretung des Deutschen Volksrates möglichst schon am 6. April 1949 in Braunschweig zusammenzukommen, um über die Herstellung der demokratischen Einheit Deutschlands und den Abschluß eines Friedensvertrages sowie den Abzug der Besatzungstruppen Gespräche zu führen“. 106
Damit bekundete der Deutsche Volksrat auch weiterhin seine Verständigungsbereitschaft und den Willen, die Tür für alternative Möglichkeiten zur deutschen Zweistaatlichkeit solange offen zu halten, wie es nur irgend ging. Wie zuvor ignorierten die westzonalen Gremien auch diesmal die Angebote zu Gesprächen.
Die Aktivisten und Wettbewerbsbewegung im Ringen um die Erfüllung des Volkswirtschaftsplans 1949. Der Aufschwung der volkseigenen Industrie
Nach einer außerordentlich intensiven, sich kompliziert gestaltenden, neue Anforderungen an Information und Methoden stellenden Planungsarbeit konnte am 30. März 1949 der Volkswirtschaftsplan 1949 vom Plenum der DWK beschlossen werden.
Zum erstenmal umfasse der Plan, führte Bruno Leuschner dazu aus, „alle Hauptfragen des Wirtschaftslebens unserer Zone: die industrielle Produktion, die landwirtschaftliche Entwicklung, das Aufforstungsprogramm, den Verkehr sowie das Post- und Fernmeldewesen, die großen Wiederaufbauarbeiten, also die Investitionen, die Arbeitskräfte, die Selbstkostensenkung, den Warenumsatz, das Gesundheitswesen, die kulturelle Entwicklung, die Verteilung der Materialbestände und insbesondere die Verbesserung der Versorgung der Bevölkerung.“ 107
Die DWK hatte die Kennziffern des Volkswirtschaftsplans für 1949 so festgelegt, daß die Produktions- und Versorgungsziele des Zweijahrplans früher, als ursprünglich vorgesehen, erreicht werden konnten. Zugleich setzte der Volkswirtschaftsplan für das Wirtschaftsleben der Ostzone neue inhaltliche Schwerpunkte.
„Bestand bisher die Tendenz, mengenmäßige Erfolge zu erzielen, so muß jetzt“, hob Bruno Leuschner hervor, „das Hauptaugenmerk auf die Herstellung von Qualitätswaren, auf die Entwicklung einer modernen Technik und damit überhaupt des Fortschritts gerichtet sein. Weiter stehen im Mittelpunkt des Plans die Investitionen zur Erweiterung bestehender und zur Schaffung neuer Produktionsanlagen sowie die großen Wiederaufbauarbeiten im Zuge der kulturellen, sozialen und materiellen Verbesserung der Lage der Bevölkerung.“ 108
Natürlich zogen die ökonomischen und technischen Gegebenheiten den Rahmen dafür noch sehr eng. Dennoch war es bedeutsam, daß die volkseigene Industrie auf diese Schwerpunkte ausgerichtet wurde. Sie spiegelten sich in den hauptsächlichen Kennziffern des Volkswirtschaftsplans wider. Im Jahre 1949 sollte in den Industriezweigen folgender Produktionsanstieg erreicht werden (1948 = 100)109:

Die Durchschnittshektarerträge sollten gegenüber 1948 um mindestens 10 Prozent angehoben werden. Investitionen waren in Höhe von 1384 Millionen DM vorgesehen.
Die Verwirklichung dieser angesichts der bestehenden Ausgangsbedingungen anspruchsvollen Planziele hing wesentlich von der Ausbreitung der Aktivisten- und der Wettbewerbsbewegung ab, für die von den Beschlüssen der 1. Parteikonferenz starke Impulse ausgingen. Diese wurden von der ideologisch-propagandistischen Arbeit der SED und der Gewerkschaftsorganisationen, von Presse und Rundfunk aufgenommen und verstärkt.
Im Ergebnis vielfältiger Aktivitäten, begünstigt durch gezielte Veränderungen im Steuersystem und die schrittweise Verbesserung der Versorgung mit Lebensmitteln und industriellen Konsumgütern, nahmen die Aktivisten- und die Wettbewerbsbewegung Massencharakter an. Das wiesen die Konferenz der Hennecke-Aktivisten am 4. und 5. Februar 1949 in Berlin und die zweite Konferenz der Jungaktivisten am 2. und 3. April 1949 in Erfurt eindeutig aus. In Erfurt wurden 1000 junge Arbeiter und Arbeiterinnen mit der Jungaktivistennadel geehrt. Zu diesem Zeitpunkt gab es etwa 20000 junge Aktivisten in den volkseigenen Betrieben, die in 2500 Aktivs vereint waren. daß ein zunehmender Teil der Produktionsarbeiter die bisher geübte Arbeitszurückhaltung aufgab, zeigten die zunehmende Zahl von Arbeitern, die ihre Arbeitsnormen übererfüllten, und die wachsende Bereitschaft, im Leistungslohn zu arbeiten. Es kam zu einem stetigen Anstieg der Produktion.
Luise Ermisch (links), Initiatorin der ersten Qualitätsbrigade im VEB Hallesche Kleiderwerke, 1949
Die Wirtschaftlichkeit der volkseigenen Betriebe verbesserte sich allerdings nur zu einem Teil, weil die Arbeitsnormen in ihrer überwiegenden Mehrheit nicht den dem jeweiligen Arbeitsprozeß zugrunde liegenden Bedingungen entsprachen. So blieb das Arbeitsvermögen in der volkseigenen Industrie unausgeschöpft und stieg die Arbeitsproduktivität langsamer als die Lohnkosten. Außer in der chemischen Industrie erhöhten sich 1949 in der gesamten volkseigenen Industrie die Lohnanteile an der Prokopfleistung der Arbeiter gegenüber 1936 beträchtlich. Um einer weiteren Verschlechterung der Betriebsergebnisse zu begegnen, bemühte sich die Leitung der volkseigenen Industrie verstärkt um die Einführung technisch begründeter Arbeitsnormen. Dem kamen fortgeschrittene Arbeiter durch eine freiwillige Erhöhung ihrer Normen entgegen. Auf einer Ende Juni 1949 in Zwickau abgehaltenen Konferenz von Aktivisten aus dem Bergbau forderte der Hauer Alfred Baumann seine Kollegen auf, die überholten Arbeitsnormen aus eigenem Antrieb heraufzusetzen. Er selbst veränderte seine Arbeitsnorm und leitete damit eine Bewegung der freiwilligen Normerhöhung ein.
Im 1. Halbjahr 1949 wurde die Entwicklung der volkseigenen Industrie zunehmend dadurch beeinträchtigt, daß das Qualitätsniveau eines erheblichen Teils industrieller Produkte nicht den Qualitätsstandards entsprach. Dies führte zu einem Rückgang des Absatzes, wachsenden Selbstkosten, sinkenden Gewinnen und zu Schwierigkeiten, sich auf dem Außenmarkt zu plazieren. Die DWK, ihre industriellen Hauptverwaltungen sowie die Leitungen volkseigener Betriebe verstärkten ihre Anstrengungen, der ungenügenden Qualität von Erzeugnissen entgegenzuwirken, und in den Belegschaften wuchs unter dem Einfluß der SED- und der Gewerkschaftsorganisationen der Wille, Produkte herzustellen, die den allgemeinen Qualitätsnormen entsprachen.
Ein Beispiel dafür gaben die Halleschen Kleiderwerke, deren Erzeugnisse bis Ende 1948 nur zu 42 Prozent erster Wahl waren und zu 16 Prozent in den Ausschuß wanderten. Der neuberufene Direktor und die Betriebsgewerkschaftsleitung regten einen innerbetrieblichen Wettbewerb zur Verbesserung der Erzeugnisqualität an, der bald Früchte trug. Angeregt durch einen Artikel in der Zeitschrift „Die Wirtschaft“, in dem über die Arbeit einer von dem sowjetischen Neuerer A. S. Tschutkich gebildeten Qualitätsbrigade berichtet wurde, beschlossen die Teilnehmer der Belegschaftsvollversammlung in den Halleschen Kleiderwerken, eine ebensolche Brigade zu gründen. Sie legten fest, welche Aufgaben die in diese Brigade Delegierten zu lösen hatten. Am 6. Juli 1949 nahm unter Leitung der Einrichterin Luise Ermisch die Qualitätsbrigade ihre Arbeit auf, die mit ihren hervorragenden Ergebnissen im ganzen Betrieb Schule machte. Der Anteil von Erzeugnissen mit dem Gütezeichen „Erste Wahl“ stieg auf 96 Prozent. Die Selbstkosten des Betriebes sanken im 1. Halbjahr um 10 Prozent. Das wurde zum Auftakt einer Qualitätsbewegung in der volkseigenen Industrie, die schon 1949 erste Erfolge erzielte.
Die Aktion „Max braucht Wasser“ FDJ-Brigaden beim Bau einer Wasserleitung für die Maxhütte in Unterwellenborn, Ende 1948
Wie die Hennecke- so bewirkte auch die Qualitätsbewegung eine qualitativ höhere Stufe der ökonomischen Initiative in der volkseigenen Industrie. 1949 unterbreitete ein zunehmender Kreis von Arbeitern Vorschläge für eine bessere Organisation der Arbeit und für technisch-technologische Veränderungen. Sie trugen damit zur Erhöhung der Arbeitsproduktivität in ihren Betrieben bei. Arbeiter und Angestellte gaben Anregungen zur Einsparung von Material, zur Vervollkommnung eingeführter und zur Aufnahme neuer Erzeugnisse in die Produktion. Arbeiter des Stahl- und Walzwerkes Riesa zum Beispiel reichten im Zeitraum Januar bis Juni 1949 125 realisierbare Vorschläge bei der Werkleitung ein. Das Funkwerk Neuhaus erhielt durch 12 betriebliche Verbesserungsvorschläge die Möglichkeit, auf Lieferungen aus den Westzonen zu verzichten. Einer von diesen Vorschlägen erbrachte die jährliche Einsparung von 14000 D-Mark (West). In den Leunawerken wurden im 1. Halbjahr 1949 252 Verbesserungsvorschläge eingereicht und im gesamten Jahr 1949 insgesamt 388 Hennecke-Aktivisten ausgezeichnet.
Die Fortschritte beim Aufbau des Leitungs- und Planungssystems der volkseigenen Betriebe gründeten sich zunehmend auf das Mitwirken von Arbeitern in den Betriebsplanungsausschüssen, auf kollektive Beratungen, die 1949 in den Betrieben und Abteilungen in einem größeren Umfang stattfanden. Eine zentrale Bedeutung für den Zweijahrplan kam dem Wettbewerb der Stahlwerker zu, der von April bis Juni 1949 unter der Losung „Mehr Stahl bedeutet mehr Brot“ durchgeführt wurde, nachdem zuvor wesentliche Produktionsvoraussetzungen geschaffen worden waren. Für die Maxhütte Unterwellenborn beispielsweise mußte eine Wasserleitung von der Saale zur Hütte gebaut werden. Ende Dezember 1948 hatte deshalb der Zentralrat der FDJ zur Aktion „Max braucht Wasser“ aufgerufen. Mitglieder der FDJ, insbesondere junge Arbeiter, Studenten und Schüler, waren diesem Aufruf gefolgt. Obwohl die Arbeitsbedingungen sehr schwer waren, konnte durch ihren Fleiß bereits nach 90 Tagen das Wasser zur Maxhütte gepumpt werden. Das Stahlwerk Gröditz war Anfang 1949 noch eine Trümmerwüste. An fünf Sonntagen folgten 10000 Helfer aus den umliegenden Kreisen dem Aufruf der Volksausschüsse, um im Stahlwerk die für den Wiederaufbau erforderlichen Bedingungen zu schaffen.
Erfüllung des Zweijahrplans. Vor der Einweihung einer Werkhalle bei Bergmann-Borsig in Berlin-Wilhelmsruh am Vorabend des 1. Mai 1949
Im Ergebnis der vereinten Anstrengungen von SED, FDGB und FDJ standen im Juli 1949 insgesamt 2695 Betriebe der Ostzone mit einer halben Million Beschäftigten im Wettbewerb. Der FDJ gelang es, bei immer mehr Jugendlichen die Bereitschaft zu einem engagierten Einsatz an Brennpunkten des demokratischen Neuaufbaus zu wecken. Diese zeigte sich seit Sommer 1949 auch beim beschleunigten Bau der Talsperren von Cranzahl und Sosa, die notwendig wurden, um 50000 Menschen im Erzgebirge mit Trinkwasser zu versorgen.
Die Ausbreitung der Aktivisten- und der Wettbewerbsbewegung, andere Masseninitiativen und das zunehmende Engagement der Werktätigen für die Verwirklichung des Volkswirtschaftsplans 1949 zeitigten bedeutsame volkswirtschaftliche Ergebnisse und gehörten zu den Hauptquellen für einen beträchtlichen Produktionsaufschwung in der, volkseigenen Industrie. Eine andere Hauptquelle war die bessere Nutzung der vorhandenen Kapazitäten auf der Grundlage einer kontinuierlicheren und umfangreicheren Versorgung der verarbeitenden Industrie mit Energie, Roh- und Hilfsstoffen. Hierfür gewann das ansteigende Roh- und Hilfsstoffaufkommen aus dem Außenhandel zunehmendes Gewicht.
Es war vor allem die metallverarbeitende Industrie, die an der besseren Materialversorgung partizipierte und 1949 ihre Produktion besonders zügig erweiterte. Die Produktion in der elektrotechnischen Industrie und im Maschinenbau wuchs überdurchschnittlich, während der Produktionszuwachs der feinmechanisch-optischen Industrie relativ niedrig blieb. Dabei war aber zu beachten, daß die elektrotechnische und die feinmechanisch-optische Industrie bereits 1949 einen höheren Produktionsstand als den von 1936 erreichten, während der Maschinenbau noch deutlich darunter blieb. In der Leichtindustrie waren es die Konfektionsbetriebe, die Firmen der Ledergewinnung und -verarbeitung, die Betriebe der Zellstoff-, Papier- und Papierverarbeitungsindustrie, die das Wachstum des Industriebereiches bestimmten. Die stabilere Versorgung der Industrie mit Elektroenergie, Roh- und Hilfsstoffen resultierte insbesondere aus dem Produktionsanstieg in der Brennstoffindustrie, in der Metallurgie, in der chemischen und der Baustoffindustrie. Er war möglich geworden, weil die vorhandenen Produktionskapazitäten weitgehend ausgenutzt und weil vornehmlich in der Metallurgie und in der Grundstoffchemie Produktionsanlagen wiederhergestellt worden waren.
Dabei zeigten sich schon erste Züge einer Erneuerung des Produktionsapparates. Ein Beispiel dafür war die schwarzmetallurgische Industrie. Die Hauptverwaltung Metallurgie bei der DWK hatte, den Bedürfnissen der Wirtschaft entsprechend, für alle bestehenden und wiederaufzubauenden Eisen- und Stahlwerke ein abgestimmtes Produktionssortiment vorgegeben und danach die technische Anlage der Produktionsstätten konzipiert. Um den Aufbau der schwarzmetallurgischen Produktionskapazitäten zu erleichtern, überließ die SMAD verschiedenen Werken Walzwerkanlagen, die demontiert, aber noch nicht abtransportiert worden waren. Im Stahl- und Walzwerk Kirchmöser kam ein Walzwerk für feinen Stahl und Draht zum Einsatz, das vor dem zweiten Weltkrieg zu den modernsten Anlagen seiner Art gehörte.
Weitreichend waren auch die Erneuerungsprozesse im Braunkohlenbergbau. Hier wurde, um das Niveau der Förderung und der Briketterzeugung zu sichern, im Laufe des Jahres 1949 mit dem Neuaufschluß von acht Tagebauen, der Erweiterung der Kapazitäten einer gleichen Anzahl von Brikettfabriken und mit den Vorarbeiten für die Neuanlage von weiteren 13 Tagebauen und für den Neubau von Brikettfabriken begonnen. Diese Vorhaben bedurften der wissenschaftlich-technischen Vorbereitung, und diese wiederum erforderte, die Forschung und Entwicklung im Industriezweig auf eine umfassende Weise zu planen und zu organisieren. Um die dafür notwendigen Voraussetzungen zu schaffen, berief der Leiter der Hauptverwaltung Kohle bei der DWK, Gustav Sobottka, im Mai 1949 eine Konferenz von Wissenschaftlern, Ingenieuren, Betriebsfunktionären und Aktivisten ein, auf der der Erkenntnisstand hinsichtlich der Erkundung, der Gewinnung, der Verarbeitung und der Veredlung von Stein- und Braunkohle festgestellt und die länger- und kurzfristigen wissenschaftlich-technischen Aufgaben für den Industriezweig erörtert wurden. Im Ergebnis der Konferenz konnte ein Forschungs- und Entwicklungsprogramm für den Industriezweig für 1949 abgeschlossen werden. Zu den Themen, die mit besonderer Gründlichkeit bearbeitet wurden, gehörten Untersuchungen zur Bestimmung der Qualität der in der Ostzone vorhandenen Braunkohlenvorkommen und die von Erich Rammler und Georg Bilkenroth betriebenen Forschungen zur Entwicklung eines hüttenfähigen Braunkohlenkokses.
Erster Abstich im Stahlwerk Hennigsdorf. Februar 1948
Die große Aufmerksamkeit, die die Hauptverwaltung Kohle der wissenschaftlich-technischen Arbeit widmete, war Ausdruck für das Bestreben der DWK, die Forschung und Entwicklung in der Ostzone auf die Erfordernisse der Volkswirtschaft auszurichten. Ihre Hauptabteilung Wissenschaft und Technik hatte schon Ende 1948 einen „Forschungsplan für 1949“ erarbeitet, in dem die volkswirtschaftlich wichtigsten Forschungs- und Entwicklungsthemen, die dafür im Haushaltsplan der Hauptverwaltung einzusetzenden finanziellen Mittel, die ausführenden Forschungs- und Entwicklungsstellen und die für den Abschluß der Arbeiten festgesetzten Termine enthalten waren. Im Laufe des Jahres 1949 erfaßte die Hauptabteilung 261 Forschungs- und Entwicklungsstellen mit 2867 Beschäftigten.
Die Anzahl der in der Ostzone zu dieser Zeit tätigen Zentren der wissenschaftlich-technischen Arbeit lag allerdings weit höher. Hauptarbeitsfeld für die Ingenieure und Wissenschaftler war die Rekonstruktion von Erzeugnissen der Fertigungsindustrie. 1949 kam es auch schon zu einer Reihe von Neuentwicklungen in der metallverarbeitenden Industrie, die für den Export bzw. für die Ausstattung der eigenen Industrie mit Produktionsmitteln bedeutsam waren. Dazu gehörten die Neukonstruktion von Turbinen sowie die Entwicklung eines neuen Drehmaschinentyps, der über lastschaltbare Hauptantriebe verfügte, die eine mehrfach höhere Schnittgeschwindigkeit zuließen und dessen Maschinengestelle ein besseres Schwingungsverhalten aufwiesen. Dieser Maschinentyp gestattete den Einsatz von Hartmetallwerkzeugen.
Die Ausbreitung und Höherentwicklung der Aktivisten- und der Wettbewerbsbewegung, die planmäßige, sich verbessernde Organisation und Leitung der volkseigenen Industrie, gezielte wissenschaftlich-technische Arbeit, die bessere Materialbereitstellung und Kapazitätsausnutzung sowie der Aus- und Neubau von Produktionsstätten – all das und andere Faktoren führten im Laufe des 1. Halbjahres 1949 zu einem beachtlichen Produktionsaufschwung. Es zeichnete sich deutlich ab, daß die anspruchsvollen Ziele des Volkswirtschaftsplans 1949 erreicht und zum Teil beträchtlich überboten werden konnten.
Die ersten ökonomischen und technischen Fortschritte der volkseigenen Industrie spiegelten sich auf der Leipziger Frühjahrsmesse 1949 deutlich wider. 1734 volkseigene Betriebe zeigten ihre besten Erzeugnisse. Sie belegten 34 Prozent der Ausstellungsfläche, das waren 15 Prozent mehr als im Frühjahr 1948. Zu den repräsentativsten Ständen gehörte der des VEB Carl Zeiss Jena, der 12 Neuheiten und 100 verschiedene Geräte und Typen zeigte. Neben den volkseigenen Betrieben leisteten auch privatkapitalistische Firmen und Handwerker einen Beitrag zu dem positiven Bild, das die Frühjahrsmesse 1949 von der Wirtschaft der Ostzone bot.
Gegenüber dem Vorjahr hatte sich die Zahl der ausländischen Aussteller verdoppelt. 1949 unterhielten 101 ausländische bzw. westzonale Firmen Stände auf der Messe, obwohl die Teilnahme der letzteren starken westalliierten Restriktionen unterlag. Den Unternehmen der Ostzone gelang es, Aufträge im Werte von 32 Millionen Dollar – gegenüber 9,5 Millionen Dollar im Vorjahr – mit ausländischen Firmen abzuschließen.
An dem erweiterten Exportgeschäft waren vornehmlich der Maschinenbau, insbesondere der Textilmaschinenbau, die feinmechanisch-optische Industrie, die elektrotechnische Industrie, die Textil- und Bekleidungsindustrie sowie die Glas- und keramische Industrie beteiligt. Die Exportverträge wurden mit Firmen aus 34 Ländern, darunter UdSSR, USA, Großbritannien, Kanada und China, unterzeichnet. Im abschließenden Bericht des Messeamtes konnte – wenngleich offensichtlich etwas überhöht – festgestellt werden: „Das Gesamtergebnis der Leipziger Messe im Frühjahr 1949 war volkswirtschaftlich ausgezeichnet … Die von den Ausstellern erbrachten Muster und Modelle haben Anerkennung bei der Käuferschaft gefunden, sie waren zum Teil so beachtlich, daß die Auslandseinkäufer weit mehr disponierten, als sie ursprünglich vorgesehen hatten.“ 110
Die sich verändernden Hauptrichtungen des Außenhandels der sowjetischen Besatzungszone traten 1949 deutlich hervor. Das Volumen des Außenhandels mit den Ländern des entstehenden sozialistischen Weltsystems stieg auf insgesamt 55,2 Prozent des Gesamtaußenhandelsvolumens und davon das des Außenhandels mit der Sowjetunion auf 32,1 Prozent an.
Die Einführung des Vertragssystems für die privatkapitalistische Industrie und das Handwerk. Die Schaffung eines staatlichen Großhandels
Die Aufgaben des Zweijahrplans ließen sich nur bewältigen, wenn neben dem steigenden Leistungsvermögen der volkseigenen Wirtschaft auch das Potential der privatkapitalistischen Unternehmen und das der Handwerksbetriebe ausgeschöpft wurden. Das verlangte von den demokratischen Verwaltungsorganen gegenüber der privaten Wirtschaft eine Politik, die einerseits die unternehmerische Initiative förderte und auf die volkswirtschaftlichen Erfordernisse ausrichtete und andererseits die Entwicklung des Privatkapitals so lenkte, daß sie den Fortgang der antifaschistisch-demokratischen Umgestaltung nicht gefährdete. Für eine solche komplizierte Politik waren 1948 noch nicht alle Bedingungen gegeben. Das wirtschaftspolitische und -rechtliche Instrumentarium, das die Unternehmerinitiative anzuregen vermochte, war nicht hinreichend ausgebildet. Vornehmlich seit der Mitte des Jahres 1948 zeigten sich im Wirtschaftsleben der Ostzone Erscheinungen, die in der Unternehmerschaft den Eindruck entstehen ließen, daß die das privatkapitalistische Eigentum begrenzende Komponente in der Wirtschaftspolitik dominiere. Im Gefolge der Währungsreform hatten eine größere Anzahl von ökonomisch ohnehin instabilen Firmen, zumeist Nachkriegsgründungen oder kaufmännisch mangelhaft geführte Unternehmen, ihre Geschäftstätigkeit einstellen müssen. Ohne die tatsächlichen Ursachen zu bedenken, die zum Ende dieser Firmen geführt hatten, wurde das ebenso als Anzeichen für das vermeintlich zu erwartende Ende des privatkapitalistischen Eigentums genommen wie die strengere Kontrolle der Geschäftstätigkeit privater Firmen, der Bewegung der von ihnen produzierten und gehandelten Waren und die strafrechtliche Verfolgung von Vergehen gegen die verschärften Bewirtschaftungsbestimmungen. Viele Unternehmer sahen in alldem nicht das Bemühen der Verwaltungsorgane um eine gerechte Verteilung der Konsumgüter, sondern einen Angriff auf das privatkapitalistische Eigentum schlechthin. Da es nicht einfach war, zu unterscheiden, ob Unternehmer aus bestimmten, einmaligen Umständen bzw. geschäftlichen Zwängen gegen die wirtschaftsrechtlichen Bestimmungen verstießen oder ob sie damit das Ziel verfolgten, ihre ökonomische Position zur Störung des demokratischen Wirtschaftsaufbaus zu nutzen, kam es neben gerechten Urteilen durch die Justiz verschiedentlich auch zu Entscheidungen, die dem Sachverhalt nicht angemessen waren.
Die Zweifel und Vorbehalte in der Unternehmerschaft wurden aber vor allem dadurch verstärkt, daß die Wirtschaftspraxis noch nicht generell mit den Erklärungen der SED und der DWK zur Stellung der privatkapitalistischen Wirtschaft übereinstimmte. Noch immer wurden den meisten Privatunternehmen der Umfang und das Sortiment des zu Produzierenden von den Wirtschaftsverwaltungen vorgegeben. Oftmals erteilten diese die Produktionsauflagen nach formalen Gesichtspunkten und beachteten die tatsächlichen Produktionsbedingungen der Privatbetriebe ungenügend. Das System der Produktionsauflagen entsprach insgesamt nicht mehr den volkswirtschaftlichen Gesamtbedingungen und begrenzte – das wurde seit der Währungsreform immer deutlicher – die unternehmerische Initiative. Die auf Grund der alliierten Vereinbarungen bestehende Steuerordnung veranlagte die Einkommen von Privatkapitalisten nicht nur unangemessen hoch, sondern berücksichtigte die soziale Differenzierung innerhalb der kapitalistischen Unternehmerschaft zu wenig. Die Einkommen kleiner Kapitalisten wurden im Verhältnis zu denen der anderen höher besteuert. Dieses Steuersystem beeinträchtigte die geschäftliche Aktivität vieler Unternehmer.
Die erklärten Gegner des gesellschaftlichen Veränderungsprozesses in der Ostzone ließen nichts unversucht, um kleine und mittlere Kapitalisten in ihren Zweifeln an der Aufrichtigkeit der von der SED und der DWK gegenüber der privaten Wirtschaft eingenommenen positiven Haltung zu bestärken und sie zu einer offenen Ablehnung der Wirtschaftspolitik zu veranlassen. Dabei zogen sie, um ihre Argumente glaubhafter zu machen, demagogische Vergleiche zu Maßnahmen, durch die in einigen volksdemokratischen Staaten die kapitalistische Wirtschaft eingeschränkt wurde. Nicht wenige Unternehmer entfremdeten sich von den antifaschistisch-demokratischen Verhältnissen.
Nachdem mit einer am 1. Januar 1949 in Kraft getretenen Steuerreform die von Kapitalisten und Handwerkern zu entrichtende Einkommensteuer insgesamt niedriger veranschlagt worden war – für geringere Einkommen um durchschnittlich 35 Prozent –, empfahl die SED – ausgehend von den Beschlüssen ihrer 1. Parteikonferenz –, auch die Beziehungen zwischen den volkseigenen und genossenschaftlichen Industrie- bzw. Handelsbetrieben auf der einen Seite und den privatkapitalistischen und Handwerksbetrieben auf der anderen zu kommerzialisieren. Nach der Parteikonferenz setzte die DWK die Arbeit an Grundsätzen zur Gestaltung der Beziehungen zwischen der Privatindustrie und dem Wirtschaftsplan fort. Im März 1949 legte sie dem Politbüro der SED einen Vorschlag für deren Regelung „auf der Basis von Verträgen“ 111 vor, wobei sie als grundlegende Voraussetzung für die Einführung eines solchen Vertragssystems die Vergesellschaftung des Großhandels nannte.
Auf der dem Volkswirtschaftsplan für das Jahr 1949 gewidmeten Vollversammlung der DWK am 30. und 31.März 1949 gab Bruno Leuschner eine ausführliche Begründung des Vorschlags für das Vertragssystem. Vertreter von CDU, LDPD und NDPD befürworteten die vorgeschlagene Regelung und gaben verschiedene Hinweise dazu.
Die Einführung des Vertragssystems wurde mit der notwendigen sozialökonomischen Umgestaltung der Zirkulationssphäre verbunden. Staatliche Großhandelszentralen für Kraftstoffe, für Mineralöle und für Holz nahmen ihre Arbeit auf. Die Bildung entsprechender Einrichtungen für Kohle, Papier, Textilien und Metallerzeugnisse stand unmittelbar bevor. Großhandelszentralen für Baustoffe und Maschinenbauerzeugnisse wurden vorbereitet. Darüber hinaus mußten staatliche Organe zur Lenkung des Vertragssystems geschaffen werden.
Mitte Mai 1949 konnte das Sekretariat der DWK die Arbeiten an der „Anordnung über die Regelung der Vertragsbeziehungen zwischen privaten Betrieben und volkseigenen sowie genossenschaftlichen Organisationen“ abschließen. Am 18. Mai 1949 wurde diese Anordnung vom DWK-Sekretariat erlassen. Sie verfügte, daß die Beziehungen zwischen den privaten Betrieben und den volkseigenen bzw. genossenschaftlichen Unternehmen durch Verträge über die Erzeugung und Lieferung von Waren geregelt werden. Der Umfang der abgeschlossenen Verträge mußte im Rahmen der Kontrollziffern liegen, die in den bestätigten Produktionsplänen der Länder festgehalten waren. Auf Grundlage der abgeschlossenen Verträge sollte die Versorgung der privaten Unternehmen mit Roh- und Brennstoffen sowie mit anderen Materialien aus den Kontingenten erfolgen, die den Ländern von der DWK zugewiesen wurden. Darüber hinaus kamen Anteile an örtlichen Rohstoffen und Materialien in Betracht.
Die Verträge wurden von den im Sommer 1949 in den Ländern gebildeten Staatlichen Vertragskontoren registriert. Da in der Anordnung vom 18. März 1949 nicht ausdrücklich festgehalten war, daß auch jene Unternehmer, die keinen Vertragspartner fanden, im Rahmen des Bewirtschaftungsystems weiterproduzieren konnten, wurde in der Unternehmerschaft befürchtet, die Betriebe ohne einen Vertrag würden künftig von der Rohstoff- und Energieversorgung ausgeschlossen werden und damit zur Geschäftsaufgabe gezwungen sein.
Insbesondere die LDPD machte auf dieses Problem und auf die Gefahr eines sektiererischen Umgangs mit der Anordnung vom 18. Mai 1949 durch demokratische Verwaltungsorgane aufmerksam. Das Sekretariat der DWK reagierte umgehend. Es erließ am 12. August eine Durchführungsbestimmung zur Anordnung vom 18.Mai 1949, in der bestätigt wurde, „daß private Betriebe auch ohne Abschluß und Vorlage von Verträgen … nach eigenem Ermessen produzieren dürfen, sofern die bestehenden Bewirtschaftungsvorschriften und Herstellungsverbote beachtet werden“.112 Das DWK-Sekretariat erklärte es für unzulässig, Betrieben eine Produktion zu untersagen, nur weil sie keinen Vertrag vorweisen könnten. Auch durfte diesen Betrieben nicht der Bezug von Energie, von Brennstoffen und von allgemeinem Gewerbebedarf verwehrt werden. Des weiteren erklärte die Durchführungsbestimmung es für unstatthaft, den Verkauf von Waren, die ohne Vertrag hergestellt wurden und nicht der planmäßigen Verteilung unterlagen, einzuschränken und zu behindern.
Die Lenkungsfunktion des Vertragssystems wurde durch neue kredit- und steuerpolitische Bestimmungen ergänzt. Anfang 1949 leitete die DWK eine Kreditreform ein. Sie gab den staatlichen Kreditbanken die Mittel in die Hand, um die privaten Unternehmer zur Mobilisierung ihrer Eigenmittel anzuhalten. Der kurzfristige Kredit, der nur ausgereicht wurde, wenn der Bewerber den Nachweis erbracht hatte, daß er über keine andere Finanzierungsmöglichkeit verfügte, wurde zu einem Instrument, um der unkontrollierten Entwicklung der privatkapitalistischen Wirtschaft wirksam zu begegnen. In die gleiche Richtung wirkte die von der Deutschen Investitionsbank geübte Praxis, an private Unternehmer nur dann einen langfristigen Kredit zu vergeben, wenn diese ihre Eigenmittel vollständig ausgeschöpft hatten. 1949 erhielt allerdings nur ein kleiner Kreis privatkapitalistischer Unternehmer langfristige Kredite.
Das neugestaltete Steuersystem stimulierte die Unternehmer zur Erhöhung der Produktion. Zugleich setzte es der Akkumulation des Kapitals Grenzen und regte darüber hinaus dazu an, das Betriebskapital zu ungunsten der Revenue zu erweitern. Von Gewicht war auch, daß durch das neue Steuersystem eine Umwandlung der außerordentlich schwer zu kontrollierenden Kapitalgesellschaften in Offene Handelsgesellschaften (OHG) gefördert wurde.
Die positiven Wirkungen, die das Vertragssystem und die reformierte Steuerordnung auf die ökonomische Lage privater Industrieunternehmen auszuüben begannen und die die Haltung der SED und der DWK zur Privatwirtschaft in der Praxis bekräftigten, trugen dazu bei, in der Unternehmerschaft Besorgnisse über ihre ökonomische Zukunft zu zerstreuen und die vielfach entstandene Entfremdung von Kapitalisten gegenüber den antifaschistisch-demokratischen Verhältnissen abzubauen. Spannungen, die in den bündnispolitischen Beziehungen zwischen der Arbeiterklasse und einem Teil der Kapitalisten im Vorjahr eingetreten waren, lösten sich allmählich.
Die Bindung der Handwerksbetriebe, deren Leistungen für das Jahr 1949 mit ca. 500 Millionen DM veranschlagt waren, an den Volkswirtschaftsplan erfolgte ebenfalls über das Vertragssystem. Die Betriebe des produzierenden Handwerks schlossen mit volkseigenen Industrie- bzw. Handelsbetrieben sowie mit Genossenschaften über die jeweils für diese zu erbringenden Leistungen Verträge ab und erhielten auf deren Grundlage Materialzuteilungen. Die Einbeziehung des Handwerks, das bisher in den Wirtschaftsplänen unberücksichtigt geblieben war, in das Vertragssystem war für die Handwerker ein großer Fortschritt. Der Materialbedarf des Handwerks ließ sich allerdings vorerst nur zu einem kleinen Teil befriedigen.
Die Klärung der Beziehungen zwischen dem Handwerk und dem Wirtschaftsplan setzte, da die sozialökonomische Struktur des Handwerks in der sowjetischen Besatzungszone nicht eindeutig war, eine genaue Bestimmung des Handwerksbetriebes voraus. In die Handwerksrolle hatten – traditionell bedingt – nicht nur einfache Warenproduzenten Aufnahme gefunden, sondern auch privatkapitalistische Unternehmer, die damit die für das Handwerk vorhandenen Vorteile ebenfalls in Anspruch nahmen. Kapitalisten dominierten in den Handwerkskammern und in den Genossenschaften des Handwerks. Von den 302000 in der Handwerksrolle verzeichneten Betrieben hatten 4 Prozent eine Belegschaft von mehr als zehn Beschäftigten. Die Eigentümer dieser kapitalistisch geführten Betriebe stellten 21 Prozent der Obermeister auf Kreisebene und 39 Prozent der Landesobermeister. Sie nutzten ihr ökonomisches Übergewicht, um das Handwerk und seine Genossenschaften nach Gesichtspunkten zu lenken, die nicht mit den Interessen der kleinen Handwerksmeister übereinstimmten.
Ermuntert durch die Fortschritte in der antifaschistisch-demokratischen Umwälzung, regten sich in der Handwerkerschaft immer stärker die Kräfte, die mit der dominierenden Stellung der kapitalistischen Unternehmer in den Organisationen des Handwerks unzufrieden waren. Es waren vor allem die kleinen Handwerksmeister, die sich durch die unter der Flagge des Handwerks segelnden kapitalistischen Unternehmen in ihren Interessen benachteiligt sahen. Ihre Forderungen wurden von der Parteiführung der SED und von der NDPD, die sich seit ihrer Gründung der Handwerkerschaft besonders zugewandt hatte, aufgegriffen. Das Sekretariat der DWK setzte am 10. Juni 1949 die „Anordnung über die Förderung der Initiative des Handwerks zur Entwicklung der Friedenswirtschaft und zur Verbesserung der Versorgung der Bevölkerung mit Massenbedarfsgütern“ 113 in Kraft. Den Kernpunkt dieser Anordnung bildete die Differenzierung zwischen dem Handwerk und der privatkapitalistischen Industrie. In der Anordnung hieß es: „Als Handwerksbetriebe gelten Betriebe, die außer Lehrlingen nicht mehr als 10 Personen beschäftigen.“ 114 In der Durchführungsbestimmung hierzu wurde angewiesen, daß die nicht mehr als Handwerksbetriebe geltenden Unternehmen aus der Handwerksrolle zu streichen sind und künftig von den Industrie- und Handelskammern vertreten werden.
Die kapitalistischen Unternehmer, die bisher die Vorteile des Handwerkerstandes und ihrer exponierten Stellung in den Handwerkerorganisationen genossen hatten, machten gegen diese Anordnung der DWK auf vielfältige Weise, jedoch vergeblich Front. Es gelang, den Einfluß der Unternehmer auf das Handwerk zu beseitigen, wenngleich sich das Herauslösen der Unternehmen mit mehr als zehn Beschäftigten noch bis Ende 1949 hinzog. Die Tatsache, daß die Partei der Arbeiterklasse und die demokratischen Verwaltungsorgane bei all dem die speziellen Interessen der Handwerker beachteten und unterstützten, beeinflußte die politische Stimmung in der Handwerkerschaft positiv.
Die Festigung der antifaschistisch-demokratischen Verhältnisse auf dem Lande
Nachdem durch eine gute Ernte bereits 1948 eine Stabilisierung eingetreten war, setzte im ersten Jahr des Zweijahrplans ein rascher Anstieg der landwirtschaftlichen Produktion ein. Das zeigte sich vor allem an der Zunahme der Viehbestände. Die Rinderbestände wuchsen gegenüber 1948 um 15 Prozent, die Schweinebestände um 65 Prozent. Ende 1949 wurden bei Rindern 140 und bei Schweinen 180 Prozent des Bestandes von 1945/46 erreicht. Insgesamt machte die landwirtschaftliche Produktion nun 65 Prozent des Vorkriegsstandes aus. Die meisten werktätigen Bauern hatten an diesem Aufschwung teil und kamen wirtschaftlich voran.
Zugleich war nicht zu übersehen, daß sich im Dorf widerspruchsvolle Prozesse vollzogen. Trotz staatlicher Förderung der werktätigen Bauern und Unterstützung der neuen Bodenbesitzer kam auf der Basis der einfachen und – bei den Großbauern – der kapitalistischen Warenproduktion wieder stärker ein sozialer und sozialökonomischer Differenzierungsprozeß in Gang. Es entstand die Gefahr, daß die reichen Bauern noch reicher wurden und daß die wirtschaftsschwachen Bauern immer mehr in Abhängigkeit von ihnen gerieten. Bei zahlreichen Neubauernstellen häufte sich der Besitzerwechsel. In Brandenburg und Mecklenburg gab es Neubauernstellen, die – von Inventar entblößt – entweder gar nicht mehr oder nur sehr schwer besetzt werden konnten. In Mecklenburg waren das 1949 fast 900 von insgesamt 76000 Stellen. Die Situation in den Neubauerndörfern war einerseits dadurch gekennzeichnet, daß ungefähr ein Viertel der Wirtschaften noch instabil waren. Etwa jedem zweiten Neubauern fehlten Pflug, Egge und Wagen. 20 Prozent der Höfe besaßen keine eigenen Spannkräfte. Andererseits signalisierte nicht zuletzt eine Landkonzentration die beginnende Entwicklung von Neubauern zu Besitzern mittelbäuerlicher Höfe. Bei der Bodenreform vielfach schon recht groß angelegte Höfe waren zum Teil bereits über die 10-Hektar-Grenze hinausgewachsen. In Mecklenburg betraf das jede vierte Neubauernstelle. Es gab sogar fast 1000 Neubauern, die mehr als 15 Hektar bewirtschafteten.
Viele Großbauern hatten die Vorteile, die ihnen die antifaschistisch-demokratische Entwicklung bot, genutzt und durch eine Intensivierung der Agrarproduktion ihre ökonomische Position im Dorf gefestigt. Nicht wenige von ihnen hatten sich durch Schwarzmarktgeschäfte bereichert. Die großbäuerlichen Betriebe waren in der Regel am besten mit Traktoren und Landmaschinen sowie mit leistungsfähigem Vieh ausgestattet. 11000 mecklenburgische Großbauern mit einem Besitz von durchschnittlich mehr als 35 Hektar landwirtschaftlicher Nutzfläche bewirtschafteten Ende 1948 28,7 Prozent des Ackerlandes, besaßen aber 32 Prozent der Pferde, 37,3 Prozent der Kühe, 30,7 Prozent der Schweine, 43,4 Prozent der Traktoren und 36,6 Prozent der Dreschmaschinen. In den Händen von Großbauern konzentrierten sich Saatgutvermehrung und Herdbuchzucht. Viele Neubauern, aber auch Altbauern waren gezwungen, sich von Großbauern Maschinen und Geräte auszuleihen. Dafür mußten sie entweder mit landwirtschaftlichen Produkten „bezahlen“ oder in den Großbauernwirtschaften arbeiten. Eine wesentliche Quelle der ökonomischen Macht der Großbauern bestand in der Ausbeutung von Lohnarbeitern. Etwa ein Drittel der nahezu 850000 Landarbeiter in der privaten Landwirtschaft war in Wirtschaften von über 20 Hektar tätig. Saisonarbeitskräfte, vielfach Umsiedlerfrauen, arbeiteten häufig nur für Kost und Logis. Wegen des Überangebots an Arbeitskräften, nicht zuletzt aber auch, weil sie politisch nur schwach organisiert waren, vermochten es die Landarbeiter meist nicht, sich gegen die verstärkte Ausbeutung zu wehren und ihre elementaren Lebensrechte zu verteidigen. In Mecklenburg zum Beispiel gehörte nur jeder fünfte ständige Landarbeiter der Gewerkschaft an.
Unterkunft eines mecklenburgisichen Landarbeiters beim Großbauern, 1948
Saisonarbeitskräfte, vielfach Umsiedlerfrauen, arbeiteten häufig nur für Kost und Logis. Wegen des Überangebots an Arbeitskräften, nicht zuletzt aber auch, weil sie politisch nur schwach organisiert waren, vermochten es die Landarbeiter meist nicht, sich gegen die verstärkte Ausbeutung zu wehren und ihre elementaren Lebensrechte zu verteidigen. In Mecklenburg zum Beispiel gehörte nur jeder fünfte ständige Landarbeiter der Gewerkschaft an.
Die meisten Bauern – Großbauern nicht ausgenommen – kamen loyal ihren Ablieferungspflichten nach. Ein Teil entzog sich jedoch diesen Verpflichtungen sowie den staatlichen Auflagen für den Anbau und für die Viehhaltung. Derartige Verhaltensweisen resultierten aus dem Denken privater Warenproduzenten, waren aber vielfach auch Ausdruck des Kampfes kapitalistischer Kräfte gegen die zentrale Wirtschaftsplanung. Immer mehr Großbauern suchten ihre wirtschaftliche Stärke in politischen Einfluß umzusetzen. Ihre ablehnende Haltung zur gesellschaftlichen Führungsrolle der Arbeiterklasse bzw. ihrer revolutionären Partei, die sich bei einigen bis zu offener Feindschaft steigerte, versuchten sie auf die Masse der Bauern zu übertragen. Reaktionäre Kräfte auf dem Lande verstärkten ihre Angriffe auf die neue gesellschaftliche Ordnung, während die Masse der Bauern ihre Interessen enger mit dieser verbanden und die Zielsetzungen des Zweijahrplans unterstützten.
Die SED präzisierte ihre Bündnispolitik gemäß den neuen Bedingungen. Hatte bislang, dem Charakter der antifaschistisch-demokratischen Umwälzung entsprechend, das Zusammengehen mit der gesamten Bauernschaft im Vordergrund gestanden, so ging es jetzt vor allem um ein engeres Bündnis mit den werktätigen Bauern. Dazu war es erforderlich, den volkseigenen Sektor in der Landwirtschaft auszubauen und die Positionen der werktätigen Bauern so zu stärken, daß sie im Dorf auch wirtschaftlich bestimmend wurden und sich aus der ökonomischen Abhängigkeit von Großbauern lösten. Zugleich mußten der erweiterten kapitalistischen Reproduktion Grenzen gesetzt und der politische Einfluß der Großbauern im Dorf zurückgedrängt werden. Deren ökonomische Potenzen wurden allerdings für die Erfüllung der hohen Produktionsziele des Zweijahrplans auch weiterhin benötigt. Zudem blieb die Einbeziehung der Großbauern in den antiimperialistischen Kampf eine notwendige politische Aufgabe. In Entgegnung auf Gerüchte, die durch reaktionäre Kräfte in Umlauf gesetzt wurden, hatte Otto Grotewohl auf der 1. Parteikonferenz im Januar 1949 erklärt, „daß die SED keine Durchführung einer zweiten Bodenreform beabsichtigt. Die Großbauern, die ihre Verpflichtungen für die Abgabe an die Städte erfüllen und ihren Acker ordnungsgemäß bestellen, haben keinen Grund, ihrer Lage und ihrer Eigentumsrechte wegen beunruhigt zu sein.“ 115
Ende 1948 bzw. nach der 1. Parteikonferenz der SED 1949 wurden eine Reihe von Maßnahmen ergriffen, um die präzisierte bündnispolitische Konzeption durchzusetzen: stufenweise Einführung der die Großbauern stärker belastenden Hektarveranlagung zur Pflichtablieferung tierischer Erzeugnisse; Erlaß von vier Fünfteln der Kreditschuld der Neubauern zum Ausgleich der durch die Währungsreform 1948 eingetretenen Belastungen; Subventionierung des Düngemittelkaufs und der Inanspruchnahme von MAS-Leistungen durch werktätige Bauern und vor allem durch Kleinbauern; Herabsetzung der Pflichtbeiträge der Klein- und Mittelbauern zur Sozialversicherung und Änderung der Steuerformen zu ihren Gunsten. Hinzu kamen verstärkte Anstrengungen, bei der Differenzierung des Pflichtablieferungssolls die Leistungskraft der großbäuerlichen Höfe real einzuschätzen und stärker die Interessen der Klein- bzw. der Neubauern zu berücksichtigen.
Bei den Wahlen zu den Vorständen der VdgB Mitte 1949 wurde Wert darauf gelegt, daß Großbauern nicht wieder in die Vorstände gewählt wurden. Schritte zum Zusammenschluß der in der Regel von den kapitalkräftigeren Bauern beherrschten Spezialgenossenschaften zu einheitlichen Dorfgenossenschaften zielten darauf, Klein- und Mittelbauern mehr Einfluß zu verschaffen. Zunehmendes Gewicht bei der Stärkung der progressiven Kräfte im Dorf erlangte das Wirken der DBD.
Die wichtigste Maßnahme zur wirtschaftlichen Stabilisierung der Neubauernhöfe war die Fortsetzung des Neubauernbauprogramms. Bis zum 1.Januar 1950 entstanden durch Um- und Neubauten insgesamt 54596 Wohngebäude, 59324 Stallungen und 36343 Scheunen. Damit war etwa ein Drittel des Baubedarfs gedeckt. Günstigere wirtschaftliche Voraussetzungen ermöglichten in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen bereits einen Abschluß der konzentrierten Bauaktion, während in Brandenburg und Mecklenburg noch eine Vielzahl weiterer Gehöfte gebaut werden mußten.
Der Ausbau des volkseigenen Sektors in der Landwirtschaft
Wenige Wochen nach der 1. Parteikonferenz, am 19. und 20. Februar 1949, fand eine Bauernkonferenz der SED in Halle statt. 400 Mitglieder der SED, vor allem Bauern und Landarbeiter, aber auch Mitarbeiter von Verwaltungsorganen berieten die Entwicklung der Landwirtschaft im Zweijahrplan. Im Mittelpunkt standen die Errichtung der Maschinenausleihstationen (MAS), die Reorganisierung der Verwaltung der Güter und die Zusammenfassung der ländlichen Genossenschaften unterschiedlichen Typs in einheitlichen Dorfgenossenschaften. Auch wurde der Erlaß eines Landarbeiterschutzgesetzes erörtert.
Die wichtigste Maßnahme zur Festigung der antifaschistisch-demokratischen Verhältnisse auf dem Lande war die Schaffung der MAS, die im Herbst 1948 begonnen hatte. Die Maschinenausleihstellen und Maschinenhöfe der VdgB hatten den gespannlosen bzw. anspannarmen bäuerlichen Kleinbetrieben und Neubauernhöfen nur geringe Produktionshilfe geben können. Die Traktoren und Landmaschinen, die sie von den bei der Bodenreform aufgeteilten Gutsbetrieben übernommen hatten, waren überaltert und sehr reparaturanfällig. Auch mangelte es diesen genossenschaftlichen Einrichtungen an Reparaturkapazitäten, und es fehlten technische Kräfte. Vielfach waren die Ausleihstellen vor allem von wirtschaftsstarken Bauern genutzt worden, weil diese die Mittel und die Fachkenntnisse besaßen, entliehene Maschinen zu reparieren und einzusetzen.
Die MAS unterschieden sich grundsätzlich von den Maschinenausleihstellen der VdgB. Sie waren volkseigene Betriebe – zunächst allerdings mit einem genossenschaftlichen Fondsanteil – mit der Aufgabe, auf vertraglicher Basis Feldarbeiten in den bäuerlichen Wirtschaften auszuführen. Sie wirkten als Stützpunkte der Arbeiterklasse auf dem Lande zur ökonomischen Fundierung des Bündnisses mit den werktätigen Bauern. Bei ihrer Bildung nutzte die SED Erfahrungen des sozialistischen Aufbaus in der UdSSR. Die Konzentration der neuen Traktoren und Landmaschinen in volkseigenen Betrieben und ihr planvoller Einsatz waren die effektivste Form, sie den werktätigen Bauern nutzbar zu machen. Ein Verkauf an Privatbetriebe wäre den kapitalistischen Kräften zugute gekommen und hätte die Abhängigkeitsverhältnisse im Dorf vergrößert.
Die MAS übernahmen die Traktoren und Landmaschinen der VdgB und die Reparaturwerkstätten der ländlichen Genossenschaften. Die UdSSR lieferte für die Erstausstattung der MAS 1000 Traktoren mit Anhängegeräten sowie 540 LKW und außerdem noch Walzstahl für die Traktorenproduktion. Dies trug wesentlich dazu bei, den Gedanken der deutsch-sowjetischen Freundschaft unter den Bauern, in den Dörfern und Gemeinden zu verbreiten. Die Traktoren und Landmaschinen trafen noch während der Frühjahrsbestellung ein und wurden feierlich übergeben.
Über eine Kundgebung am Malchiner Bahnhof am 4. April 1949 berichtete die mecklenburgische „Landes-Zeitung“: „Gegen 13 Uhr drückte die Rangierlok die ersten Waggons an die Rampe. Sofort waren diese von einer großen Anzahl Interessierter, voran unsere Jugend, umgeben. 97 Traktoren vom Typ ‚Universal 2‘ kamen hier an, von denen 11 für den Kreis Malchin bestimmt waren. Es wurden gleichzeitig Werkzeugkisten geliefert, in denen sich Spezialwerkzeuge für die Traktoren befanden. Je ein Scheinwerfer vorn und hinten ermöglichen eine Nachtarbeit der Traktoren. Bei der Notwendigkeit, die Frühjahrsbestellung so schnell wie möglich zu beenden, ist dies von besonderem Vorteil. ‚Wir helfen den deutschen Bauern‘ war in großen Buchstaben auf den Traktoren zu lesen. Die Arbeiter der Wladimir-Werke bei Moskau bekunden so ihre brüderliche Verbundenheit mit den werktätigen Bauern unserer Zone. Landwirtschaftsminister Genosse Quandt sprach Worte des aufrichtigen Dankes an die sowjetischen Arbeiter und an die Besatzungsbehörden für die erwiesene Hilfe. Den Traktoristen und Leitern der MAS legte er ans Herz, die Traktoren wie den eigenen Augapfel zu hüten und sie auf das beste zu pflegen, damit sie für die Bauernschaft und das ganze deutsche Volk eine nutzbringende Arbeit verrichten können. Major Artozejew von der Kreiskommandantur übergab dem Genossen Quandt die Traktoren und brachte zum Ausdruck, daß der Dank des deutschen Volkes für diese Hilfe einzig und allein im verstärkten Kampf für den Frieden bestehen könne. Nach seinen Worten erklang die Internationale, die von den Versammelten spontan angestimmt wurde … Jung und alt fand sich bereit, um den ersten Traktor, welcher auf den Namen Hennecke getauft war, von der Rampe zu schieben.“ 116
Traktoren aus der Sowjetunion treffen auf dem Bahnhof Frankfurt an der Oder ein, 1949
Im Mai 1949 kamen die ersten Traktoren aus eigener Produktion in die MAS. Bis Jahresende gelangten 754 Traktoren – 50 Prozent mehr als geplant – aus den Traktorenwerken Brandenburg, Nordhausen und Zwickau zum Einsatz.
Die MAS wurden mit der Kraft der Arbeiterklasse errichtet. Industriebetriebe und Verwaltungen übernahmen Patenschaften. Die Schweriner Industriewerke (heute Klement-Gottwald-Werke) zum Beispiel stellten für die MAS Wendelstorf den Anschluß an das elektrische Versorgungsnetz her und bauten Unterkünfte für die Traktoristen. Für Thüringen ist bezeugt, daß ein Viertel der Bauleistungen der Patenschaftshilfe zu verdanken war. Die SED gewann klassenbewußte Industriearbeiter dafür, in den MAS zu arbeiten, und sie entsandte Leitungskader zum Aufbau der Stationen aufs Land. Dem Aufruf des Zentralrats der FDJ „FDJler auf die Traktoren“ folgten im Frühjahr 1949 bereits über 6000 Jugendliche – junge Arbeiter aus volkseigenen Betrieben und Jugendliche aus den Dörfern, darunter auch zahlreiche Mädchen. Ein Drittel aller MAS-Angehörigen waren Jugendliche. Nach dem Beispiel der volkseigenen Industrie entwickelte sich schon während der Frühjahrsbestellung eine Wettbewerbsbewegung. Die neuen Traktoren spornten viele Jugendliche zu Aktivistenleistungen an. Anläßlich des 1. Mai 1949 wurden die ersten Jungaktivisten der MAS ausgezeichnet, unter ihnen Margarete Müller von der MAS Salow im Kreis Neubrandenburg. Bruno Kiesler von der MAS Köckte im Kreis Gardelegen führte im Herbst 1949 die Gerätekopplung bei der Bodenbearbeitung ein. Ende 1949 gab es in den MAS bereits 766 anerkannte Aktivisten.
Die Errichtung der MAS fand auf dem Lande zunächst nicht nur Zustimmung. Viele Bauern strebten nach der Anschaffung von Pferden und von Maschinen für den Pferdezug. Überkommene Vorstellungen von einem vollwertigen Bauernhof spielten dabei ebenso eine Rolle wie der bäuerliche Eigentumssinn. Manche meinten auch, die Technisierung sei für eine Leistungssteigerung nicht notwendig und Traktorenarbeit sei auf ihren kleinen Flächen unrentabel. Reaktionäre Elemente versuchten, diese Vorurteile mit dem Argument, die MAS brächten die Bauern in staatliche Abhängigkeit, noch zu verstärken. Auch wurde suggeriert, die MAS würden der Kollektivierung der Landwirtschaft dienen, wobei diese im Sinne antisowjetischer Hetze als eine gegen die Bauern gerichtete Maßnahmen hingestellt wurde. Auch wurden Gerüchte in Umlauf gesetzt wie die, daß für jeden sowjetischen Traktor sieben Pferde an die Sowjetunion abgegeben werden müßten und daß die MAS nichts anderes als getarnte Basen der sowjetischen Panzerwaffe seien. Schließlich kam es auch zu Sabotageakten an sowjetischen Traktoren; man streute zum Beispiel Sand in die Nachfüllstutzen der Tanks.
Die MAS sollten vor allem den werktätigen Bauern Unterstützung geben und vorrangig den Wirtschaften ohne Anspannung oder mit wenigen Spannkräften helfen. Tatsächlich überzeugten sich die meisten Bauern rasch von den Vorteilen der MAS und begrüßten diese Einrichtung. Die Tarife lagen unter den Selbstkosten und boten einen materiellen Anreiz, Leistungen in Anspruch zu nehmen. Großbauern hatten den vollen Tarif zu zahlen. Mittelbauern erhielten eine Ermäßigung von 15 Prozent, Kleinbauern eine von 30 Prozent. 80 Prozent der Leistungen kamen 1949 Kleinbauern und Mittelbauern zugute. Die MAS führten 12 Prozent der Pflugarbeiten der Landwirtschaft aus und mähten 10 Prozent der Getreideanbauflächen. In hohem Maße waren die MAS an Materialtransporten für das Neubauernbauprogramm beteiligt. Die Gesamtleistungen übertrafen 1949 schon die der Maschinenausleihstellen der VdgB vom Vorjahre. Durch den planvollen Maschineneinsatz der MAS verbesserten sich für viele Wirtschaften die Möglichkeiten, am Leistungsanstieg der Landwirtschaft teilzuhaben. Die Abhängigkeit breiter Schichten der werktätigen Bauernschaft von den Traktoren und Maschinen der Großbauern und wirtschaftsstarken Mittelbauern konnte verringert, aber bei weitem noch nicht beseitigt werden. Immerhin waren dreimal soviel Traktoren, wie die MAS besaß, in Privathand.
Mitte 1949 erfolgte eine Neuorganisation der Landesgüter. Diese 535 Güter – überwiegend mehr als 200 Hektar groß – bewirtschafteten knapp 3 Prozent der landwirtschaftlichen Nutzfläche. Als landeseigene Basen der Saatzucht und Saatgutproduktion sowie der Viehzucht hatten sie großen Anteil am Wiederaufbau der Landwirtschaft. Sie erbrachten auch 10 Prozent der landwirtschaftlichen Marktproduktion zur Versorgung der Bevölkerung mit Nahrungsgütern.
Die meisten Arbeiter in den landeseigenen Gütern waren sich ihrer neuen gesellschaftlichen Stellung und Verantwortung noch wenig bewußt. Die Arbeits- und Lebensbedingungen hatten sich infolge der schlechten wirtschaftlichen Lage der meisten Güter bisher nur geringfügig verbessert. In vielen dieser Betriebe kommandierte der Betriebsleiter die Landarbeiter wie seinerzeit der gutsherrschaftliche Inspektor.
Traktoristen einer Maschinenausleihstation in Sachsen, 1949
Mitte 1949 erhielten alle Betriebe der Land- und Forstwirtschaft und des Gartenbaus, die sich im Eigentum der Länder, Kreise und Gemeinden sowie der Körperschaften und Anstalten des öffentlichen Rechts – mit Ausnahme der Kirchen – befanden, den Rechtsstatus volkseigener Betriebe. Die bisherigen Landesgüter – umbenannt in volkseigene Güter (VEG) – wurden in Vereinigungen volkseigener Güter zusammengeschlossen und zentral unterstellt. Diese Reorganisation bewirkte, daß sich der Charakter der Güter als volkseigene Betriebe rascher entfaltete.
In einer Reihe von VEG entstand unter dem Einfluß von Mitgliedern der SED ein Kern von Landarbeitern, der aktiv auf die Entwicklung des Betriebs Einfluß zu nehmen begannen. Damit verbanden sich die Anfänge einer Aktivisten- und Wettbewerbsbewegung, in der jugendliche Arbeiter vorangingen, deren Haltung nicht so stark von überkommenen Denkweisen geprägt war.
Fortgeschrittene Güter erreichten teilweise noch 1949 das Vorkriegsniveau in der Produktion und kamen auch damit der Aufgabenstellung der 1. Parteikonferenz der SED ein Stück näher, sich zu Musterbetrieben zu entwickeln.
Bis zum Sommer 1949 wurde ein Netz von volkseigenen Erfassungs- und Aufkaufbetrieben für landwirtschaftliche Erzeugnisse (VEAB) geschaffen. Diese Betriebe erfaßten das landwirtschaftliche Ablieferungssoll und organisierten darüber hinaus den planmäßigen Aufkauf verbleibender Überschüsse. Für solche „freien Spitzen“ wurden Preise gezahlt, die mehrfach über dem Niveau der Erfassungspreise lagen, bei Schlachtschweinen zum Beispiel um das Vierfache. Nach der Währungsreform von 1948 wirkten solche Preise nun sehr stark als Anreiz für eine Produktionssteigerung und den Verkauf von Übersollmengen, zumal den Bauern dafür jetzt auch begehrte Industrieerzeugnisse angeboten werden konnten.
Der Aufkauf von Agrarerzeugnissen durch volkseigenen Handelsbetriebe führte zu einer Einschränkung des kapitalistischen Landhandels. Dieser blieb jedoch an der Versorgung der Bauern mit landwirtschaftlichen Geräten und Bedarfsgütern beteiligt, die überwiegend durch die ländlichen Genossenschaften realisiert wurde.
Der Ausbau der MAS und die Bildung der VEAB erweiterten den volkseigenen Sektor in der Landwirtschaft. Zusammen mit der Reorganisation der VEG trug dies zur weiteren Stärkung der Hegemonie der Arbeiterklasse sowie zur Festigung des Bündnisses der Arbeiterklasse mit den werktätigen Bauern bei.
Neue Erfordernisse im Bereich der Kulturpolitik und die „Kulturverordnung“ der DWK
Ausgehend von ihrer auf dem Kulturtag im Mai 1948 und in den Zweijahrplandebatten entwickelten kulturpolitischen Konzeption hatte die SED auf der 1. Parteikonferenz drei große kulturelle Aufgabenfelder benannt, denen im Rahmen des Plans vordringliche Förderung zuteil werden sollte: erstens Steigerung und Entwicklung des allgemeinen Bildungs- und Kulturniveaus des Volkes sowie Entfaltung der künstlerischen Selbstbetätigung der Werktätigen; zweitens Förderung und Entwicklung von Wissenschaft, Forschung und Kunst mit dem Volk für das Volk; drittens Festigung des Bündnisses der Arbeiterklasse und anderer Werktätiger mit der Intelligenz und Entwicklung einer neuen, demokratischen Intelligenz.
Da die erfolgreiche Realisierung des Zweijahrplans vornehmlich vom Wollen, Können und Fühlen der arbeitenden Menschen abhing, rückten 1948/49 solche Maßnahmen ins Zentrum der Kulturarbeit, die der Erhöhung des Kulturniveaus breiter Schichten der Arbeiter und Bauern dienen konnten. Größte Beachtung wurde der Berufsausbildung der heranwachsenden Jugend ‚geschenkt. Die SED initiierte und unterstützte zahlreiche Aktivitäten, die einen Aufschwung der kulturellen Massenarbeit und der künstlerischen Selbstbetätigung der Werktätigen herbeiführen sollten – die Einrichtung von Arbeiterklubhäusern in 80 Großbetrieben, die Förderung der Leseinteressen der Werktätigen durch Schaffung neuer Büchereien, die fachliche Weiterbildung in den Betrieben und die Kulturarbeit auf dem Dorf. Auch Presse und Rundfunk waren angesprochen, Aufgaben im Sinne der Realisierung des Zweijahrplans wahrzunehmen. Mit neuartigen Sendungen wie „Wir schalten uns ein“ von Karl Gass, die direkt vor Ort in den Betrieben ökonomische Probleme behandelten, kamen sie dieser Forderung nach. Außerdem war eine breite Arbeiter- bzw. Volkskorrespondentenbewegung ins Leben gerufen worden.
Ohne das Wissen und die Fähigkeiten von Angehörigen der Intelligenz und ohne einen hohen Entwicklungsstand von Wissenschaft, Technik, Kunst und kultureller Infrastruktur wäre der Aufbau einer neuen Gesellschaft jedoch ebenfalls kaum zu realisieren gewesen. Daraus erwuchsen immer wieder hohe Anforderungen an die bündnispolitischen Potenzen der Arbeiterklasse. Die Festigung ihrer Beziehungen zur Intelligenz bedurfte auch deshalb wachsender Aufmerksamkeit, weil das wiedererstehende deutsche Monopolkapital seine zunehmende Wirtschaftskraft und seine sich wieder stabilisierende kulturelle Herrschaft unter anderem sehr bald darauf verwandte, Wissenschaftler und Künstler in seinen Einflußbereich zu holen und an sich zu binden. Bis 1948 wechselten von der Berliner Universität 17, von der Universität Leipzig 22 und von der Universität Halle 67 Professoren und Dozenten in die Westzonen über. Berufungen an Universitäten in anderen Landesteilen stellten zwar eine damals übliche Praxis dar, erfolgten jedoch zunehmend mit politischer Motivierung. Die Spaltung der Berliner Universität und die Eröffnung der Westberliner „Freien Universität“ unter dem Rektorat von Friedrich Meinecke am 4. Dezember 1948 als „Kampfuniversität“ des kalten Krieges ließen zudem deutlich erkennen, daß der Klassenkampf im Universitäts- und Hochschulbereich an Schärfe gewann. Mit der zunehmenden Normalisierung der Wirtschaft wuchs auch das kapitalistische Interesse an Spezialisten der technischen Intelligenz. All dies machte eine verständnisvolle Intelligenzpolitik um so wichtiger. Nach klärenden Auseinandersetzungen mit sektiererischen intelligenzfeindlichen Auffassungen, die bis in die Partei der Arbeiterklasse hineinreichten, hatten entsprechende bündnispolitische Festlegungen Eingang in die Dokumente der 1. Parteikonferenz gefunden. Dort war auch festgelegt, wie Institute und Einrichtungen der Akademie der Wissenschaften ausgebaut werden sollten, um den Übergang der früheren Gelehrtengesellschaft zu einer Forschungsakademie zu befördern. Darüber hinaus enthielten diese Dokumente Orientierungen, welche Disziplinen besonders zu entwickeln seien.
Davon ausgehend und gemäß den damaligen gesellschaftlichen Erfordernissen, wurden 1949 die Forschungen vor allem auf Metallurgie, Lichttechnik, Elektrotechnik, Kunstfaser- und Kunststoffchemie, Kohleverwertung, Bauwesen, Landwirtschaft und Ernährungswirtschaft ausgerichtet. Rohstoff- bzw. Ersatzrohstoffsuche spielten in allen Forschungsdisziplinen nach wie vor eine zentrale Rolle.
Indem sie eine systematische und kontinuierliche Entwicklung der Forschungsarbeit und der Forschungsstätten anstrebten, initiierten die Beschlüsse der Parteikonferenz die Einführung der Planung in die wissenschaftliche Arbeit und forderten sie die Wissenschaftler auch auf diese Weise zu neuen Haltungen und Einsichten heraus.
Um die Forschungsbasis zu verbreitern, wurden Forschungsaufträge an Hochschulen vergeben, Maßnahmen zur Stimulierung von Arbeitererfindungen eingeleitet und die Einheit von Wissenschaft und Wirtschaft als grundsätzlicher Ausgangspunkt der gesamten Forschung bewertet. Die Zweijahrplandokumente verpflichteten die zuständigen Verwaltungsorgane, unverzüglich Maßnahmen zur Verbesserung der materiellen Lebens- und Arbeitsbedingungen der Gelehrten, Ärzte und Forscher, der technischen Intelligenz sowie der studierenden Jugend einzuleiten. Der Beitrag der Künstler und Schriftsteller sollte „in der Entwicklung einer realistischen Kunst“ sowie in dem Bestreben bestehen, „auf ihrem Gebiet die höchste künstlerische Leistung zu vollbringen“.117 Doch ebenso erwartete man solche Werke von ihnen, die „Arbeitsfreude und Optimismus bei den Arbeitern in den Betrieben und bei der werktätigen Landbevölkerung“ zu wecken vermochten.118
Am 31. März 1949 erließ die Deutsche Wirtschaftskommission, ausgehend von der Überzeugung, daß „das Aufblühen der demokratischen ‚deutschen Kunst, Wissenschaft und Kultur“ ein „wesentlicher Faktor des neuen Lebens“ sein werde, eine Verordnung „Die Erhaltung und die Entwicklung der deutschen Wissenschaft und Kultur, die weitere Verbesserung der Lage der Intelligenz und die Steigerung ihrer Rolle in der Produktion und im öffentlichen Leben“.119 Mit diesem Dokument, meist als „Kulturverordnung“ bezeichnet, orientierte die DWK nochmals auf „die großzügige Heranziehung der zur ehrlichen Mitarbeit bereiten Intelligenz“.120
Entsprechend diesem Anliegen enthielt die Verordnung neben detaillierten Festlegungen zur Wiederherstellung von Gebäuden der Hochschulen, vornehmlich der TH Dresden und der Universitäten Berlin, Jena, Leipzig und auch solchen zur Reorganisierung der Akademie der Wissenschaften – für letztere waren unter anderem eine Verdoppelung der Mitgliederzahl und die Bildung neuer Klassen vorgesehen – sehr umfängliche und weitreichende Beschlüsse zur Verbesserung der materiellen Lebensbedingungen von Wissenschaftlern und Kulturschaffenden.
Für den Bau bzw. Wiederaufbau wissenschaftlicher Einrichtungen an den 19 Hochschulen und Universitäten sowie den 390 Forschungsinstituten, für die Bereitstellung von 250 Tonnen Papier zur Erweiterung der Verlagstätigkeit der Akademie der Wissenschaften, für die Vergabe von Krediten zum Eigenheimbau an Wissenschaftler, für Gehaltsregulierungen und Personalrenten sowie für die Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses stellte die DWK trotz der keineswegs einfachen wirtschaftlichen Situation erhebliche Mittel zur Verfügung. Durch die „Kulturverordnung“ erhielt die Akademie der Wissenschaften ihr Hauptgebäude am Platz der Akademie in Berlin, das Gelände des damaligen Aerodynamischen Instituts in BerlinAdlershof, den Gutshof Paulinenaue bei Nauen (heute im Besitz der Akademie für Landwirtschaftswissenschaften) sowie das Institut für Kulturpflanzenforschung in Gatersleben. Vorgeschlagen und beschlossen wurde die Gründung einer Akademie der Künste. Für herausragende Leistungen von Wissenschaftlern, Schriftstellern, Ingenieuren, Agronomen, Technikern, Meistern und Arbeitern stiftete die DWK mit dieser Verordnung Nationalpreise I. Bis III. Klasse, die seit 1949 jährlich verliehen werden.
Die DWK verfügte weiterhin, die bisherigen Vorstudienabteilungen zur Vorbereitung von Arbeiterund Bauernkindern auf ein Hochschulstudium in Arbeiterund-Bauern-Fakultäten (ABF) mit dreijähriger Studienzeit umzugestalten. Nach und neben der Neulehrerausbildung stellte diese Festlegung einen der wichtigsten Schritte zur Herausbildung einer neuen, sozialistischen Intelligenz dar.
Um die angestrebte Verbesserung der materiellen Lebensbedingungen renommierter Wissenschaftler, Techniker, Schriftsteller und Künstler durchzusetzen, entstand bei der DWK unter Vorsitz von Anton Ackermann ein Förderungsausschuß aus Vertretern der Intelligenz, dem adäquate Kommissionen in den Kreisen, später auch in den Ländern der Ostzone zugeordnet waren. Nach Überwindung mancher ideologischer und wirtschaftlicher Hemmnisse begann ab September 1949 unter der Leitung dieses Ausschusses die schrittweise Behebung materieller Nöte von Intellektuellen.
Insgesamt war vorgesehen, vom II. Quartal 1949 an 40.000 sogenannte IN-Scheine (Intelligenzscheine) zu verteilen, die eine Zusatzverpflegung garantierten. Daneben wurden fast 10000 Künstler mit Betriebsessen versorgt und 5000 Wohnungen bzw. Häuser an Angehörige der Intelligenz vergeben. Diese erhielten zusätzliche Brennstoffzuteilungen im Umfang von insgesamt 1 Million Tonnen. Frei praktizierende Ärzte bekamen ein höheres Benzinkontingent, um ihre Aufgaben bei der Krankenbetreuung besser erfüllen zu können. Auch wurden ihnen Möglichkeiten eingeräumt, ihre Sprechstunden in Öffentlichen Gesundheitseinrichtungen abzuhalten. Der Ankauf von Kunstwerken durch staatliche Einrichtungen und Galerien wurde ebenso gefördert wie eine entsprechende staatliche Auftragserteilung. Das bedeutete eine größere Existenzsicherheit für freischaffende Künstler. Erholungsheime speziell für Angehörige der Intelligenz entstanden in Bad Liebenstein, in Heiligendamm und in Masserberg.
Mit besonderem Nachdruck bemühten sich die antifaschistisch-demokratischen Kräfte um die Gewinnung der technischen Intelligenz. Da diese in den Industriegebieten, beispielsweise in Sachsen, die zahlenmäßig größte Gruppe der Intelligenz bildete, bestanden allerdings Schwierigkeiten, sie in ihrer Gesamtheit mit zusätzlichen Lebensmittelzuteilungen zu versorgen. Weitere Probleme ergaben sich daraus, daß viele Angehörige der technischen Intelligenz rein fachlich orientiert waren und offen ihr politisches Desinteresse bekundeten. Von ihnen konnten keine politischen Bekenntnisse, sondern höchstens Loyalität gegenüber den Maßnahmen der antifaschistisch-demokratischen Umwälzung erwartet werden. Insbesondere für die Kammer der Technik (KdT) erwuchs mit dem Zweijahrplan die komplizierte Aufgabe, das in ihren Reihen organisierte Potential der wissenschaftlich-technischen Intelligenz zu Verständnis und schöpferischem Engagement für die Notwendigkeiten des Plans zu führen. Dies gelang im Laufe der Arbeit immer besser. Allerdings ‚war für manchen Ingenieur bzw. Wissenschaftler die Einbeziehung in die neuen Aufgaben äußerst konfliktreich. So trat beispielsweise der erste Präsident der KdT, der Liberaldemokrat Enno Heidebroek, Anfang 1949 von seiner Funktion zurück, weil er glaubte, den neuen gesellschaftlichen Anforderungen an die KdT nicht mehr entsprechen zu können. Er leistete jedoch an der TH Dresden weiterhin eine verdienstvolle wissenschaftliche Arbeit. Sein Nachfolger wurde der Chemiker Hans Heinrich Franck, der wegen seiner politischen Haltung von den Nazis entlassen und 1945 dann wieder als Ordinarius für chemische Technologie an der TH Berlin eingesetzt worden war.
Mit der Gründung technischer Aktivs, die Arbeiter und Angehörige der technischen Intelligenz zusammenführten, entstanden in einer Reihe von Betrieben neue Formen einer engeren Zusammenarbeit. Zu einem Massenprozeß wurde diese Entwicklung jedoch erst in den fünfziger Jahren. Der Herausbildung kameradschaftlicher Bündnisbeziehungen zwischen Arbeitern, Technikern und Ingenieuren standen zu diesem Zeitpunkt noch eine Vielzahl von Vorbehalten auf beiden Seiten entgegen.
Die schrittweise Realisierung der „Kulturverordnung“ bewirkte aber ein allmähliches Umdenken in Kreisen der alten Intelligenz. Die hohe moralische und materielle Wertschätzung, die die Tätigkeit aller ihrer Gruppen in diesen Beschlüssen der revolutionären Arbeiterbewegung und der antifaschistisch-demokratischen Verwaltungsorgane erfuhr, trug neben der nationalen Politik und der engagierten Friedenspolitik der revolutionären Kräfte wesentlich zur stärkeren Identifizierung von Intellektuellen mit der antifaschistisch-demokratischen Umwälzung bei. Es gehörte jedoch zur Kompliziertheit jener Jahre, daß es immer auch Belastungen der Intelligenzpolitik und der Bündnisbeziehungen gab, so – um besonders bekannte Beispiele hierfür zu nennen – wenn konservative Kreise in der CDU gegen den Willen der demokratischen Kräfte um Otto Nuschke dem dialektischen und historischen Materialismus ein „christlich-abendländisches“ Natur-, Geschichts- und Weltbild direkt entgegenzusetzen suchten oder wenn die unkritische Rezeption pseudowissenschaftlicher Theorien, beispielsweise von solchen des damals einflußreichen sowjetischen Agrobiologen T.D.Lyssenko, bei Intellektuellen ebenso Verunsicherungen auslöste wie intolerante und Schaden stiftende Formalismus-Realismus-Diskussionen.
Die Beschlüsse über den Zweijahrplan sowie die darauf basierenden kulturpolitischen Entscheidungen und Maßnahmen der SED und der demokratischen Verwaltungsorgane demonstrierten dennoch, dass 1948/49 in kulturellen Bereichen ein neuer Entwicklungsabschnitt begonnen hatte.
Alltag nach Überwindung der Hungerjahre. Jugend im Aufbruch
Mitte 1949 wirkten sich die großen und kleinen Erfolge des vierjährigen Ringens gegen Chaos und Not, um Normalisierung und Neuaufbau im täglichen Leben der arbeitenden Klassen und Schichten schon spürbar aus. Die Zeit des Hungerns und Improvisierens ging zu Ende. Unter neuen gesellschaftlichen Bedingungen gelangten Arbeit und Freizeit wieder in geregeltere Bahnen. Die überdurchschnittlichen Belastungen der Werktätigen in solchen sozialen Grundbereichen wie Ernährung, Kleidung und Wohnung wurden langsam abgebaut. Die gesundheitliche Betreuung und der vorbeugende Gesundheitsschutz erreichten ein höheres Niveau. Neue Erholungsmöglichkeiten wurden geschaffen. Es ging langsam aufwärts.
Schon im Verlaufe des Jahres 1948 hatte sich die Versorgung der Bevölkerung auf immer mehr Gebieten stabilisiert. Nach den Entbehrungen der vorhergehenden Jahre wurde dies von den Werktätigen als erfreuliche Wende zum Besseren empfunden. Endlich konnten die auf den Lebensmittelkarten angegebenen Produkte und Mengen auch wirklich bezogen werden, mußte man nicht ständig befürchten, unbeliebte Austauscherzeugnisse zu erhalten. Waren im 1. Halbjahr 1948 noch große Schwierigkeiten bei der Fettversorgung aufgetreten, die mit Hilfe der Sowjetunion überwunden wurden, so zeichnete sich gegen Ende des Jahres erstmals die Möglichkeit einer bescheidenen gesellschaftlichen Vorratswirtschaft ab. Fleisch allerdings stand noch nicht in ausreichenden Mengen zur Verfügung.
Ende 1948 hatte sich die Zahl der Berechtigten zur Teilnahme an der Zusatzverpflegung nach Befehl Nr. 234 der SMAD auf 1500000 erhöht und war zudem der Anteil der nach der Kategorie A Versorgten von 40 auf mehr als 50 Prozent, nämlich 800000, erweitert worden.
Die Menge der zu verteilenden Industriewaren war angewachsen, reichte aber in ihrer Gesamtheit bei weitem noch nicht aus, den enorm gestiegenen Bedarf an Kleidung, Schuhwerk, Wäsche und Hausrat zu decken. Neben der Zusatzversorgung auf der Grundlage des Befehls Nr.234 stellte die Einführung einer Punktkarte für Textilien und Schuhwerk ab 1. Januar 1949 einen weiteren Schritt nach vorn dar. Diese Karte wurde in fünf unterschiedlichen Einstufungsgrößen von 60 bis 140 Punkten ausgegeben, die den gestaffelten Zuteilungsgruppen für Lebensmittel ähnelten. Für einen Anzug benötigte man 80, für ein Wollkleid 48, für einen Bettbezug 55, für ein Bettlaken 35 und für einen Kopfkissenbezug 14 Punkte. Alle Heimkehrer wurden mit einer 200-Punkte-Zusatzkarte versorgt. Gar keine Punktkarte erhielten – da sie ihren Bedarf über die HO decken sollten – Inhaber von Betrieben mit mehr als fünf bzw. zehn Arbeitskräften sowie alle Vollselbstversorger auf dem Land. Für viele Klein- und Neubauern bedeutete dies eine Härte, da ihnen kostspielige Käufe in der HO nicht so ohne weiteres möglich waren. Deshalb wurde bald darauf ein Sonderkontingent für bedürftige Vollselbstversorger eingerichtet.
Die Ansprüche an den Handel, der nun wieder umfassender seinen Aufgaben gerecht werden mußte, stiegen. Zugleich verliehen die größere Vielfalt an Einkaufsmöglichkeiten und vor allem die Eröffnung weiterer HO-Geschäfte und HO-Restaurants dem alltäglichen Leben wieder mehr Farbe und stärkten damit Lebenszuversicht und Lebenswillen. Der Lohn erhielt nach und nach seine stimulierende Funktion zurück. Immer mehr werktätige Menschen fühlten sich zu größerer sozialer Aktivität und höheren Leistungen angespornt, zumal im Laufe des Jahres 1949 mehrfach bedeutende Senkungen der HO-Preise durchgeführt wurden. Wenigstens hin und wieder waren nun auch schon solche Genüsse möglich wie eine Eiswaffel, die im Frühjahr 1949 für 3,– DM zu haben war und im Sommer 1949 bloß noch 2,50 DM kostete, wie Butterkremtorte, das Stück für 3,20 DM, Schokolade, die Tafel für 9,– DM, und Bohnenkaffee, das Pfund für 40,DM.
Für Kartoffeln und Gemüse wurde zu diesem Zeitpunkt die Rationierung aufgehoben. Die Gas- und. Stromzuteilungen konnten erhöht und die Hausbrandversorgung verbessert werden. Die Punktbewertung für Textilien setzte man bald herab, so daß mehr Waren pro Karte gekauft werden konnten. Kleintextilien, wie Krawatten und Büstenhalter, aber auch Hausschuhe, Pantoffeln, Ersatzschuhwerk mit Holzsohlen und Hausrat verschiedenster Art gelangten in den freien Verkauf.
Speisekarte einer HO-Gaststätte, August 1949
Die allmähliche Erhöhung der täglichen Rationssätze für die verschiedenen Verbraucherkategorien war schrittweise möglich geworden. So stiegen die täglichen Verpflegungssätze für Hausfrauen und Schwerarbeiter vom November 1945 bis Dezember 1949 wie folgt (in Gramm):121

In der Zeit von März bis einschließlich November 1949 wurden nunmehr für 2000000 Arbeiter, Angestellte und Angehörige des ingenieurtechnischen Personals der führenden Zweige der Industrie und des Verkehrs sowie für Lehrer zusätzliche Lebensmittelrationen ausgegeben.
Mit der Erweiterung des Konsumangebotes konnten die Käufer auch wieder stärker auf die Qualität der Waren und auf das zur Verfügung stehende Sortiment achten. Die kulturelle Dimension des Handels rückte allmählich wieder ins Blickfeld, und die Beachtung ihrer verschiedenen Komponenten wurde von der DWK entsprechend den noch immer begrenzten Möglichkeiten zur Aufgabe gemacht – die Formschönheit von Produkten, die Art und Weise der Verpackung, die Ausstattung der freien Läden und Restaurants, die Schaufensterdekorationen. Zu entsprechenden Initiativen wurde ermuntert. So fand während der Goethe-Tage 1949 in Weimar ein Schaufensterwettbewerb statt. Das Leipziger Messeamt organisierte anläßlich der Herbstmesse 1949 eine „Beispielschau formschönen Hausrats“. Auch gab es öfter Modenschauen. Die Mode wurde bunter und üppiger; der ursprünglich in Frankreich kreierte „New Look“ mit seiner Stoffülle setzte sich trotz Rationierung als Moderichtung durch. Die ersten Kreppschuhe tauchten auf. Solche Neuheiten kamen vor allem aus den USA, deren Wirtschaftskraft durch den Krieg nicht gelitten hatte. daß die Beliebtheit derartiger Modeartikel im Zuge der Eskalation des kalten Krieges auch politisch ausgenutzt wurde, provozierte kritische Reaktionen auch in bezug auf die Beurteilung bestimmter Moden.
In den Wohnverhältnissen gab es gewisse Fortschritte. Hatte die Zahl der in Behelfsquartieren Untergebrachten Anfang 1948 noch etwa eine dreiviertel Million betragen – das waren 4,1 Prozent der Gesamtbevölkerungszahl –, so konnte sie 1949 auf 16422 Personen reduziert werden. Eine Begehungsaktion im Sommer 1949 führte zur Aufdeckung zahlreicher Reserven an unterbelegtem oder zweckentfremdetem Wohnraum, dessen Vergabe neben der Instandsetzung von nahezu einer halben Million ehemals beschädigter Wohnungen dazu beitrug, die Wohnungssituation wenigstens etwas zu entspannen. Am 13.Juli 1949 gab Oberbürgermeister Friedrich Ebert den unter Leitung von Heinrich Starck ausgearbeiteten „Generalplan für den Neuaufbau Berlins“ bekannt, der etappenweise realisiert werden sollte. Die -Bautätigkeit begann im Arbeiterbezirk Friedrichshain. 1949 wurden 845 neue Wohnungen gebaut, 1688 ausgebaut und 15768 instand gesetzt. An Industrieschwerpunkten der Ostzone sollten ebenfalls 5000 Wohnungen neu entstehen. Meist war die Bauplanung mit der Absicht verbunden, den betreffenden Gebieten die dringend benötigten Facharbeiter zuzuführen. In Städten wie Berlin oder Halle öffneten Möbelhäuser ihre Pforten, die bemüht waren, zunächst in größerem Umfang billige und zweckmäßige Möbel für Ausgebombte und Umsiedler bereitzustellen. Doch ließ das Sortiment auch erkennen, daß sich manche Möbelhersteller noch sehr stark am bürgerlichen Geschmack orientierten. Wie anders sollte man sich sonst das Angebot von „Herrenzimmern“ für 12500 DM in Berliner Möbelläden erklären. Bei den damaligen Durchschnittslöhnen von 200 bis 250 DM konnte sich ein normaler Werktätiger derartiges niemals leisten, abgesehen davon, daß ihm der entsprechende Wohnraum fehlte. Solche Beispiele machten die neuen sozialen Aufgaben eines volkseigenen Handels offenkundig.
Kostenloser Erholungsaufenthalt in Heimen der Sozialversicherung, 1949. Werktätige Frauen bei der Ankunft in einem Ostseebad
Den Freizeit- und Erholungsbedürfnissen konnte allmählich stärker Rechnung getragen werden. Vor allem die Gewerkschaften engagierten sich auf diesem Gebiet. So übernahmen sie es zeitweise, das Kleingartenwesen organisatorisch und durch Vermittlung geeigneter Parzellen zu fördern, weil es sowohl einer zusätzlichen Nahrungsgüterversorgung diente als auch einen wichtigen gesundheitlichen Ausgleich insbesondere für die Arbeiterbevölkerung bot. 2 Millionen Kleingärtner – so planten die Gewerkschaften – sollten bis 1950 auf Wochenendgrundstücken Entspannung finden.
Der Feriendienst des FDGB entwickelte sich ebenfalls weiter. Er konnte 1949 bereits 22500 Plätze zur Verfügung stellen. 1948 hatte sich deren Zahl erst auf 9800 belaufen. Allerdings betrug der Arbeiteranteil in den Ferienheimen 1949 nur 29 Prozent, während 45 Prozent der Urlauber aus Angestelltenkreisen kamen. Die Gewerkschaften betrachteten die Kosten als Ursache für diese Zurückhaltung von seiten der Arbeiter und suchten durch finanzielle Zuschüsse für weniger bemittelte Werktätige eine Änderung dieses Zustandes herbeizuführen.
Die Sozialversicherung erhöhte ihre Leistungen bei Krankenhaus- und Heilbehandlungen und übernahm nunmehr sämtliche Kosten für Zahnersatz. Die Zahl der Heilkuren nahm daraufhin zu. Konnten 1948 28700 TBK-Kuren, 39000 sonstige Heilkuren und 24000 Genesungskuren genehmigt werden, so war für 1949 schon eine Verdopplung vorgesehen. Die ab Februar 1949 erfolgende Erhöhung des Haus- und Taschengeldes für Werktätige, die einen Kuraufenthalt zugebilligt bekamen, ermöglichte es insbesondere Kurbedürftigen aus Arbeiterkreisen, die für sie notwendigen Heilmaßnahmen auch tatsächlich in Anspruch zu nehmen.
Mit der allmählichen wirtschaftlichen Konsolidierung ging die Entwicklung und Förderung des gesamten Gesundheitswesens einher. Die Einrichtung von Polikliniken diente sowohl einer effektiveren Nutzung der vorhandenen Kader und Mittel als auch der besseren gesundheitlichen Betreuung der Werktätigen. Die Bettenkapazität der Krankenhäuser wurde wiederhergestellt. Vor allem für Tuberkulosekranke erhöhte sich die Bettenzahl von 19000 auf 32000. Die Penicillinversorgung verbesserte sich. Den Anstrengungen aller Mitarbeiter des Gesundheitswesens war es zu danken, daß bereits 1948 die meisten für die Nachkriegszeit typischen Infektionskrankheiten eingedämmt waren oder eine rückläufige Tendenz aufwiesen. So konnte auf der 6. Sitzung des Sozialpolitischen Ausschusses des Deutschen Volksrates vom 4. November 1948 festgestellt werden, daß die Tuberkulose seit Sommer 1948 die Tendenz zur Abnahme aufwies. Die Fleckfieberepidemie, die ihren Höhepunkt im Februar 1946 erreicht hatte, war bereits im Mai 1946 zum Erlöschen gebracht worden. Zur gleichen Zeit hatte die Zahl der Typhuserkrankungen nur noch 5 Prozent der im Herbst 1945 liegenden Höchstzahl betragen. Bei allen anderen Infektionskrankheiten war der Vorkriegsstand erreicht. Die Zahl der an Gonorrhoe und Syphilis Erkrankten konnte 1948 auf das Niveau des Jahres 1934 gesenkt werden.
Eine erhebliche Senkung der schweren und tödlichen Unfälle wurde insbesondere durch die Tätigkeit der betrieblichen Arbeitsschutzkommissionen erreicht. Die Zahl der schweren Unfälle fiel 1949 gegenüber der des Vorjahres um 31,5 Prozent, die der tödlichen um 27 Prozent.
Für 4309866 Beschäftigte der volkseigenen Industrie konnten in der Zeit vom 1. Januar 1948 bis 30. Juni 1949 23 Kollektivverträge abgeschlossen werden. Damit war eine durchschnittliche Lohnerhöhung von 12 Prozent verbunden. Lohnpolitisch diskriminierende Bestimmungen für Frauen gab es in den neuen Tarifverträgen nicht mehr, und die Tariflöhne für weibliche Erwerbstätige stiegen an. Nach wie vor fehlten jedoch Facharbeiter. Um den Bedarf in bestimmten Mangelberufen wenigstens teilweise durch Umschulungen abzudecken, stellte die DWK nahezu 4,5 Millionen DM zur Verfügung.
Auf vielen Gebieten ging es allmählich vorwärts. Beeindruckend für viele Werktätige war es, daß beim Wiederaufbau und bei der Gestaltung der neuen sozialen Ordnung trotz erheblicher Schwierigkeiten versucht wurde, ihren Bedürfnissen in höherem Maße Rechnung zu tragen. Konstruktive und kritische Leserzuschriften oder Arbeiterkorrespondentenberichte, wie sie in großer Fülle in den demokratischen Presseorganen abgedruckt wurden, zeugten von dem Engagement, mit dem die arbeitenden Klassen und Schichten ihr Recht auf Mitbestimmung in allen gesellschaftlichen Bereichen wahrzunehmen begannen.
Die Familie hatte sich unter den Bedingungen von Krieg und Nachkrieg als ein stabiler Faktor erwiesen. Sie blieb in ihrer ökonomischen, sozialen und kulturellen Funktion unersetzbar und wurde von den antifaschistisch-demokratischen Verwaltungsorganen gefördert. Die Unterstützungen für Schwangere und Wöchnerinnen erhöhten sich ab März 1949. Mit der Konsolidierung der Verhältnisse ging die Zahl der Scheidungen zunächst zurück. Dennoch war die Familie mit der wachsenden Gleichberechtigung der Frau langwierigen und konfliktreichen inneren Wandlungen unterworfen. Nach wie vor sehr schwer hatten es die unvollständigen Familien, in denen Frauen als alleinige Ernährer und Erzieher wirken mußten. Viele Kinder litten noch unter großen Entbehrungen, so daß der Parteivorstand der SED im Juli 1949 mit einem Aufruf „Alles für unsere Kinder“ Hilfsmaßnahmen einleitete. Ab Januar 1949 erhielt jedes Schulkind täglich ein Schulbrötchen mit Marmelade. Die Zahl der verwaisten Kinder blieb groß. Von 15000 Kindern, die 1949 für die Kindersuchaktion gemeldet waren, hatten im Sommer dieses Jahres erst 600 ihre Angehörigen gefunden.
Landeserziehungsheim Struveshof der Stadt Berlin
Eine der größten Leistungen der antifaschistischen Kräfte stellte die weitgehende Integration großer Teile der Jugend in die antifaschistisch-demokratische Bewegung dar. Gerade bei der jungen Generation wirkten sich die körperlichen und seelischen Überlastungen der Kriegs- und Nachkriegszeit mit voller Schärfe aus. In den Strafanstalten stellten junge Menschen im Alter von 16 bis 28 Jahren den Hauptanteil der Insassen. Die Kriminalitätsanfälligkeit dieser Altersgruppe war viermal so hoch wie die aller übrigen zusammengenommen. Die antifaschistischen Verwaltungsorgane und Organisationen setzten sich sehr intensiv mit der Jugendgefährdung und -verwahrlosung auseinander und stellten zur Ergründung ihrer Ursachen vielfältige Analysen an. Meist ergab sich, daß ungeordnete Lebensverhältnisse, das Fehlen beruflicher Tätigkeit, mangelnde Beaufsichtigung, fehlende Bindungen, aber auch wirkliche Not bei vielen straffällig gewordenen Jugendlichen, insbesondere aus der Umsiedlerjugend, die ersten Schritte zur Verwahrlosung gebildet hatten. Dazu kamen die unzureichende Ernährung und die Verführungen des schwarzen Marktes. In der antifaschistisch-demokratischen Presse wurde oft genug Klage geführt über die „pervitinäugigen Fräuleins“ und die „pomadisierten Jünglinge vom Schwarzmarkt“.122
Bei 50 der 200 Jugendlichen, die bis Oktober 1948 in den Jugendwerkhof Treuenbrietzen eingeliefert worden waren, geschah dies wegen Diebstahls, bei 60 wegen Arbeitsbummelei und bei 45 wegen Landstreicherei. Bei 34 Jugendlichen waren die asozialen häuslichen Verhältnisse Ursache für das Straffälligwerden. Lebenshunger, Geltungsdrang, Leichtsinn und Verführung durch andere ließen unter den Bedingungen der Nachkriegszeit immer. Wieder Jugendliche straucheln. Die Gefahr der Verwilderung und moralischen Verlotterung großer Teile der Jugend war gegeben.
Die deutschen Antifaschisten und Revolutionäre traten jedoch entschieden Stimmungen und auch schon deutlich artikulierten Haltungen entgegen, diese Jugend als eine „verlorene Generation“ anzusehen. Ihre Leistung bestand vor allem darin, daß sie die gefährdeten Jugendlichen nicht schlechthin über Jugendstrafen, gesellschaftliche Ausgrenzung und andere rigorose Maßnahmen – die allerdings auch nicht ausgeschlossen werden durften – zu disziplinieren suchten, sondern daß sie auf die Bedürfnisse der Jugend eingingen, ihr demokratische Normen und Regeln des Zusammenlebens nahebrachten und sie in den demokratischen Aufbau einbezogen. Dabei spielte die organisierte Jugendbewegung, die Freie Deutsche Jugend, die neue Gemeinschaftsgefühle vermittelte, eine bedeutende Rolle.
Auftritt eines Jugendchores anläßlich einer Friedenskundgebung in Berlin, 22. April 1949
Durch viele Beschlüsse und Einzelmaßnahmen bemühten sich SED, staatliche Organe, Massenorganisationen und auch kirchliche Kreise zusammen mit den Eltern, den Arbeitswillen und die Arbeitsbereitschaft Jugendlicher zu fördern bzw. diese zu befähigen, sich in ihrer Umwelt zurechtzufinden. Wenn auch drastische Maßnahmen nicht immer vermieden werden konnten, wie die sogenannte Kommandohaft, mit der streunende Jugendliche zwangsweise für eine gewisse Zeit nützlichen Tätigkeiten – Enttrümmerungsarbeiten etwa – zugeführt wurden, so standen doch im Zentrum der Aufmerksamkeit vornehmlich Bemühungen um die Beschaffung von Lehrstellen und andere Berufsbildungsmaßnahmen, die die fachliche Ausbildung und sinnvolle Beschäftigung von Jugendlichen zum Ziel hatten. 1947 konnten nur 38 Prozent der männlichen Jugendlichen Lehrstellen erhalten; 62 Prozent mußten eine ungelernte Tätigkeit aufnehmen. Bei den Mädchen lag das Verhältnis sogar bei 25:71. Der Nachwuchsplan für 1949 schuf einen deutlichen Wandel: 78 Prozent der Jungen und 71 Prozent der Mädchen sollten nun Lehrstellen bekommen.
Dazu wurden weitere Betriebsberufsschulen errichtet sowie bestehende Lehrwerkstätten vergrößert und neue geschaffen. Während am 1. Juli 1948 417 Lehrwerkstätten 8281 Lehrlinge ausbildeten, gab es am 30. Juni 1949 bereits 773 Lehrwerkstätten mit 37084 Lehrlingen.
Der Arbeitsalltag der Arbeiter- und Landjugend begann damals mit 14 Jahren. 1948 wurde eine neue Verordnung zu Fragen des Jugendarbeitsschutzes durchgesetzt, die für Jugendliche von 14 bis 16 Jahren eine Arbeitszeit von 7 Stunden täglich und von 42 Stunden wöchentlich, für Jugendliche von 16 bis 18 Jahren von 7½ Stunden täglich und von 45 Stunden wöchentlich vorsah. Es erging darin noch einmal ein ausdrückliches Verbot der Kinderarbeit. Der Urlaub für Jugendliche betrug nun zwischen 18 und 21 Tagen. Eine Erwerbstätigkeit von Jugendlichen während des Urlaubs war untersagt.
III. Pädagogischer Kongreß, Juli 1948. Im Gespräch: Marie Torhorst, Paul Wandel, Paul Oestreich und Wilhelm Heise (v. I.n.r.)
Die Bemühungen um ein geeignetes Freizeitangebot für Jugendliche nahmen zu. Jugendgemäße Veranstaltungen und Geselligkeiten, Sportwettkämpfe und Volkskunstwettbewerbe wurden durchgeführt. Jugendsendungen, Jugendfilm und Jugendliteratur bildeten in der antifaschistisch-demokratischen Kunst- und Medienpolitik wichtige Größen.
Auch Jugendliche in der sowjetischen Besatzungszone interessierten sich für Schlagermusik, Jazz und Modetänze aus dem Unterhaltungsalltag der westlichen Länder. Nicht ohne Grund befürchteten antifaschistische Politiker angesichts des kalten Krieges, daß die Jugend über solche Erzeugnisse der westlichen Massenkultur auch ideologisch beeinflußt werden sollte. Es bedurfte erst einer gewissen Konsolidierung und Weiterentwicklung der gesellschaftlichen Umwälzung, ehe dem Gesichtspunkt Rechnung getragen werden konnte, daß viele Angebote der internationalen Unterhaltungskultur der historisch gewachsenen Bedürfnisstruktur hochindustrialisierter Länder entsprachen. Die Jugend der Ostzone, dann der DDR mußte zunächst mit diesen Widersprüchen leben.
Die für sie entscheidenden persönlichkeitsformenden Wirkungen gingen von den gesellschaftlichen Umbrüchen aus, die der Mehrheit der Jugend allmählich das Bewußtsein vermittelten, einen neuen gesellschaftlichen Platz einzunehmen. Die Jugend war kein Ausbeutungs- und Unterordnungsobjekt mehr und erhielt zum erstenmal alle Möglichkeiten, als handelnde und gestaltende Kraft im politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Leben tätig zu sein. Aufbruchsstimmung und Freude am Neuen erfaßte immer mehr Jugendliche und führte sie zu sinnvollem Tun für eine bessere Gesellschaft. Damit waren selbstverständlich Lernprozesse verbunden. Doch auf diesem Wege gelang es, die Perspektive der antifaschistisch-demokratischen Umwälzung über einen künftigen Generationswechsel hinaus zu sichern.
Zunächst über die Jugendausschüsse, später über die FDJ gelangten die aktivsten und politisch aufgeschlossensten jungen Menschen in gesellschaftliche Funktionen, so daß sie schon frühzeitig zur Entscheidungsfindung herangezogen wurden und lernten, Macht zu haben und auszuüben. 3000 Funktionäre der FDJ übernahmen 1948/49 verantwortliche Aufgaben in den Verwaltungsorganen, in der Wirtschaft, in den Polizeiorganen, den Parteien und Massenorganisationen.
Die Fortführung der Bildungsreform
Bis zum Herbst 1948 war es gelungen, die Schulstruktur weiter im Sinne der demokratischen Schulreform zu verändern. Die Zahl der einklassigen Landschulen war nun auf 1407 reduziert, und auf dem Lande bestanden inzwischen 658 Zentralschulen, deren Zahl bis 1949 noch auf 675 anwuchs. In den Mittelpunkt der schulpolitischen Arbeit konnten jetzt Fragen der fachlichen Qualität des Unterrichts und der zielstrebigeren politisch-ideologischen Erziehung der Jugend rücken.
Schon der III. Pädagogische Kongreß im Juli 1948 hatte unter der Losung „Besser lehren und besser lernen“ stattgefunden. Der im August 1949 folgende IV. Pädagogische Kongreß widmete sich der Hebung des Leistungsstandes in den Schulen mit noch größerer Aufmerksamkeit. Er beschäftigte sich darüber hinaus mit den vom Parteivorstand der SED im August 1949 beschlossenen „Schulpolitischen Richtlinien“, die in der damaligen Phase der verschärften internationalen Klassenauseinandersetzung besonders die politischen Grundaufgaben der neuen Schule herausstellten und deren Erziehungs- und Bildungsfunktion bei der Weiterführung der antifaschistisch-demokratischen Umwälzung näher bestimmten. Die Heranbildung fachlich hochqualifizierter, allseitig gebildeter und politisch bewußter Menschen setzte eine wirksamere politisch-ideologische, fachliche und pädagogische Qualifizierung der Lehrerschaft voraus, die aufgefordert wurde, ihr Sachwissen und ihre marxistischleninistischen Kenntnisse zu erweitern und zu vertiefen sowie Erfahrungen der Sowjetpädagogik auszuwerten. 1949 erschien zur Beförderung dieser Aufgaben A. S. Makarenkos Pädagogisches Poem „Der Weg ins Leben“ in deutscher Sprache. Die Richtlinien orientierten des weiteren darauf, im Unterricht die führende Rolle des Lehrers sowie die Folgerichtigkeit und Systematik der Wissensvermittlung konsequent durchzusetzen und den Übergang von der demokratischen zur sozialistischen Schule vorzubereiten. Die damit verbundene pauschale Verurteilung aller Richtungen der Reformpädagogik als „spätbürgerliche Pädagogik“ ignorierte deren gesellschafts- und imperialismuskritische Wurzeln und blockierte längerfristig die kritische Aneignung ihrer produktiven Elemente.
Der IV. Pädagogische Kongreß ehrte 28 hervorragende Erzieher als „Verdiente Lehrer des Volkes“ sowie mit der Verleihung der Diesterweg-Medaille und festigte so die Stellung der Lehrer und Erzieher in der Gesellschaft.
An den Schulen entwickelten sich die entstehenden Schulparteiorganisationen der SED und die „Arbeitsgruppen sozialistischer Lehrer“ zu Initiatoren der politisch-ideologischen Arbeit. Der am 13. Dezember 1948 als einheitliche, demokratische Kinderorganisation gegründete Verband der Jungen Pioniere zählte im Sommer 1949 bereits 700000 Mitglieder. Gemäß seiner besonderen Verantwortung für die Heranbildung der jungen Generation bemühte er sich jetzt noch intensiver um politisch-ideologische Aktivitäten, um eine Verbesserung der Disziplin und um die Erhöhung der Lernbereitschaft der Schüler. Die FDJ konzentrierte ihre Aufmerksamkeit ebenfalls mehr.als in den Jahren zuvor auf die Jugendarbeit in den Schulen.
Im Jahr 1949 konnte die Schulbuchproduktion auf 13 Millionen Exemplare gesteigert werden. Im gleichen Jahr wurden über 900 Millionen Mark für die Volksbildung ausgegeben; das war pro Kopf der Bevölkerung eine dreimal so hohe Ausgabe wie im Vorkriegsdeutschland. Indes wirkten auch weiterhin Faktoren, die den Fortschritt im Schulwesen beeinträchtigten.
An den Grundschulen fehlten nach wie vor Lehrkräfte, zum einen weil ein Teil der Neulehrer bald leitende politische Funktionen übernehmen mußte, zum anderen weil eine keineswegs kleine Zahl von Lehrern aus den unterschiedlichsten Gründen den Schuldienst wieder verließ. Allein in den sächsischen Schulen erteilte die verbleibende Lehrerschaft in der ersten Hälfte des Jahres 1949 pro Woche 44400 Überstunden. In einem im August 1949 angefertigten Bericht der Personalabteilung der Deutschen Verwaltung für Volksbildung über die Fluktuation der Lehrer, die als „eine sehr bedenkliche Erscheinung“ charakterisiert wurde, stellten die verantwortlichen Funktionäre fest, daß durchschnittlich in jedem der fünf Länder 90 bis 100 Lehrer während eines Monats aus dem Dienst schieden – 45 bis 50 auf eigenen Wunsch in gegenseitigem Einvernehmen, ca. 25 bis 30 unter Vertragsbruch, der Rest auf Grund von Krankheit, Unfähigkeit oder Entlassung wegen antidemokratischem Verhalten. Die Ursachen der Fluktuation lagen nicht selten in Wohnungs- und Versorgungsschwierigkeiten, aber auch in der oft ablehnenden Haltung der Bevölkerung gegenüber den zumeist noch in der Ausbildung befindlichen Neulehrern, in dem unwürdigen Umstand, daß unverheiratete Lehrer in manchen Dörfern reihum bei den Bauern Mittag essen mußten, in langen Anmarschwegen zu den Ausbildungsorten und in der zu geringen Unterstützung durch die Schulräte.123
Auf der 1.Parteikonferenz der SED hatte Paul Wandel auch auf gegnerische Aktivitäten im Schulwesen verwiesen. In dem erwähnten Bericht der DVV wurden als Ausweg aus dieser Situation vor allem die Verbesserung der Lebensverhältnisse der Lehrer, aber auch eine Qualifizierung der Tätigkeit der neu eingesetzten Schulräte genannt, die mit Energie und politischer Weitsicht den Umbau der Schule an der Basis weiter voranbringen sollten. Materielle Verbesserungen und Lebensmittelzuteilungen auf der Grundlage der „Kulturverordnung“ der DWK, die allerdings erst ab Herbst 1949 in größerem Umfang erfolgten, zeitigten dann auch langfristig eine positive Wirkung. Zunächst jedoch hielten der häufige Lehrerwechsel sowie die zwangsläufig folgenden Fehlstunden an und minderten den Unterrichtserfolg. Von den über 300000 Schulabgängern des Jahres 1949 erreichten rund ein Drittel nicht das Ziel der 8. Klasse. Der Anteil der Arbeiterund Bauernkinder an der Schülerschaft der Oberschulen lag trotz ansteigender Tendenz immer noch bei nur 26 Prozent.
Eine Delegation der Jungen Pioniere zum III. Parlament der FDJ Anfang Juni 1949 in Leipzig trägt Vertretern der Magdeburger Stadtverwaltung Vorschläge zur Verbesserung der Schulverhältnisse vor.
Eine positive, wenn auch nicht widerspruchsfreie Entwicklung vollzog sich im Berufsschulwesen. Nach Wiederaufnahme des Berufsschulunterrichts im Jahre 1947 – gewerbliche Fortbildungs- und Werkschulen gab es in Deutschland seit Ende des vorigen Jahrhunderts – war die Zahl der Berufsschüler rasch auf über eine halbe Million angestiegen. Dennoch besuchten erst 40 Prozent der in Frage kommenden Jugendlichen im Schuljahr 1948/49 eine Berufsschule. Der im Oktober 1948 durchgeführte 2. Berufspädagogische Kongreß hatte in seinen Leitsätzen gefordert, beim notwendigen zielstrebigen Ausbau der Berufsschulen besonders den Betriebsberufsschulen in Industrie und Landwirtschaft Aufmerksamkeit zu schenken. Diese neuen Betriebsberufsschulen unterschieden sich von den früheren großkapitalistischen Werkschulen unter anderem dadurch, daß sie neben der berufsspezifischen Fachausbildung einen breitgefächerten allgemeinbildenden Unterricht auf der Grundlage zentraler Pläne vermittelten. Sie nahmen einen festen Platz im System der antifaschistisch-demokratischen Einheitsschule ein, konnten indes darüber hinaus die Ressourcen der volkseigenen Industriebetriebe und Güter sowie der MAS zur Heranbildung qualifizierter Facharbeiter nutzen.
Das Fachschulwesen und insbesondere die Ingenieurschulen erfuhren mit der Realisierung des Zweijahrplans gleichfalls einen Aufschwung. Es wurde damit begonnen, die Zahl der vorhandenen 25 Ingenieurschulen entsprechend dem Plan auf 38 zu erhöhen. Um ihrem hohen Bedarf an Meistern und Technikern Rechnung zu tragen, richteten die Betriebe auch Betriebsfachschulen ein. Eine besondere politische Bedeutung erhielten diese in der Landwirtschaft, da sie die an den Bedürfnissen der Großbauernwirtschaften orientierten Fachschulen für Land- und Hauswirtschaft, die Landfrauenschulen und die Mädchenabteilungen an den Landwirtschaftsschulen ersetzen konnten.
Dennoch erforderte der Ausbau des Berufs- und Fachschulwesens auch weiterhin große Anstrengungen. 1949 besaßen etwa 75 Prozent der Berufstätigen noch keine abgeschlossene Berufsausbildung. Eine gezielte Weiterbildung von Erwachsenen erfolgte in verstärktem Maße durch Betriebsvolkshochschulen oder Betriebslehrgänge von Volkshochschulen.
Das III. Parlament der FDJ, das im Juni 1949 tagte, beschäftigte sich ebenfalls mit Problemen des Arbeiternachwuchses und nahm Entschließungen zur Verbesserung der Berufsschulbildung in der Landwirtschaft sowie über Berufsnachwuchs, Berufsausbildung und Berufswettbewerb an. Am 5. Juli 1949 faßte das Politbüro der SED einen Beschluß über die Verbesserung der Berufsschularbeit. Darin wurde kritisch festgestellt, daß die Deutsche Wirtschaftskommission und die Deutsche Verwaltung für Volksbildung in ihrer Tätigkeit „bisher der planmäßigen fachlichen Ausbildung von qualifizierten Arbeitern aus den Reihen der Jugendlichen … nicht genügend Aufmerksamkeit“ geschenkt und die besonderen Ansprüche der volkseigenen Betriebe nicht ausreichend beachtet hatten.124 Das Politbüro legte einen Katalog von Maßnahmen vor, die vom Ausbau des Berufsschulnetzes insgesamt über die vordringliche Entwicklung der Betriebsberufsschulen bis zur Qualifizierung der Berufsschullehrer reichten. Zugleich wurde die Forderung nach einer Berufsschulausbildung für alle Jugendlichen erhoben. Bis Herbst 1949 stieg die Zahl der Berufsschulen von 763 auf 1056, und es existierten nun schon 251 Betriebsberufsschulen.
1948/49 erfolgte von seiten der Volksbildungsorgane auch eine intensive Beschäftigung mit inhaltlichen Fragen der Vorschulerziehung, um diesen Bereich pädagogisch effektiver in das System der Volksbildung integrieren zu können.
Fortschritte gab es im Hochschulwesen. Mit der Wahl des Botanikers Otto Schwarz zum Rektor der Jenaer Universität übernahm 1948 erstmals in der Universitätsgeschichte ein SED-Mitglied dieses akademische Amt. Die mit dem Studienjahr 1949/50 einsetzende Gründung von Arbeiter- und-Bauern-Fakultäten stellte im Prozeß der Hochschulreform einen bemerkenswerten Schritt nach vorn dar. Mit einer durch die Deutsche Verwaltung für Volksbildung erarbeiteten „Vorläufigen Arbeitsordnung der Universitäten und wissenschaftlichen Hochschulen“ wurde die gleichberechtigte Stellung der ABF gegenüber anderen Fakultäten festgelegt. Die Arbeitsordnung bestimmte auch, daß die ABF-Direktoren sowie ein Vertreter der Betriebsgewerkschaftsleitung dem jeweiligen Senat anzugehören hatten, und legte die Zuständigkeit der DVV für die Ernennung bzw. Bestätigung leitender Hochschulkader fest. Aber noch immer waren erst 32 Prozent der Studenten Arbeiter- bzw. Bauernkinder. Die Ausbildung neuer, antifaschistisch-demokratischer Hochschullehrer und Wissenschaftler bedurfte einer gewissen Zeit, und noch im Wintersemester 1949/50 fehlten für 800 Planstellen die Lehrkräfte. Beispielgebend für die Entwicklung der gesellschaftlichen Bereiche gestaltete sich die Tätigkeit des im Herbst 1948 gegründete Franz-Mehring-Instituts in Leipzig, das mit seinen Vorlesungsreihen über marxistisch-leninistische Philosophie, wissenschaftlichen Sozialismus und Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung auf andere Universitäten ausstrahlte. Im Oktober 1948 begann auch der Neuaufbau der Pädagogischen Hochschule Potsdam.
Unter Vorsitz Paul Wandels war im Juli 1949 bei der DVV ein Wissenschaftlicher Senat gebildet worden, dem Wissenschaftler und Hochschullehrer von Rang angehörten. Er befaßte sich damit, Grundfragen der Hochschulentwicklung zu diskutieren und entsprechend Einfluß auf die Ausbildungs- und Forschungsprozesse zu nehmen.
Freizeitkultur und Künste
Nach Beendigung der Jahre des Hamsterns und „Organisierens“ konnte die arbeitsfreie Zeit endlich wieder in größerem Umfang zur Erholung und zur Unterhaltung genutzt werden. Es bestanden nun günstigere Voraussetzungen, Werktätige zur Beschäftigung mit Wissenschaft, Literatur und Kunst oder zur künstlerischen Selbstbetätigung anzuregen.
Am 12.Januar 1949 erließen die Deutsche Verwaltung des Innern und die Deutsche Verwaltung für Volksbildung eine Verordnung über die „Überführung von Volkskunstgruppen und volksbildenden Vereinen in die bestehenden demokratischen Massenorganisationen“.125 Dies sollte zum einen einer Verbesserung der künstlerischen und materiellen Betreuung der Volks- und Laienkunstgruppen, zum anderen der Überwindung des kleinbürgerlichen Vereinswesens dienen. Seit Erlaß dieser Verordnung gehören regionale und zentrale Literatur-, Kunst- und Philosophiegesellschaften, Heimat- und Naturschutzgruppen, Mundart- und Sprachgruppen, Philatelie- und Fotografiegruppen zum Kulturbund, der sich nun zur Massenorganisation entwickelte. Die lokalen Schachgruppen dagegen unterstanden von nun an den Sportgemeinschaften des im Oktober 1948 gegründeten Deutschen Sportausschusses. Eine Ausnahme bildeten die Jugendschachgruppen, die ebenso wie die Jugendbastelgruppen technischer und zum Teil volkskünstlerischer Art und die Jugendwandergruppen der FDJ angeschlossen wurden.
FDJ-Zeltlager am Hölzernen See, Juni 1949
Vor einer Vorstellung des DEFA-Gegenwartsfilms „Grube Morgenrot“, 1949
Alle in Betrieben bestehenden Volkskunst- und volksbildenden Gruppen gelangten in die Obhut der Betriebsorganisationen des FDGB.
Die volkseigenen Betriebe, in denen zunehmend Bibliotheken, Kulturräume, Klubs, Kulturhäuser, Polikliniken, Abendschulen, Betriebssportgemeinschaften und andere soziale bzw. kulturelle Einrichtungen entstanden, begannen Zentren der kulturellen Massenarbeit zu werden. Hier fanden nun schon Schriftstellerlesungen, Theateraufführungen und Aufführungen von DEFA-Filmen statt. Selbst ein so bedeutender Schriftsteller wie Arnold Zweig, der mit seinem Antikriegs-Romanzyklus „Der große Krieg der weißen Männer“ zu den Repräsentanten der Weltliteratur zählte und 1948 aus dem palästinensischen Exil in die Ostzone übergesiedelt war, ging in Produktionsbetriebe und sprach vor Werktätigen.
Die bildenden Künstler wurden vom FDGB zu einem Wettbewerb mit dem Thema „Mensch und Arbeit“ aufgerufen. In Vorbereitung der II. Deutschen Kunstausstellung erhielten sie darüber hinaus den Auftrag, großformatige Wandbilder zu entwerfen, die den Aufbau der neuen Gesellschaft zum Inhalt haben sollten. Neun Künstlerkollektive, denen René Graetz, Arno Mohr, Horst Strempel, Rudolf Bergander und andere angehörten, gingen neben Malern, die sich individuell dieser Aufgabe stellten, wie Wilhelm Lachnit, in die Betriebe, um sich mit dem Thema Produktionsarbeiter auseinanderzusetzen.
In der Chor- und Laienmusikbewegung, die auch Arbeitermusiktraditionen fortsetzte, fanden Lieder, wie sie Paul Dessau, Hanns Eisler – der vorerst noch in Wien.lebte –, Louis Fürnberg, Ernst Hermann Meyer und andere in der Emigration geschaffen hatten, begeisterte Aufnahme und vermittelten wichtige Gemeinschaftserlebnisse – darunter das Lied der Thälmann-Kolonne, das Einheitsfrontlied und das Lied „Du hast ja ein Ziel vor den Augen“.
Wenn auch die ausgesprochene Tanzsucht der ersten Nachkriegsjahre abgeklungen war, so nahmen doch Bedürfnisse nach Kommunikation, geselligen Veranstaltungen, Tanzmusik, Sport und Kino einen breiten Raum im Leben der Werktätigen ein. Größten Zuspruch verzeichneten gesellige Großveranstaltungen, so die noch relativ seltenen öffentlichen Unterhaltungssendungen der verschiedenen Rundfunksender, wie etwa bunte Betriebsveranstaltungen, Konzerte und Ratesendungen an den Wochenenden. Sportsendungen und Sportwettkämpfe fanden viele Interessenten.
Die Sportbewegung entwickelte sich zu größerer Differenziertheit und wuchs in die Breite. Der Deutsche Sportausschuß sowie seine Trägerorganisationen FDJ und FDGB leiteten den inhaltlichen und organisatorischen Aufbau der Demokratischen Sportbewegung, die 1949 auf 542000 Mitglieder anwuchs und um die Wende 1948/49 ihre ersten Großsportveranstaltungen durchführte, von denen die Wintersportmeisterschaften in Oberhof Anfang 1949 besonders erfolgreich waren. International trat sie im August 1949 zu den II. Weltfestspielen der Jugend in Budapest zum erstenmal in Erscheinung.
Große Anziehungskraft besaß nach wie vor das Kino. Die DEFA produzierte mit den Filmen „Rotation“ und „Die Buntkarierten“ unter der Regie von Wolfgang Staudte bzw. von Kurt Maetzig künstlerisch bedeutsame Streifen, mit denen sie erstmals Lebensgeschichten von Arbeitern in den Mittelpunkt der Handlung rückte. Beide Filmwerke – das Drehbuch für den Film „Die Buntkarierten“ schrieb Berta Waterstradt – gehören neben „Affäre Blum“ zu den großen Nachkriegserfolgen der DEFA. Mit „Berlin im Aufbau“, „Junkerland in Bauernhand“ und „Der 13. Oktober“ wandte sich der Dokumentarfilm Themen der antifaschistisch-demokratischen Umwälzung zu. 1949 drehte Slatan Dudow „Unser täglich Brot“, einen Film, der vom Übergang zu neuen sozialen Inhalten in der Filmkunst der Ostzone zeugte.
Ab 1. Januar 1949 waren die Lichtspieltheater in Sachsen auf der Grundlage eines im Landtag zunächst sehr kontrovers diskutierten Gesetzes in das Eigentum des Landes übergegangen. Die früheren Besitzer erhielten eine entsprechende Entschädigung. Die übrigen Länder der Ostzone folgten nach ebenfalls heftigen Landtagsdebatten diesem Beispiel, so dass nunmehr alle Voraussetzungen für eine antifaschistisch-demokratische Spielplangestaltung in den Kinos gegeben waren. Im Hinblick auf die Entwicklung einer breiten, demokratischen und sozialistischen Unterhaltungskultur städtischen Zuschnitts gab es jedoch noch viele konzeptionelle Unsicherheiten.
Problemen der Kunstproduktion und der Kunstvermittlung wurde ein immer größeres Öffentliches Interesse zuteil, weil von diesen Bereichen bedeutende bewußtseinsbildende Wirkungen erwartet wurden.
Im literarischen Schaffen jener Jahre dominierte die Abrechnung mit der faschistischen Vergangenheit. Diese sich immer stärker ausbildende Tradition des Antifaschismus wurde zu einem festen Bestandteil des gesamten kulturellen Lebens. Allmählich entstanden auch literarische Arbeiten, die bewußt sozialistische Kunsttraditionen der Arbeiterklasse unter neuen Bedingungen fortführten. Besondere gesellschaftliche Bedeutung erlangten solche Werke, in deren Mittelpunkt das Schicksal von Kämpfern der Arbeiterklasse gerückt war, wie die Romane „Die Toten bleiben jung“ von Anna Seghers und „Die Söhne“ von Willi Bredel oder Friedrich Wolfs Drama „Wie die Tiere des Waldes“, das zum kämpferischen Antifaschismus aufrufen wollte. Und es gab erste Versuche, die gesellschaftlichen Umwälzungen seit 1945 in literarischer Form darzustellen, wie etwa Otto Gotsches Roman „Tiefe Furchen“ oder Stücke von Hermann Werner Kubsch, dessen Schauspiel „Die ersten Schritte“ – um nur eines zu nennen – im Kraftwerk Hirschfeld spielt, wo sich Kubsch zu Studienzwecken aufgehalten hatte. Kurt Barthel (Kuba) widmete sein „Gedicht vom Menschen“ dem Weg der Menschheit von der Urgesellschaft bis zum kommunistischen Reich der Freiheit.
Im Neubau. Gemälde von Karl Hofer, 1947
Theaterplakat von Franz Haacken und Peter Palitzsch, 1949. Akademie der Künste der DDR, Plakatsammlung
Die Aneignung und Weiterentwicklung von Positionen eines neuen, letztlich des sozialistischen Realismus trat in allen Künsten als Aufgabe immer stärker hervor. Viele sozialistische Exilautoren und Widerstandskämpfer waren aber in jenen Jahren in politischen und Verwaltungsfunktionen tätig, so daß ihnen kaum Zeit blieb, künstlerisch produktiv zu sein oder gar ästhetische Grundprobleme zu lösen.
1949 bereitete der aus der Emigration heimkehrende Bertolt Brecht zusammen mit Helene Weigel die Gründung des „Berliner Ensembles“ vor und vollendete sein Geschichtsdrama „Die Tage der Commune“, das sich mit dem stolzen und tragischen Schicksal des ersten proletarischen Staates der Erde auseinandersetzte. Gemeinsam mit Erich Engel inszenierte er sein Stück „Mutter Courage und ihre Kinder“, das im Januar 1949 Premiere hatte und zum herausragenden Theaterereignis der Nachkriegszeit wurde. Trotz seines aufsehenerregenden Erfolges löste es heftige Diskussionen aus. In der Kritikerschlacht, die sich an die Uraufführung anschloß, wurde Brecht volksfremde Dekadenz vorgeworfen und Drama wie Aufführung aus der Sicht enger Formalismusauffassungen scharf kritisiert. Herbert Ihering, Paul Rilla, Max Schroeder, Wolfgang Harich und Johanna Rudolph verteidigten Brechts Spielweise und seinen spezifischen Dialog mit dem Zuschauer. Zu einer theoretischen Klärung oder zu weiterführenden sozialistischrealistischen Standpunkten kam es dabei nicht. Der Streit ist insofern informativ und überlieferungswürdig, „weil er sich zur ersten größeren ästhetischen Debatte unter Marxisten ausweitete“.126
Extrem kritische Reaktionen entzündeten sich nicht nur an den Aufführungen des Brecht-Theaters, sondern auch an den im Herbst 1948 in der Zeitschrift „bildende kunst“ geführten Diskussionen zwischen Karl Hofer und Oskar Nerlinger über „Kunst und Politik“. Hofer hatte in einem Artikel zu diesem Fragenkomplex geschrieben, daß Kunst „so zeitgestaltend, ja so politisch sein (kann), wie sie nur mag, nur muß es innerhalb ihrer Gesetzlichkeit geschehen“.127 Unter dem Eindruck seiner während des Faschismus gemachten Erfahrungen warnte er aber vor einer allzu vordergründig politischen Kunst: „Gerade das, was gefordert wird, bringt die Pfuscher und die künstlerischen Hochstapler auf den Plan, die sich, von einer völlig ahnungslosen Kritik emporgelobt, jeglicher Verpflichtung zur Gestaltung enthoben fühlen.“ 128 Nerlinger nannte diese Haltung „wohlmeinend überheblich“ und reagiere mit einer scharfen Replik129, wobei er glaubte, als sozialistischer Künstler ein direkteres Eingreifen der Künste in die politischen Kämpfe der Zeit fordern zu müssen. Eine vertrauensvolle Verständigung über diese Fragen wäre sicher produktiv gewesen, doch die öffentliche Meinung wandte sich vor allem gegen Hofer. Seine oft hintergründigen Bilder, wie beispielsweise seine Allegorie auf die undurchsichtige Lage im besetzten Deutschland, die er „Im Neubau“ nannte, gerieten ins Kreuzfeuer der aufkommenden Formalismuskritik und wurden nach einiger Zeit wie auch die großen innovatorischen Wandbilder dieser Jahre, vor allem Horst Strempels Wandbild „Aufbau“ im Berliner Bahnhof Friedrichstraße, als volksfremd zurückgewiesen. Ähnlichen Verdikten verfielen selbst Arbeiten Hans Grundigs und anderer bedeutender Künstler, die 1949 mit ihren Werken auf der II. Deutschen Kunstausstellung in Dresden vertreten waren. Die kontroversen Dispute ließen erkennen, daß der Fortgang der kulturrevolutionären Prozesse im Hinblick auf Literatur und Kunst sowohl von der revolutionären Vorhut als auch von den Künstlern und Kunstschaffenden noch große theoretische und praktische Anstrengungen erfordern würde.
Fragen der Haltung zum kulturellen Erbe der deutschen und der allgemeinen Geschichte in seiner Gesamtheit bedurften der weiteren Klärung, zumal sie in das Spannungsfeld der internationalen Klassenauseinandersetzung gerieten.
Fortschritte machten 1948/49 die Rezeption und die Pflege des wissenschaftlichen Erbes der revolutionären Arbeiterbewegung, insonderheit die vertiefte Aneignung des Marxismus-Leninismus und der revolutionären Traditionen der deutschen und internationalen Arbeiterbewegung. Von 1946 bis 1949 waren im Dietz Verlag Werke der Klassiker des Marxismus-Leninismus in einer Auflage von über 2185000 Exemplaren erschienen. Seit 1949 erfolgte nun im gleichen Verlag die Herausgabe der „Bücherei des Marxismus-Leninismus“ und im Verlag Neues Leben der Reihe „Der junge Marxist“.
Die Gewerkschaften verwiesen 1948/49 in Stellungnahmen zu Fragen der Kulturpolitik auch auf die Geschichte der Arbeiterkulturbewegung vor 1933 und rückten damit proletarische Kulturtraditionen wieder mehr ins Blickfeld. Schriftsteller wie Adam Scharrer und andere hatten sich schon zu Beginn des Jahres 1948 prononciert zur proletarisch-revolutionären Traditionslinie bekannt, gleichzeitig aber gegenüber der weitgespannten antifaschistisch-demokratischen Erbepolitik eine kurzsichtige Kritik geübt. So falsch auch unter den neuen gesellschaftlichen Bedingungen eine ungebrochene, lineare Weiterführung proletarisch-revolutionärer Kulturentwicklungen mit ihren sektiererischen Elementen gewesen wäre, so richtig war es, proletarische Kulturerfahrungen kritisch anzueignen und in die neue, antifaschistisch-demokratische Kulturarbeit einzubringen, wie es in der Praxis auf vielfältige Weise geschah. So erlebte beispielsweise die proletarische Tradition der Jugendweihe ihre Wiederaufnahme, wenn auch zunächst nur in einzelnen Familien.
Die theoretische Klärung des Verhältnisses zur Sowjetunion wurde mehr und mehr zu einer historischen Notwendigkeit, vollzog sich jedoch unter den Bedingungen des Personenkults um J. W. Stalin sehr widerspruchsvoll. Von großer Bedeutung waren daher Bemühungen um ein unmittelbares, freundschaftliches Verhältnis breiter Bevölkerungskreise zu Angehörigen der Völker der Sowjetunion. Die von Hunderttausenden stürmisch umjubelten Auftritte des Alexandrow-Ensembles, des Gesangs- und Tanzensembles der Sowjetarmee, in Berlin und anderen Städten der Ostzone im Sommer 1948 stellten einen wichtigen Beitrag zur Herausbildung eines solchen internationalistischen Bewußtseins dar. Während der Vorbereitung der 1. Parteikonferenz hatten auch die vom „Neuen Deutschland“ initiierten Diskussionen „Über die Russen und über uns“ ein intensives Öffentliches Nachdenken über diese Frage bewirkt. Der Bau des sowjetischen Ehrenmals in Berlin-Treptow förderte die damit verbundenen geistigen Klärungsvorgänge ebenfalls. Schon 1948 war erstmals wieder eine deutsche Schriftstellerdelegation in die Sowjetunion gereist.
Plakat von Walter Funkat. Akademie der Künste der DDR, Plakatsammlung
Der Auftritt des Alexandrow-Ensembles auf dem Gendarmenmarkt (heute Platz der Akademie) in Berlin, August 1948
In vielen Bereichen wurden ideologische Reifeprozesse eingeleitet, die zwar oft widersprüchlich verliefen – unter anderem deshalb, weil unter dem Einfluß des Personenkults auch Erscheinungen einer schematischen und simplifizierenden Vermittlung marxistischen und leninistischen Gedankenguts wirksam waren –, letzten Endes aber doch den Blick für ein klassenmäßiges Herangehen an gesellschaftliche Probleme öffneten.
In die Auseinandersetzung mit der faschistischen Vergangenheit griffen auch der polnische Auschwitzfilm „Die letzte Etappe“ und das Bühnenstück „Die Sonnenbrucks“ des polnischen Autors Leon Kruczkowski sehr wirkungsvoll ein, die 1949 auch in der Ostzone zur Aufführung kamen.
Um das Verhältnis zum kulturell-künstlerischen Erbe wurde in jenen Jahren besonders heftig debattiert und gestritten. Relativ einheitliche Auffassungen hatten sich – nicht zuletzt unter dem Einfluß von Georg Lukács – über die Notwendigkeit herausgebildet, das klassische Kulturerbe und die Werke des kritischen Realismus zu pflegen. Schwierigkeiten bereitete es aber, eine neue historische Sicht auf den Expressionismus, den Surrealismus und andere Ausdrucksformen spätbürgerlicher Kunst zu gewinnen, die nicht selten gesellschafts- und kulturkritische Züge trugen, deren oft elitärer „l’art-pour-l’art“-Charakter neben politischen und weltanschaulichen Begrenztheiten aber eine prinzipielle Auseinandersetzung erforderlich machte. Ein marxistisch-leninistisches Bild von der bürgerlichen Moderne zu erarbeiten bedurfte längerer Zeiträume und wurde durch die Bevorzugung dieser Kunstrichtungen in den Westzonen und den kapitalistischen Ländern erschwert.
Die Diskussion über bürgerliche Dekadenz und Formalismus war von Alexander Fadejew in sehr schroffer Weise auf dem Friedenskongreß in Wrocław eröffnet worden. Alexander Dymschitz publizierte im November 1948 in der „Täglichen Rundschau“ zwei Artikel „Über die formalistische Richtung in der deutschen Malerei“. Die 1. Parteikonferenz der SED hatte daraufhin Erscheinungen „der Dekadenz und der formalistischen und naturalistischen Verzerrung der Kunst“130 den Kampf angesagt. Positive Elemente und Anknüpfungspunkte wurden in den spätbürgerlichen Kunsttraditionen damals nicht gesehen, so daß nicht selten einseitig ablehnende Urteile zustande kamen, die allerdings in der Grunderkenntnis richtig lagen, daß demokratische bzw. sozialistische Kunst der bürgerlichen Moderne nicht unkritisch gegenüberstehen dürfe. Das Problem bestand indes darin, daß immer häufiger auch sozialistische Künstler, die aus der Strömung des Expressionismus hervorgegangen waren, wegen ihrer Formsprache mit dem Vorwurf der Dekadenz bedacht wurden. Einen sehr differenziert argumentierenden Beitrag zur Diskussion über diese Fragen leistete um die Wende 1948/49 der Grafiker Herbert Sandberg131, der sich zwar auch gegen einen absoluten Subjektivismus in der Kunst aussprach, zugleich aber darauf verwies, daß bei allen in Rede stehenden Werken – von van Gogh bis Picasso – ein starkes Stück revolutionärer Geist Geburtshelfer gewesen sei. Sandberg gab zu bedenken, daß die großen Wandbilder eines Siqueiros ohne die Schule der französischen Modernen nicht möglich gewesen wären. Die fortschrittliche deutsche Malerei stellte er in eine Tradition sozial engagierter Maler, die von Goya bis Masereel reiche, aber auch auf die Poesie eines Paul Klee und eines Franz Marc nicht verzichten wolle.
Die damaligen Bemühungen um Bewahrung und Vermittlung des bürgerlich-humanistischen Kulturund Kunsterbes entsprachen einem verantwortungsvollen Verhältnis der revolutionären Arbeiterbewegung zu den Kulturtraditionen der Menschheit und zu den Schätzen der Weltkultur. Das Erbe der deutschen Klassik sollte weitesten Kreisen des werktätigen Volkes nahegebracht werden, um ihren Gesichtskreis zu erweitern und um einen lebendigen, tatbereiten Humanismus für die Gegenwart auszubilden. Doch auch zur Auseinandersetzung mit faschistischen Verhaltensmodellen und für die aktuelle politische Aufgabe des Kampfes gegen die imperialistische Politik der Zerreißung Deutschlands wurde das klassische Erbe nutzbar gemacht.
Goethefeier 1949. Thomas Mann in Begleitung von Johannes R. Becher und Paul Wandel (beide links hinter ihm) in Weimar, 1. August 1949
Wenn auch durch die undifferenzierte Ablehnung des Expressionismus relativiert, bildete die verständnisvolle Pflege des Erbes der Klassik unter bündnispolitischen Aspekten einen Weg, Angehörige der alten Intelligenz vom humanistischen Charakter der antifaschistisch-demokratischen Umwälzung unter Führung der Arbeiterklasse zu überzeugen. Die Beschlüsse der SED zum 200. Geburtstag Johann Wolfgang von Goethes, die Entschließung des Parteivorstandes „Unsere Aufgaben im Goethe-Jahr“ vom 10. März und sein Manifest „Zur Goethe-Feier der deutschen Nation“ vom 28. August 1949, regten zu einer Vielfalt von Aktivitäten an. Schon 1948 hatte das Nationaltheater Weimar als erstes wiederaufgebautes Theater seine Vorstellungen mit Goethes „Faust“ eröffnet. Nun wurden die kriegszerstörten Goethe-Gedenkstätten in Weimar restauriert, und die Goethe-Forschung erlebte einen Aufschwung. Die Goethe-Feier der Freien Deutschen Jugend im März, die Weimartage der Aktivisten im Juni, ein Novum in der deutschen Kulturgeschichte, und die Goethe-Festtage der deutschen Nation im August 1949 stellten Höhepunkte der Feierlichkeiten dar. Otto Grotewohls an die Jugend gerichtete Ansprache „Hammer oder Amboß“ im März enthielt den bis heute aktuellen Satz: „Die Herrschaft der Unmenschlichkeit, die Herrschaft der Drohung mit der Atombombe muß gebrochen werden, wenn die Menschlichkeit triumphieren soll. Die Menschheit hat es satt, Amboß zu sein, sie muß endlich Hammer werden.“ 132
Festakt anläßlich der Verleihung des Nationalpreises im Nationaltheater in Weimar, 1949
Die mit dem Goethe-Jubiläum verknüpften bündnispolitischen und nationalen Erwägungen erwiesen sich durchaus als produktiv, wie das Auftreten von Thomas Mann in Weimar und Frankfurt am Main offenkundig machte. Auch Johannes R. Becher behandelte in seiner Festansprache im August 1949 Goethes Bedeutung für die Einigung der Nation mit besonderem Nachdruck. Problematische Züge trug seine Rede jedoch in der Hinsicht, daß darin die qualitativen Unterschiede zwischen bürgerlichem und sozialistischem Humanismus nicht deutlich genug hervortraten.
Die erstmalige Verleihung von Nationalpreisen mit dem Bildnis Goethes am 25. August 1949 trug zur weiteren Sammlung wertvoller Kräfte der Geistes- und Kulturschaffenden bei und sicherte das Bündnis zwischen Arbeiterklasse und Intelligenz. Neben Künstlern wie Erich Engel, Paul Bildt, Gustav Seitz und Erich Weinert, Heinrich Mann, Carl Orff und Helene Weigel zählten Forscher und Gelehrte wie der Mediziner Robert Rössle, der Schwachstromspezialist Heinrich Barkhausen, der Germanist Theodor Frings, der Agrarwissenschaftler Hans Stubbe, der Chemiker Erich Correns, der Kunsthistoriker Richard Hamann, aber eben auch der Bergarbeiter Adolf Hennecke, um nur einige zu nennen, zu den ersten, denen dieser Preis für hervorragende wissenschaftliche, technische und künstlerische Leistungen zuerkannt wurde.
Insgesamt konnte die Arbeiterklasse Ende der vierziger Jahre im Bunde mit den anderen werktätigen Klassen und Schichten auf bedeutende Erfolge bei der revolutionären Umwälzung der Kulturverhältnisse zurückblicken. Sie sammelte in ihrer kulturpolitischen Arbeit zahlreiche neue Erfahrungen und drang zu wichtigen theoretischen und praktischen Fragestellungen und auch Erkenntnissen bei der marxistisch-leninistischen Beurteilung und Führung kultureller Prozesse vor, die den Boden für die Kulturentwicklung in der späteren DDR bereiteten.
Die Nationale Front des demokratischen Deutschland im Kampf gegen die westzonale Separatstaatsbildung
Inhaltsverzeichnis
- 1 Die Nationale Front des demokratischen Deutschland im Kampf gegen die westzonale Separatstaatsbildung
- 1.1 Die Gründung der NATO, der Erlaß des Besatzungsstatuts und die Verkündung des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland. Der Erlaß des „Kleinen Besatzungsstatuts“ für Westberlin
- 1.2 Der 3. Deutsche Volkskongreß. Die Annahme der Verfassung und die Neukonstituierung des Deutschen Volksrates
- 1.3 Die Verfassung der Deutschen Demokratischen Republik
- 1.4 Die Pariser Konferenz des Rates der Außenminister
- 1.5 Die Konstituierung der Bundesrepublik Deutschland
- 1.6 Die SED und die Nationale Front des demokratischen Deutschland
Die Gründung der NATO, der Erlaß des Besatzungsstatuts und die Verkündung des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland. Der Erlaß des „Kleinen Besatzungsstatuts“ für Westberlin
Nach langwierigen Verhandlungen unterzeichneten am 4. April 1949 die Außenminister Belgiens, Dänemarks, Frankreichs, Großbritanniens, Islands, Italiens, Kanadas, Luxemburgs, der Niederlande, Norwegens, Portugals und der USA den „Vertrag über Nordatlantische Verteidigungsorganisation“. Der NATO-Vertrag wurde auf 20 Jahre abgeschlossen und trat am 24. August 1949 in Kraft. Er verletzte nicht nur die Bestimmungen des britisch-sowjetischen und des französisch-sowjetischen Bündnisvertrages von 1942 bzw. 1944, sondern stand auch im Widerspruch zu den Abkommen von Jalta und Potsdam sowie zu anderen während des zweiten Weltkrieges abgeschlossenen Abkommen, in denen die Hauptmächte der Anti-Hitler-Koalition die Verpflichtung übernommen hatten, bei der Festigung des allgemeinen Friedens und der internationalen Sicherheit zusammenzuarbeiten. Darüber hinaus stellte die Teilnahme Italiens an der NATO eine Verletzung des 1947 unterzeichneten Friedensvertrages dar.
Unterzeichnung des NATO-Vertrages durch die Außenminister der Mitgliedstaaten in Washington, 4. April 1949
Angesichts der Ziele der aggressiven Kreise des Weltimperialismus, die Ergebnisse des zweiten Weltkrieges mit militärischer Stärke zu revidieren, und der von diesen Kreisen betriebenen Kriegshetze und psychologischen Kriegführung, die systematisch eskaliert wurden, konnte die NATO keineswegs als bloßes Verteidigungsbündnis eingeschätzt werden, wofür ihre Initiatoren sie ausgaben.
Für maßgebende Kreise der USA war die Einbeziehung des Potentials der BRD in die NATO schon lange vor deren Gründung eine beschlossene Sache. Ohne dieses Potential „mußte Europas Verteidigung eine bloße Nachhutaktion an der Atlantikküste bleiben“ 133, schrieb der amerikanische Präsident Truman in seinen Memoiren. Die Bildung des westzonalen Staates erfolgte daher in einem engen inneren und äußeren Zusammenhang mit der Schaffung der NATO. „Die Bundesrepublik wurde 1949 als eine Zwillingsschwester des Atlantikpaktes geboren. Vater war der kalte Krieg“, schrieb ein französischer Historiker zutreffend.134
Mit der NATO-Gründung und der ihr bereits im April 1948 vorausgegangenen Schaffung der „Organisation für europäische wirtschaftliche Zusammenarbeit“ (OEEC), der Marshallplanorganisation, sowie mit der bevorstehenden Konstituierung des Westzonenstaates, dessen Gebiet schon vorher in die OEEC und in die NATO integriert wurde, erfolgten historische Weichenstellungen, wurden grundlegende und weitreichende Entscheidungen gefällt und Tatsachen geschaffen. Hinzu kam, daß eine Remilitarisierung des im Entstehen begriffenen deutschen Separatstaates – von Konrad Adenauer als Sprecher maßgebender Kreise der Westzonen bereits seit Ende 1948/ Anfang 1949 gegenüber den westlichen Besatzungsmächten betrieben – durchaus zu erwarten war. Der Weltimperialismus hatte die Teilung der Welt vollzogen, organisierte die „westliche Welt“ zum Kampf gegen die sie angeblich bedrohende „kommunistische Welt“.
Während die kommunistischen Parteien und andere progressive Kräfte sowie mit ihnen zusammenarbeitende Friedenskräfte gegen NATO und imperialistische Kriegspolitik Front machten, ordnete sich die reformistische Arbeiterbewegung in den kapitalistischen Ländern mit antikommunistischer Frontstellung und der Bejahung von Marshallplan und NATO in die „westliche Welt“ ein. Dabei deutete alles darauf hin, daß mit dieser Entwicklung zugleich das Ziel „demokratischer Sozialismus“ in einem Westeuropa als „dritter Kraft“ zu Grabe getragen wurde.
Die Teilung der Welt, wie sie in dieser spezifischen Art und Weise durch den kalten Krieg bewirkt wurde, ging quer durch Deutschland. Sie spaltete auf die Dauer auch das deutsche Volk in zwei Staatsvölker. Dieser Prozeß war im Frühjahr 1949 bereits weit fortgeschritten.
Am 8. Mai 1949 wurde das „Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland“, wie sich der westzonale Staat nennen sollte, vom Parlamentarischen Rat mit 53 gegen 12 Stimmen angenommen. Aus grundsätzlichen Motiven stimmten allerdings nur die beiden Abgeordneten der KPD gegen die Annahme. Am 18., 20. und 21. Mai ratifizierten die Landtage von 10 der 11 westzonalen Länder das Grundgesetz. Eine Mehrheit im bayrischen. Landtag lehnte es ab, stimmte aber seiner Gültigkeit auch für Bayern zu, sofern es von zwei Dritteln der westzonalen Landtage angenommen würde. Am 23. Mai 1949 fand die Schlußsitzung des Parlamentarischen Rates, in der das Grundgesetz unterschrieben, ausgefertigt und verkündet wurde, statt. Im Namen der beiden kommunistischen Abgeordneten im Parlamentarischen Rat erklärte Heinz Renner auf dieser Sitzung: „Ich unterschreibe nicht die Spaltung Deutschlands!“ 135 Zugleich bekannten sich die Kommunisten zu den im Grundgesetz verankerten Friedensverpflichtungen und demokratischen Rechten und Freiheiten sowie zu deren Verteidigung.
Das Grundgesetz war die Verfassung eines Staates, der als Produkt des kalten Krieges und der Spaltung Deutschlands entstand. Er war das Ergebnis einer Neuordnung, die von der Restauration der Macht des Monopolkapitals und der traditionellen deutschen „Eliten“ dominiert wurde und den Übergang vom Faschismus zu einer bürgerlichen Demokratie in neuen Formen und mit neuen Leitbildern maßgeblich prägte. Dies kam in dem von ihm erhobenen, dem Wesen nach aggressiven Anspruch, „deutscher Kernstaat“ zu sein, deutlich zum Ausdruck. Durch die Konfrontation mit den antifaschistisch-demokratischen Verhältnissen im Osten Deutschlands war jedoch der Zwang zum bürgerlich-demokratischen Ausbau und zur sozialen Absicherung des staatsmonopolistischen Herrschaftssystems besonders groß.
Im Grundgesetz reflektierte sich unter diesen Bedingungen besonders zugespitzt die Grundproblematik bürgerlicher Verfassungen, bürgerliche Klassenherrschaft zugleich festzuschreiben und zu verschleiern, sozialen und demokratischen Forderungen Rechnung zu tragen, aber zugleich die staatsorganisatorischen Grundsätze der Monopolherrschaft zu fixieren. Wenn die bürgerlich-restaurativen Kräfte die Verfassungsarbeit auch dominiert hatten, so mußten sie doch jenen Faktoren und Forderungen sowie den gegebenen historischen Bedingungen und Erfordernissen Rechnung tragen.
Auf das Grundgesetz übten das demokratische Völkerrecht, wie es sich im Ergebnis des Kampfes der Völker der Anti-Hitler-Koalition entwickelt hatte, das Potsdamer Abkommen und andere alliierte Beschlüsse, soziale und antifaschistisch-demokratische Forderungen der Kämpfe der Nachkriegszeit in den Westzonen, westzonale Länderverfassungen, Vorstellungen und Forderungen der sozialdemokratischen und Gewerkschaftsbewegung und andere Faktoren ihren Einfluß aus.
Das Grundgesetz anerkennt die allgemeine Gültigkeit der Regeln des Völkerrechts (Artikel 25), formuliert ein ausdrückliches Friedensgebot (Artikel 26) und stellt „Handlungen, die geeignet sind und in der Absicht vorgenommen werden, das friedliche Zusammenleben der Völker zu stören, insbesondere die Führung eines Angriffskrieges vorzubereiten“ 136, unter Strafe (Artikel 26,1).
In Artikel 20 ist der Grundsatz einer Volkssouveränität verankert, die auch durch Volksabstimmungen wahrgenommen werden kann. In welcher Form das geschehen soll, blieb allerdings offen und umstritten; die Institution des Volksentscheids wurde ausgeklammert.
Die Artikel 1 bis 19 beinhalten die klassischen bürgerlichen Grund- und Freiheitsrechte. Unabhängig von den Motiven der Schöpfer des Grundgesetzes ermöglichen sie das verfassungsmäßige Ringen um demokratische und freiheitliche Rechte, um sozialen Fortschritt, für Frieden und Völkerverständigung. Die Artikel 14 und 15 gestatten die Überführung von Betrieben oder Industriezweigen in Gemeineigentum.
Zugleich allerdings spiegelte das Grundgesetz deutlich die Absicht seiner Schöpfer wieder, „die demokratischen Freiheiten des Volkes weitgehend auf ein System formaler Rechtsgarantien einzuengen, das dazu bestimmt und geeignet war, die Frage nach den Rechten der Bürger zu individualisieren, demokratische Aktionen zu kanalisieren und den bestehenden Machtstrukturen zuzuordnen“.137
Festgeschrieben wurden eine repräsentative und keine plebiszitäre Demokratie, ein Rechtsstaat im Sinne eines Rechtswegestaates der Instanzen, die Dominanz der Exekutive gegenüber der Legislative. Die verfassungsmäßigen Möglichkeiten des Ringens um sozialen Fortschritt, demokratische Rechte und Friedensgewährleistung waren so formuliert bzw. in ein solches Normensystem integriert, daß zugleich und vor allem die bestehende bzw. restaurierte monopolkapitalistische Gesellschafts- und Staatsordnung festgeschrieben wurde.
Mit den Maßstäben anderer bürgerlicher Verfassungen gemessen, konnte das Grundgesetz in weiten Passagen – trotz vieler Schwächen und Mängel – bestehen, und es eröffnete auch Möglichkeiten für eine progressive soziale und demokratische Ausgestaltung der Bundesrepublik und für die Durchsetzung einer dem Frieden verpflichteten Außenpolitik. Doch ob diese Möglichkeiten genutzt wurden, das war abhängig vom Klassenkräfteverhältnis und von der Stärke progressiver, demokratischer, um den Frieden ringender Kräfte und Bewegungen.
Annahme des Grundgesetzes durch den Parlamentarischen Rat, 8. Mai 1949, Die beiden Abgeordneten der KPD, Max Reimann (erste Reihe links) und Heinz Renner (zweite Reihe links), enthalten sich der Beifallsbekundung.
Den Anforderungen einer solchen Faschismus- und Militarismusbewältigung bzw. friedenssichernden Demokratisierung allerdings, deren Maßstäbe sich aus dem Potsdamer Abkommen ergaben, entsprach das Grundgesetz nicht. In ihm reflektierte sich ganz folgerichtig das erhebliche Defizit an Faschismusbewältigung und antimonopolistischer Demokratisierung in den Westzonen. Das Grundgesetz gebot keinerlei Maßnahmen im Sinne oder in der Richtung von Entnazifizierung und Entmonopolisierung. Mit Artikel 131 wurde faktisch die Entnazifizierung des Staatsapparates rückgängig gemacht und der Rückkehr ehemaliger Nazis in Rang und Würden Tür und Tor geöffnet.
Während der Zusammenkunft der Militärgouverneure der drei Westmächte mit Vertretern des Parlamentarischen Rates und der Länder anläßlich der Verkündung des Besatzungsstatuts und der Übergabe des genehmigten Grundgesetzes, 12. Mai 1949
Vor allem aber galt die Bundesrepublik gemäß dem Grundgesetz und dem Konzept der maßgebenden „Gründerväter“ als „deutscher Kernstaat“, als alleiniger Nachfolger des Deutschen Reiches, der im Namen aller Deutschen handelt und spricht und neben dem es keinen anderen deutschen Staat geben kann. Das Grundgesetz enthielt damit – insbesondere in seiner Präambel und in Artikel 116 – eine Alleinvertretungsanmaßung in bezug auf das gesamte deutsche Volk und zugleich die Kampfansage an einen zweiten deutschen Staat – der im Grunde zur Irredenta erklärt wurde –, das faktische Gebot, einen anderen deutschen Staat nicht anzuerkennen, ihn vielmehr zu beseitigen und sein Gebiet in den Staatsverband der BRD einzubeziehen. Entsprechende Postulate wurden hinsichtlich der ehemaligen deutschen Gebiete jenseits von Oder und Neiße und gegenüber den Staaten, zu deren Gebietsstand diese Territorien im Gefolge des zweiten Weltkrieges unwiderruflich gehörten, verankert. Damit fanden in das Grundgesetz Zielsetzungen Eingang, die eine Orientierung auf die Revision der Ergebnisse des zweiten Weltkrieges und der Nachkriegsentwicklung beinhalteten. Wenngleich versichert wurde, daß sie nur mit friedlichen Mitteln angestrebt würden, waren sie doch besorgniserregend. Sie hatten – vor allem als Bestandteil des kalten Krieges – eine aggressive und friedensgefährdende Stoßrichtung. Und sie gaben revanchistischen Kräften und Bestrebungen kräftigen Auftrieb.
In diesen Kontext ordneten sich auch die Versuche des Parlamentarischen Rates ein, ganz Berlin oder zumindest doch Westberlin als Land in die BRD einzugliedern. Diesem Versuch – wenn auch nur halbherzig – entgegenzutreten sahen sich allerdings die Westmächte, die sich ihrer problematischen Situation in Westberlin bewußt waren, veranlaßt.
Die Möglichkeiten, das Grundgesetz für progressive politische und soziale Bestrebungen zu nutzen, wurden entscheidend durch die Verfassungswirklichkeit und zusätzlich durch das Besatzungsstatut, das dem Grundgesetz übergeordnet war, eingeschränkt. Ein Volksentscheid über das Grundgesetz – und damit bis zu einem gewissen Grade auch über die Staatsbildung selbst – wurde von den Gründern der BRD bewußt vermieden. Die BRD konnte von der Bevölkerung zunächst lediglich hingenommen werden – und das wurde sie, weil für die Mehrheit keine Alternative greifbar schien.
Die BRD entstand bei weiterbestehender Kontrolle und militärischer Präsenz der Westmächte und in Abhängigkeit von diesen. Dieser Zustand wurde mit dem Besatzungsstatut fixiert, das von den Westmächten am 8. April 1949 beschlossen und am 12. Mai zusammen mit der Genehmigung des Grundgesetzes verkündet wurde. Im Besatzungsstatut behielten sich die Westmächte unter anderem das Recht der Entscheidung über folgende Bereiche vor: Abrüstung und Entmilitarisierung; Dekartellisierung, Dekonzentration und Reparationen; Kontrolle der Ruhrindustrie, des Außenhandels und des Devisenverkehrs; auswärtige Angelegenheiten einschließlich internationale Abkommen. Den Behörden des Westzonenstaates sollte „volle Freiheit“ in der Verwaltung und in der Gesetzgebung eingeräumt werden, wobei sich die Besatzungsbehörden das Einspruchsrecht vorbehielten. Änderungen des Grundgesetzes und der Länderverfassungen bedurften gleichfalls der Zustimmung der Besatzungsbehörden. Auch das Besatzungsstatut enthielt den bereits in die Frankfurter Direktiven aufgenommenen Passus: „Die Besatzungsbehörden behalten sich jedoch das Recht vor, auf Anweisung ihrer Regierungen ganz oder teilweise die volle Gewalt auszuüben, wenn sie dies als wesentlich ansehen für die Sicherheit oder die Aufrechterhaltung der demokratischen Regierungsform in Deutschland oder als Folge. Der internationalen Verpflichtungen ihrer Regierungen.“ 138
„Die Westmächte versprachen eine Überprüfung des Besatzungsstatuts und eventuelle Erweiterungen der deutschen Zuständigkeitsbereiche 12 bzw. 18 Monate nach seinem Inkrafttreten. Am 29. April 1949 unterzeichneten die sechs Signatarmächte der „Londoner Empfehlungen“ in London das Abkommen über das Ruhrstatut, mit dem sie die Produktion und Verteilung von Stahl, Kohle und Koks an der Ruhr unter ihre Kontrolle stellten. Dies hatte nichts gemein mit der internationalen Kontrolle des Ruhrgebietes, die in den Verhandlungen der Hauptmächte der Anti-Hitler-Koalition, insbesondere von der Sowjetunion, zum Zwecke der Friedenssicherung vorgeschlagen worden war und antimonopolistisch-demokratische Veränderungen einschloß. Das Ruhrstatut sollte vielmehr das Nutzbarmachen des Ruhrmontanpotentials für die Westblockpolitik gewährleisten – gemäß den Interessen der herrschenden Kreise Westeuropas und unter Mißachtung oder Benachteiligung der Interessen des deutschen Volkes.
Mit der Verkündung des Besatzungsstatuts und der Annahme des Grundgesetzes trat – eingebettet in die Bildung des Westblocks und der NATO – die Schaffung des westzonalen deutschen Staates in ihr letztes Stadium. Zugleich entstanden neue Komplikationen im Zusammenhang mit den Vereinbarungen zur Beilegung der Berliner Krise.
In den auf sowjetische Initiative begonnenen New-Yorker Gesprächen der UdSSR und der USA gelang es der sowjetischen Seite, Fortschritte in Richtung auf eine Beilegung der Berliner Krise und eine Vereinbarung über die Einberufung einer erneuten Konferenz des Rates der Außenminister zur deutschen Frage zu erzielen. Die Westmächte sicherten zu, daß bis dahin keine westzonale Regierung gebildet werde. Auf der Grundlage dieser Übereinkunft kam es zum New-Yorker Kommuniqué der Sowjetunion und der Westmächte vom 4. Mai 1949. Beide Seiten kündigten darin die Aufhebung sämtlicher seit dem 1.März 1948 getroffenen Einschränkungen im Verkehr und im Transport zwischen den Westzonen und Berlin sowie zwischen den Westzonen und der Ostzone mit Wirkung vom 12. Mai 1949 an und beriefen die nächste Konferenz des Rates der Außenminister ein, die ab 23. Mai 1949 in Paris tagen sollte. An der Beilegung der Berliner Krise, der Regelung des Österreichproblems sowie anderer Fragen interessiert und um Verhandlungsbereitschaft zu demonstrieren, akzeptierten die Westmächte den sowjetischen Vorschlag, obwohl sie festen Willens waren, an ihrem Kurs auf Gründung des Westzonenstaates unbeirrt festzuhalten.
Die Einberufung der Konferenz des Rates der Außenminister hielt die Westmächte nicht davon ab, in bezug auf Westberlin weitere vollendete Tatsachen zu schaffen. Sie erließen am 14. Mai 1949 ein gesondertes Besatzungsstatut, das „Kleine Besatzungsstatut“ 139, für die Westsektoren und bildeten für diese eine gesonderte Dreimächtekommandantur. Die Haltung der Westmächte führte dazu, daß die akute Berliner Krise zwar beigelegt wurde, dies aber auf der Grundlage der Spaltung der Stadt und der Konsolidierung der Westsektoren als Protektorat der Westmächte erfolgte. Diesem Protektorat wurde von den Westmächten und von jenen Kräften, die von deutscher Seite Berlin gespalten hatten, die Funktion einer „Frontstadt des kalten Krieges“ und eines „Schaufensters der freien Welt“ zur Unterminierung und Störung der antifaschistisch-demokratischen Verhältnisse in der Ostzone zugedacht.
Unterzeichnung des „Kleinen Besatzungsstatuts“ für Westberlin durch die Stadtkommandanten der drei Westmächte, 14. Mai 1949
Wahlen zum 3. Deutschen Volkskongreß, 15. und 16. Mai 1949. Wahllokal in Dresden
In diesem Sinne bestreikte in der letzten Maidekade 1949 die UGO die S-Bahn in Westberlin. S-Bahnhöfe wurden widerrechtlich besetzt, Krawalle inszeniert, Gleisanlagen und technische Einrichtungen zerstört – bis auf Grund einer Weisung der Westmächte der normale S-Bahn- und Fernbahnverkehr in Westberlin am 1. Juli 1949 wieder aufgenommen werden konnte. Eine solche Zuspitzung der Lage wurde symptomatisch. Statt der akuten Berliner Krise gab es nun einen die internationalen Beziehungen, den Frieden und normale Verhältnisse auf deutschem Boden auf unabsehbare Zeit schwer belastenden Dauerkonflikt, ausgehend von und um Westberlin.
Der 3. Deutsche Volkskongreß. Die Annahme der Verfassung und die Neukonstituierung des Deutschen Volksrates
Das Präsidium des Deutschen Volksrates nahm am 9, Mai 1949 eine Entschließung an, in der es sich voll hinter die Beschlüsse des Weltfriedenskongresses von Paris und Prag stellte, die Einberufung des Rates der Außenminister begrüßte, die erfolgte Annahme des Grundgesetzes für einen westdeutschen Separatstaat durch den Parlamentarischen Rat in Bonn verurteilte und das gesamte deutsche Volk aufrief, „sich für den III. Deutschen Volkskongreß zu erklären“.140
Das Präsidium des Deutschen Volksrates kündigte an, daß die 1500 Delegierten zum 3.Deutschen Volkskongreß – aufgeschlüsselt auf die Länder der Ostzone und den demokratischen Sektor Berlins bzw. auf 20 Stimmbezirke – am 15. und 16. Mai 1949 in allgemeinen, geheimen und direkten Wahlen gewählt werden sollten, und rief zur Beteiligung an diesen Wahlen auf. Diese Form seines Zustandekommens unterschied den 3. vom 1. und 2. Deutschen Volkskongreß. Der 3. Deutsche Volkskongreß und der von ihm neuzuwählende Deutsche Volksrat sollten als Volksvertretung durch allgemeine und geheime Wahlen legitimiert werden.
Die Situation, in der die Wahlen stattfanden, war außerordentlich angespannt. Grundlegende Umwälzungen und eine geschichtliche Wende waren im Osten Deutschlands vollbracht worden; doch die Folgen von Faschismus und Krieg waren noch immer nicht überwunden, die Zeit der Erfolge hatte eben erst begonnen. Der kalte Krieg und die Rückwirkungen der Spaltung Deutschlands erschwerten das weitere Voranschreiten beträchtlich. Die Bündnispartner der Arbeiterklasse befanden sich in komplizierten Veränderungs- und Umdenkungsprozessen. Ein Teil von ihnen war durch restriktive und fehlerhafte Maßnahmen verunsichert – das Vertragssystem steckte noch in den Anfängen. Auch Teile der Arbeiterklasse hatten Mühe, sich zurechtzufinden und sich den neuen Anforderungen zu stellen. Sie teilten viele Illusionen in bezug auf die westzonale Entwicklung, und bestimmte Erscheinungsformen sich zuspitzender ideologischer Auseinandersetzungen verwirrten sie.
Andererseits hatte sich das Gros der Arbeiterklasse der Ostzone in den Klassenkämpfen bewährt, war im Vollzug der revolutionären Umwälzungen – sich fest mit diesen verbindend – gewachsen und im Zuge der marxistisch-leninistischen Entwicklung der SED und der Entwicklung des FDGB gereift. Entscheidende Bündnisbeziehungen waren stabilisiert, der Block gefestigt worden. Die von der 1.Parteikonferenz der SED entwickelte Generallinie bewährte sich – wenngleich sie in bezug auf die Bündnis- und Blockpolitik örtlich mitunter einseitig ausgelegt oder nur halbherzig verfolgt wurde. In den mit der SED im Block zusammenarbeitenden Parteien drängten die Kräfte, die sich fest mit den Zielen der Volkskongreßbewegung und mit dem Ausbau der antifaschistisch-demokratischen Verhältnisse verbanden, deutlich nach vorn.
3. Deutscher Volkskongreß, 29. bis 30. Mai 1949. Blick auf das Präsidium bei der Annahme des Entwurfs der Verfassung der Deutschen Demokratischen Republik
Bürgerlich-restaurative und auch sozialdemokratische Kreise trugen von den Westzonen und Westberlin aus gemeinsam mit reaktionären Kräften in der Ostzone massierte politisch-ideologische Angriffe gegen die antifaschistisch-demokratischen Verhältnisse und für die Einbeziehung der Länder der Ostzone in den Geltungsbereich des Grundgesetzes vor. Sie versuchten, den Block auseinanderzubrechen und die SED zu isolieren. Nachdem das nicht gelang, riefen sie die Bevölkerung der sowjetischen Besatzungszone zum Wahlboykott auf. Aber auch damit konnten sie ihr Ziel nicht erreichen.
Vorbereitung und Durchführung der Wahlen zum 3. Deutschen Volkskongreß wurden in der Ostzone zu einer harten Bewährungsprobe, zugleich aber zu einem Höhepunkt des politischen Lebens. In unzähligen von der SED, den anderen Parteien sowie dem FDGB, der FDJ und weiteren gesellschaftlichen Organisationen durchgeführten bzw. mitgetragenen Versammlungen und Kundgebungen sowie in persönlichen Gesprächen mit vielen Menschen gelang es, in breiten Kreisen der Bevölkerung ein vertieftes Verständnis für die Ziele der Volkskongreßbewegung zu erreichen, Vorurteile abzubauen, die Gegenpropaganda zurückzudrängen.
An den Wahlen zum 3.Deutschen Volkskongreß am 15. und 16. Mai 1949 beteiligten sich 95 Prozent der Wahlberechtigten der Ostzone. Zwei Drittel von ihnen stimmten für die vom Volksrat unterbreiteten Kandidatenlisten für den 3. Volkskongreß, ein Drittel dagegen. Damit verbuchte die Volkskongreßbewegung einen politisch schwer errungenen, aber klaren Erfolg. Die Hegemonie der Arbeiterklasse im Rahmen eines breiten sozialen und politischen Bündnisses, die antifaschistisch-demokratischen Errungenschaften im Osten Deutschlands und damit die Bastion des Friedens auf deutschem Boden wurden bekräftigt bzw. gestärkt. Die besten Wahlergebnisse wurden in einer Reihe Arbeiterzentren, in Neubauerngebieten und unter den jugendlichen Wählern erzielt. Insbesondere in Mecklenburg zeigte sich, daß sich „offenbar die Mehrzahl der Umsiedler für die Kandidaten des 3. Deutschen Volkskongresses entschieden hatte“ 141
Das Wahlergebnis war für den Kampf um Einheit und Frieden und für die Festigung der antifaschistisch-demokratischen Verhältnisse von weittragender Bedeutung. Die Nein-Stimmen eines Drittels der Wähler signalisierten die große politische Bewährungsprobe, die noch bevorstand. Allerdings hatte nur ein Teil dieser Wähler aus grundsätzlichen Erwägungen mit „Nein“ gestimmt; viele hatten sich von augenblicklichen Stimmungen und Verärgerungen leiten lassen.
Der 3. Deutsche Volkskongreß tagte am 29. und 30.Mai 1949 in der DeutschenStaatsoper (Admiralspalast) in Berlin. An ihm nahmen 1441 gewählte Delegierte aus der Ostzone sowie 528 Repräsentanten aus den Westzonen teil. Die hier gehaltenen Referate und die Aussprache dazu wurden von zwei miteinander verbundenen Notwendigkeiten bzw. Zielsetzungen geprägt: Zum einen ging es – wie Wilhelm Pieck einleitend feststellte – darum, „neue Kräfte in diese Bewegung für Einheit und gerechten Frieden und wirtschaftlichen Aufstieg“ 142 einzubeziehen, die Volkskongreßbewegung zur Nationalen Front zu erweitern, um den Kampf.gegen die Spaltung Deutschlands zu verstärken und der erneuten Bedrohung des Friedens auf deutschem Boden durch Westzonenstaat und NATO entgegenzuwirken. Zum anderen galt es, die entscheidenden staatsorganisatorischen Voraussetzungen und Grundlagen für die Errichtung einer deutschen demokratischen Republik zu schaffen. Der Kongreß verabschiedete ein „Manifest an das deutsche Volk“ 143, in dem die Erweiterung der Volkskongreßbewegung zur „Nationalen Front für Einheit und gerechten Frieden“ verkündet und zu deren Stärkung „für ein einiges, unabhängiges, friedliches Deutschland, für den baldigen Abschluß eines Friedensvertrages und den Abzug der Besatzungstruppen“ aufgerufen wurde. Zugleich wurden in dem Manifest die vom Präsidium des Deutschen Volksrates erarbeiteten Vorschläge für die Vorbereitung einer Friedenskonferenz und die von deutscher Seite vorzuschlagenden „Grundsätze für den Friedensvertrag“ dargelegt. Diese bezogen sich sowohl auf die „Pflichten des deutschen Volkes“ gegenüber den Völkern der Anti-Hitler-Koalition als auch auf sein Recht auf Schaffung einer Verfassung für ganz Deutschland und auf eine freie Entwicklung der deutschen Friedenswirtschaft „unter Ausschluß der kapitalistischen Monopolherren und Großgrundbesitzer“. Der Volkskongreß wählte 22 Mitglieder einer Delegation, die auf der Pariser Außenministerkonferenz den Standpunkt der demokratischen Kräfte des deutschen Volkes darlegen sollte.
Höhepunkt des Kongresses war die Rede Otto Grotewohls über die Verfassung der Deutschen Demokratischen Republik. Der Vorsitzende des Verfassungsausschusses führte dazu aus: „Der Deutsche Volksrat hat sich mit dem von ihm beschlossenen Entwurf der Verfassung der Deutschen Demokratischen Republik an alle Deutschen gewandt und hier den Plan der Reorganisation des deutschen Staates auf demokratischer Grundlage unterbreitet. Hier zeigen wir unserem deutschen Volke, den Alliierten und darüber hinaus der ganzen Welt, auf welcher Grundlage wir Deutsche das zukünftige Deutschland aufzubauen trachten, zu dessen Errichtung uns in den Pakten von Jalta und Potsdam der Weg eröffnet worden ist. Wir sind bei dem Ausbau dieser Verfassung keinen fremden Vorbildern gefolgt. Für uns gab es nur einen Lehrmeister: unsere eigene Geschichte, die so reich an Erfahrungen, so reich an Fehlschlägen und Enttäuschungen ist. – Alles, was gut und gesund in unserer Vergangenheit war, soll leben und eine bessere Zukunft beflügeln.“144
Nachdem der Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt, Erhard Hübener (LDPD), im Auftrag sämtlicher Arbeitsgemeinschaften des 3. Deutschen Volkskongresses deren vorbehaltlose Zustimmung zum vorliegenden Verfassungsentwurf erklärt hatte, wurde dieser von den Delegierten des Volkskongresses in einer Abstimmung einmütig bestätigt. Die Delegierten wählten mit ihrer aus freien und geheimen Wahlen hervorgegangenen Legitimation den Deutschen Volksrat mit 330 Mitgliedern neu. Davon gehörten 90 der SED an, 45 der CDU, 45 der LDPD, 15 der DBD, 15 der NDPD, 5 der Sozialdemokratischen Fraktion Berlin, 30 dem FDGB, 10 der FDJ, 10 dem DFD, 10 dem Kulturbund, 5 der VdgB, 10 der VVN, 5 den bäuerlichen Genossenschaften; 35 waren Einzelpersönlichkeiten aus der sowjetischen Besatzungszone. In seiner ersten Sitzung wählte der Deutsche Volksrat sein Präsidium und dessen Vorsitzende Wilhelm Pieck (SED), Otto Nuschke (CDU) und Hermann Kastner (LDPD). Später, im Juli 1949, wurden Ernst Goldenbaum (DBD) und Lothar Bolz (NDPD) gleichfalls zu Vorsitzenden gewählt. Außerdem wurde ein Sekretariat unter Leitung von Wilhelm Koenen, Mitglied des Parteivorstandes der SED, gebildet.
Mit dieser im Ergebnis der Wahlen vom Mai 1949 erfolgten Neukonstituierung des Deutschen Volksrates entstand die Möglichkeit, daß dieser noch weiter gehend und wirksamer Funktionen einer zentralen Volksvertretung für die Ostzone wahrnehmen konnte. Ein Kennzeichen der in diesem Zusammenhang vor, auf und auch nach dem 3. Deutschen Volkskongreß geführten Diskussionen bestand allerdings darin, daß die Notwendigkeit und Wahrscheinlichkeit, die Deutsche Demokratische Republik nur im Rahmen der sowjetischen Besatzungszone errichten zu können, mit Sicht auf den noch nicht vollständig abgeschlossenen Konstituierungsprozeß des Westzonenstaates in den öffentlichen Diskussionen auch weiterhin nicht angesprochen wurde.
Die Verfassung der Deutschen Demokratischen Republik
Als Ausgangspunkt der vom 3. Deutschen Volkskongreß bestätigten Verfassung der Deutschen Demokratischen Republik wurde in deren Präambel der Willen genannt, „die Freiheit und die Rechte des Menschen zu verbürgen, das Gemeinschafts- und Wirtschaftsleben in sozialer Gerechtigkeit zu gestalten, dem gesellschaftlichen Fortschritt zu dienen, die Freundschaft mit allen Völkern zu fördern und den Frieden zu sichern …“ 145
Das entscheidende Merkmal dieser Verfassung, das sie im Vergleich zur Weimarer Verfassung und zum Grundgesetz der BRD als qualitativ anderen Verfassungstyp auswies, bestand in der konsequenten Durchsetzung des Prinzips der Volkssouveränität – bei Überwindung der bürgerlichen Institution der Gewaltenteilung – und in der Garantierung dieses Grundsatzes. Artikel 3 legte nicht nur fest, daß alle Staatsgewalt vom Volke“ ausgeht, sondern markierte zugleich die Wege, wie das zu geschehen habe. Als Ziel und Inhalt der Ausübung der Staatsgewalt legte er eindeutig fest: „Die Staatsgewalt muß dem Wohl des Volkes, der Freiheit, dem Frieden und dem demokratischen Fortschritt dienen … Die im öffentlichen Dienst Tätigen sind Diener der Gesamtheit und nicht einer Partei. Ihre Tätigkeit wird von der Volksvertretung überwacht.“ 146
Die Volksvertretungen wurden zu den alleinigen Machtorganen und die Volkskammer zum höchsten Organ der Republik erklärt. Bei ihr wurde die oberste Staatsgewalt der Republik konzentriert. Die Verfassung legte die Einheit von Gesetzgebung und Durchführung der Gesetze und die höchste Verantwortung der Volkskammer für die Rechtsprechung fest. Bei ihr lag die Gesetzeskompetenz in allen Angelegenheiten von gesamtstaatlicher Bedeutung. Alle anderen konnten von den Ländern bzw. den Landtagen selbständig entschieden werden. Den Länderorganen oblag die Ausführung der beschlossenen Gesetze. Den Gemeinden und Gemeindevorständen wurde das Recht auf Selbstverwaltung im Rahmen der Gesetze der Republik und der Länder zugesprochen.
Obwohl die vom 3. Deutschen Volkskongreß verabschiedete Verfassung vorrangig auf die Errichtung einer gesamtdeutschen demokratischen Republik ausgerichtet war, verankerte sie zugleich die Ergebnisse des erfolgreichen Ringens der Arbeiterklasse und ihrer Verbündeten um die restlose Beseitigung und Bewältigung von Faschismus und Militarismus, die Errungenschaften der antifaschistisch-demokratischen Umwälzung und des demokratischen Neuaufbaus als entscheidende Grundlage des zukünftigen Staates. In Artikel 24 wurden private Monopolorganisationen und privater Großgrundbesitz verboten, die Betriebe aller Nazi- und Kriegsverbrecher, die Bodenschätze und die Betriebe der Grundstoffindustrie zum Volkseigentum erklärt und die Ergebnisse der Bodenreform bestätigt. Die Wirtschaftsordnung sollte nach den Grundsätzen sozialer Gerechtigkeit und mittels Wirtschaftsplanung zum Wohle der Menschen gestaltet werden. Verbrieft wurden die Rechte auf Arbeit, auf gleichen Lohn für gleiche Arbeit und Leistung, auf Bildung, Erholung und Freizeit, auf Schutz des Lebens und der Gesundheit; die Gleichberechtigung der Frau und die Förderung der Familie, der Schutz und die Förderung der Jugend, die Pflege von Kunst und Wissenschaft.
Dies waren zugleich die entscheidenden Garantien für die tatsächliche Verwirklichung der Volkssouveränität auf dem Wege der Ausübung der Staatsgewalt durch die Arbeiterklasse und ihre Verbündeten und durch die materielle, politisch-staatliche und juristische Gewährleistung der staatsbürgerlichen Grundrechte. Diese Grundrechte waren nicht der Staatsgewalt entgegengestellt, sondern gipfelten in den Rechten jedes Bürgers, an der Gestaltung des politischen, des wirtschaftlichen und des geistig-kulturellen Lebens teilzunehmen.
Die Verfassung der Deutschen Demokratischen Republik wies sich eindeutig als die Verfassung eines deutschen demokratischen Friedensstaates aus. Sie erklärte die anerkannten Regeln des Völkerrechts für die Staatsgewalt und für jeden Bürger als bindend, formulierte ein verpflichtendes Gebot, für und im Geiste des Friedens zu wirken, vor allem aber fixierte sie die Ergebnisse eines erfolgreichen Ringens um Friedenssicherung auf deutschem Boden, um die Beseitigung der gesellschaftlichen Wurzeln von Krieg und imperialistischer Aggressionspolitik, um die Überwindung aller Krieg und Aggression verherrlichenden oder ihnen dienenden Ideologien. Bekundungen von Völkerhaß, militaristische Propaganda und Kriegshetze wurden als Verbrechen unter Strafe gestellt.
Jedem Bürger wurde die volle Glaubens- und Gewissensfreiheit verbrieft. Die Freiheit der Vereinigung zu Religionsgemeinschaften und deren ungehinderte Tätigkeit im Rahmen der Verfassung wurden garantiert. Bei strikter Trennung von Kirche und Staat, Kirche und Schule, der Aufhebung jeder Form obligaten Religionsunterrichts erhielten die Kirchen das Recht, mit eigenen Kräften in den Räumen der Schule Religionsunterricht zu erteilen.
Die Verfassung verankerte die Errungenschaften der demokratischen Schul- und Hochschulreform und gewährleistete jedem Kind das gleiche Recht auf allseitige Entfaltung seiner körperlichen, geistigen und sittlichen Kräfte. Alle Gesetze und Bestimmungen, die Benachteiligungen durch außereheliche Geburt bewirkten, galten als aufgehoben.
Alles in allem reflektierte diese Verfassung die geschichtliche Wende, die seit 1945 in der Ostzone vollzogen worden war, und schrieb sie fest. In ihrer Übereinstimmung mit den Prinzipien und Zielen des Potsdamer Abkommens enthielt sie zugleich eine Art normative Orientierung für die Westzonen im Falle einer Vier-Mächte-Friedensregelung und der Bildung eines einheitlichen, demokratischen deutschen Staates. Sie knüpfte dabei an antimonopolistisch-demokratische Bestimmungen und Normative an, wie sie in Verfassungen westzonaler Länder enthalten waren. Die Verfassung der Deutschen Demokratischen Republik war die Verfassung für einen neuen deutschen Staat der Friedenssicherung, der Demokratie, der sozialen Gerechtigkeit und des gesellschaftlichen Fortschritts. Wenn dieser Staat auf dem Gebiet der Ostzone errichtet wurde, dann konnte er von Anfang an auf der grundlegenden Übereinstimmung von Verfassung und Verfassungswirklichkeit gründen. Indem die Verfassung den gesellschaftlichen Fortschritt zum Verfassungsgrundsatz erhob, ermöglichte sie zugleich die notwendige Weiterentwicklung des wirtschaftlichen, politisch-staatlichen und geistig-kulturellen Lebens jenes Staates.
Die Pariser Konferenz des Rates der Außenminister
Am 23. Mai 1949 hatte in Paris, wie vereinbart, die Konferenz der Außenminister der UdSSR, der USA, Großbritanniens. Und Frankreichs begonnen. Sie dauerte bis zum 20. Juni.
Die Direktive der Regierung der UdSSR an die sowjetische Konferenzdelegation wies diese an, „den auf die Vereitelung einer Friedensregelung mit Deutschland, auf die Spaltung Deutschlands oder auf eine Vereinigung Deutschlands auf antidemokratischer Grundlage gerichteten Plänen der drei Westmächte ihren von den Potsdamer Beschlüssen ausgehenden Plan entgegenzustellen, der das Verhalten gegenüber Deutschland als ein ‚einheitliches Ganzes, die Umgestaltung Deutschlands in einen demokratischen und friedliebenden Staat und den Abschluß eines Friedensvertrages mit Deutschland vorsieht, damit die Besatzungstruppen binnen eines Jahres nach dem Abschluß des Friedensvertrages abgezogen werden können.“ 147
Gemäß ihrer Direktive rang die sowjetische Delegation, geleitet von Außenminister A. J. Wyschinski, prinzipienfest, aber konstruktiv und kompromißbereit um eine für alle Seiten annehmbare, die Interessen des deutschen Volkes berücksichtigende Viermächteregelung der deutschen Frage.
Hinsichtlich des Abschlusses eines deutschen Friedensvertrages unterbreitete der sowjetische Außenminister am 10. Juni einen Dreipunkteplan. Dieser sah vor, daß die Regierungen der vier Mächte „innerhalb von drei Monaten dem Außenministerrat Entwürfe eines Friedensvertrages mit Deutschland vorlegen sollten“, „daß in diesen Entwürfen für den Friedensvertrag mit Deutschland der Abzug der Besatzungstruppen aller Mächte aus Deutschland im Laufe eines Jahres nach Abschluß des Friedensvertrages vorgesehen werden sollte“ und „daß auf der gegenwärtigen Tagung des Außenministerrates die Erörterung des Verfahrens für die Vorbereitung des Friedensvertrages abgeschlossen wird“.148
Die Außenminister der Westmächte, Dean G. Acheson (USA), Ernest Bevin (Großbritannien) und Robert Schuman (Frankreich), suchten den Anschein zu erwecken, als ob sie ebenfalls an einer solchen Regelung interessiert seien. Sie hatten jedoch keine Order, über die „Londoner Empfehlungen“ zu verhandeln. So konnten sie nur Vorschläge einbringen, von denen sie wußten, daß diese für die Sowjetunion unannehmbar waren. Sie schlugen die Einbeziehung der Länder der Ostzone in den Geltungsbereich des Grundgesetzes der BRD, ein Besatzungsstatut für ganz Deutschland und die Viermächtekontrolle durch eine Hohe Kommission vor, deren Entscheidungen auf der Grundlage der Stimmenmehrheit getroffen werden sollten.
Ebensowenig wie die Westmächte bereit waren, ihre Pläne in bezug auf die Westzonen zugunsten einer echten Viermächteregelung zu revidieren, zeigten sie sich bezüglich Berlins zu einer Lösung geneigt, die über den Status quo vom 4.Mai 1949 hinausging. Der strategische Vorposten Westberlin erschien ihnen wichtiger als jede Vereinbarung, die zur Wiederherstellung einer einheitlichen Stadtverwaltung geführt hätte.
Wie in London 1947 weigerten sich die drei westlichen Außenminister auch in Paris, eine Delegation des Deutschen Volksrates zu empfangen.
Anders als die über Deutschland verliefen die Verhandlungen über Österreich. Die Außenminister konnten sich über viele grundsätzliche Fragen des österreichischen Staatsvertrages einigen. Ihre Stellvertreter wurden beauftragt, bis spätestens zum 1. September 1949 den Textentwurf dafür vorzulegen.
In dem gemeinsamen Schlußkommuniqué der Pariser Konferenz149 hieß es, daß es nicht möglich gewesen sei, „ein Übereinkommen über die Wiederherstellung der wirtschaftlichen und politischen Einheit Deutschlands zu erzielen“. Zugleich wurde die Bereitschaft erklärt, die Bemühungen zur Lösung der deutschen Frage fortzusetzen. Zu diesem Zweck sollten Beratungen der Besatzungsbehörden in Berlin mit dem Ziel stattfinden, „die Folgen der bestehenden administrativen Teilung Deutschlands und Berlins … zu mildern“. Als Verhandlungsthemen waren die Ausdehnung des Handels, des Personen- und Güterverkehrs sowie die Normalisierung der Lage in Berlin vorgesehen. Den Besatzungsbehörden wurde empfohlen, bei den Beratungen deutsche Sachverständige und Organisationen hinzuzuziehen. Die Außenminister bestätigten die New-Yorker Vereinbarung vom 4. Mai 1949. Punkt 6 des Abschlußkommuniqué über Deutschland lautete: „Die Besatzungsbehörden empfehlen den leitenden deutschen Wirtschaftsorganen der östlichen Zone und der westlichen Zonen, zur Errichtung engerer Wirtschaftsbeziehungen zwischen den Zonen und zur wirksameren Durchführung von Handels- und anderen Wirtschaftsabkommen beizutragen.“ 150
Das Schlußkommuniqué brachte somit einerseits zum. Ausdruck, daß im Grundsätzlichen keine Fortschritte in Richtung auf eine Einigung für eine Viermächteregelung erzielt werden konnten. Andererseits spiegelte sich in ihm der Umstand wider, daß die Westmächte sich gezwungen sahen, dem Drängen der sowjetischen Delegation auf Fortsetzung der Verhandlungen zumindest verbal Rechnung zu tragen und einer Reihe von Empfehlungen zuzustimmen, die unterschiedlich interpretiert werden konnten. Während die Sowjetunion, die SED und der Deutsche Volksrat diese Empfehlungen als auf ihrer Linie des Kampfes um demokratische Einheit Deutschlands und um den Abschluß eines Friedensvertrages liegend interpretierten, ergab sich aus der Interpretation seitens der Westalliierten sowie der mit ihnen liierten Kreise in den Westzonen für diese keine Notwendigkeit, den Kurs auf den Westzonenstaat aufzugeben oder zeitweilig aufzuschieben.
In den Medien der Ostzone wurde zu recht hervorgehoben: „Aber die Konferenz fand statt … die Tagung wurde nicht gesprengt, sondern endete mit konkreten Abmachungen in bestimmten Fragen … Die Acheson, Bevin, Adenauer und Schumacher hatten bereits geglaubt, die Frage der deutschen Einheit ad acta legen zu können. Statt dessen kreisten die Debatten der Pariser Konferenz immer wieder um dieses Kernproblem …“ 151 Es kam jedoch hier und in anderen Stellungnahmen auch zu Übertreibungen und Fehleinschätzungen, so, wenn die Pariser Konferenz als Niederlage der kalten Krieger, der Westmächte und ihrer Spaltungspolitik bewertet und daraus überzogene Schlußfolgerungen hinsichtlich der entstandenen Lage, der gegebenen Möglichkeiten und der Erfolgsaussichten des Kampfes um die demokratische Einheit Deutschlands und den Friedensvertrag abgeleitet wurden.
Bezug nehmend auf die Empfehlungen der Pariser Außenministerkonferenz richtete am 4. Juli 1949 der Vorsitzende der DWK, Heinrich Rau, an den Vorsitzenden des Verwaltungsrates der Bizone, Hermann Pünder, ein Schreiben, in dem Verhandlungen über die „Schaffung eines gesamtdeutschen Wirtschaftsausschusses“ sowie die Bildung von Sonderkommissionen mit dem Ziel vorgeschlagen wurden, „Maßnahmen zur Entwicklung und Ausdehnung des Interzonenhandels“ zu ergreifen und weiter gehend „Richtlinien für eine gemeinsame Außenhandelspolitik …“ 152 auszuarbeiten. Auch diese Initiative blieb ohne Ergebnis.
Im Prozeß der unmittelbaren Konstituierung des Westzonenstaates war man noch weniger als zuvor geneigt, mit Repräsentanten der Ostzone zu reden, geschweige denn zu verhandeln. Nach Inkrafttreten des Grundgesetzes der BRD verkündeten die Ministerpräsidenten der westzonalen Länder am 15.Juni 1949 das Wahlgesetz für das Parlament des zu bildenden Staates, den Bundestag, und setzten den Wahltermin auf den 14. August 1949 fest.
Die Konstituierung der Bundesrepublik Deutschland
Im August und September 1949 gelangte die im Stile eines Verwaltungsaktes, ohne Mitwirkung des Volkes vollzogene Konstituierung des westzonalen Separatstaates mit den Wahlen zum Bundestag, der Wahl des Bundespräsidenten, Theodor Heuss (FDP), und des ersten Bundeskanzlers, Konrad Adenauer (CDU), sowie der Bildung einer bürgerlich-konservativen Regierung zu ihrem Abschluß. Hauptstadt wurde Bonn, wo sich am 7.September 1949 der Bundestag konstituierte.
Die Bonner Regierung setzte die bisherige Linie bi- bzw. trizonaler Politik fort, die antifaschistisch-demokratischen Veränderungen entgegengerichtet und auf die Zuendeführung und Konsolidierung der restaurativen Neuordnung der monopolkapitalistischen Gesellschafts- und Staatsordnung auf deutschem Boden sowie auf deren Integration in einen antisowjetischen Westblock und auf die Remilitarisierung ausgerichtet war.
Die Bildung des Westzonenstaates bedeutete Verrat an den nationalen Interessen des deutschen Volkes, Preisgabe des Gebots, die nationale Einheit zu wahren und um die Wiederherstellung der deutschen Nationalstaatlichkeit zu ringen. Es erwies sich als besonders verhängnisvoll, daß es dem deutschen Monopolkapital und den mit ihm verbundenen traditionellen deutschen „Eliten“ in den Westzonen gelang, ihrer Entmachtung zu entgehen und unter der Schirmherrschaft der westalliierten Militärregierungen ihre ökonomische und politisch-staatliche Macht wiederzuerrichten. Da sie unter den im internationalen Rahmen wie auf deutschem Boden gegebenen Kräfteverhältnissen bzw. politischen Konstellationen ihre restaurativen Pläne durch die Bildung eines deutschen Nationalstaates gefährdet sahen, opferten sie Nation und Nationalstaat ihren Klasseninteressen und nahmen Kurs auf die Bildung des Westzonenstaates in Gestalt der BRD. Dies war ihnen möglich, weil die Arbeiterbewegung in den Westzonen durch ihre Spaltung infolge der prononciert antikommunistischen Frontstellung sozialdemokratischer Führer nicht stark genug war, als Hauptkraft einer Politik antifaschistisch-demokratischer Umgestaltungen erfolgreich zu wirken, vor allem aber, weil ihr Vorgehen mit den sich verändernden Inhalten und Zielen westalliierter Deutschland- und Besatzungspolitik korrespondierte.
Konrad Adenauer nach der Wahl zum Bundeskanzler, September 1949
Die herrschenden Kreise der Westmächte verhinderten die Bildung eines zentralen deutschen Staates, nachdem sie hatten erkennen müssen, daß in diesem Staat die revolutionäre deutsche Arbeiterbewegung und die in der Ostzone entstandenen antifaschistisch-demokratischen Verhältnisse einen so wesentlichen Einfluß ausüben würden, daß er nicht einfach zum Instrument ihrer Politik gemacht werden konnte. Mit dem Übergang zum kalten Krieg schrieben sie die Bildung eines einheitlichen, demokratischen deutschen Friedensstaates und den Abschluß eines Friedensvertrages, der den Abzug aller Besatzungstruppen nach sich gezogen hätte, als Ziel ihrer Politik vollends ab. Oberste Ziele US-amerikanischer Deutschlandpolitik wurden die unbefristete Aufrechterhaltung der militärischen Präsenz der USA bzw. der Westmächte auf deutschem Boden, die Nutzung der Westzonen als vorgeschobenes antisowjetisches Bollwerk und gegebenenfalls Ausfalltor, die wirtschaftliche, politische und schließlich militärische Einbeziehung der Westzonen in den antisowjetischen Westblock. Für die herrschenden Kreise der Westmächte stand in Verfolgung ihrer Politik des kalten Krieges nur noch die Bildung eines Westzonenstaates unter ihrer Schirmherrschaft und mit antikommunistischer Bollwerksfunktion zur Debatte. Dies wiederum hatte zur Folge, daß sie sich vor allem mit jenen deutschen Kräften und Mächten verbündeten, gegen die sich die Potsdamer Beschlüsse über Entmilitarisierung, Entnazifizierung und grundlegende Demokratisierung richteten: mit den nazistisch belasteten Wehrwirtschaftsführern bzw. Bank- und Konzernherren sowie Großgrundbesitzern, mit der Ministerialbürokratie, den Richtern und Staatsanwälten des „Dritten Reiches“ und schließlich mit den ehemaligen Wehrmachtsgeneralen, insbesondere solchen mit „Rußlanderfahrung“. Diese Kräfte, zu deren politischem Hauptexponenten Konrad Adenauer avancierte, erstrebten bei Einordnung in die imperialistischen Westblockpläne einen Westzonenstaat, um ihre Macht zu restaurieren sowie Zug um Zug größere Eigenständigkeit und schließlich Gleichberechtigung im westlichen Bündnis zu erlangen.
Allein schon die Konstituierung des Westzonenstaates, mit seinem ihn dominierenden restaurativ-konservativen Grundzug, seinen Staatsdoktrinen und seinen Zielen, seiner Westintegration und seiner Remilitarisierungsperspektive bewirkte eine kaum noch zu beseitigende, weil allzu tiefgreifende Zerreißung Deutschlands. Ein deutscher Staat war wiedererstanden, in dem die Mächte und Kräfte erneut den Ton angaben, die für Faschismus und zweiten Weltkrieg Haupt- oder Mitverantwortung trugen, die das untergegangene Deutsche Reich in dieser oder jener Form wiedererstehen sehen wollten. Dies und die feste Integration dieses Staates in den imperialistischen Westblock grenzten ihn tiefer und dauerhafter von den antifaschistisch-demokratischen Verhältnissen im Osten Deutschlands ab, als eine bloße Staatsgrenze es vermocht hätte. Das war das Ergebnis einer nur vierjährigen Entwicklung.
Mit der Konstituierung der BRD war die restaurative Neuordnung weder abgeschlossen noch konsolidiert. Innen- wie außenpolitisch, national wie international war vieles noch im Fluß; eine Reihe Entscheidungen waren noch nicht gefallen, jähe Wendungen noch möglich und von den Gründern der BRD gefürchtet. Es gab starke Gegenkräfte gegen die Adenauer-Regierung und deren politischen Kurs. Doch nur die KPD trat für einen anderen Staat ein und kämpfte konsequent gegen die Restauration und die einseitige „Westintegration“, für die Einheit Deutschlands auf demokratischer Grundlage. Es war folgenschwer und zugleich symptomatisch, daß es gelungen war, die KPD in die Defensive zu drängen und zu isolieren. Im Ergebnis des seit 1948 forcierten antikommunistischen Kesseltreibens und der Begrenzung ihrer Wirkungsmöglichkeiten in Rundfunk und Presse erhielt sie nur 5,7 Prozent der Stimmen bei der Bundestagswahl, nur 15 der 402 Mandate. Die SPD errang ein knappes Drittel der Wählerstimmen und 131 Mandate. Zusammen mit den Einheitsgewerkschaften in Gestalt des DGB existierte somit dennoch ein auch politisch gewichtiges Potential, das bei der Entscheidung politischer und gesellschaftlicher Grundfragen in die Waagschale geworfen werden konnte.
Die SPD stand nicht nur in Opposition zur Regierung Adenauer, sondern sie erstrebte zusammen mit den Gewerkschaften ein anderes Wirtschaftssystem, das auf Gemeineigentum an den Grund- und Schlüsselindustrien und auf einer Wirtschaftsplanung basieren, die monopolkapitalistische Profitwirtschaft wenn nicht ablösen, so doch zurückdrängen und sozialen Ausgleich sowie soziale Gerechtigkeit stärker zur Geltung bringen sollte. In den Reihen von SPD und Gewerkschaften besaßen sozial fortschrittliche und dem Frieden verpflichtete Kräfte beträchtlichen Einfluß.
Andererseits standen die westzonale SPD-Führung und die Mehrheit der DGB-Führer in den Klassenkämpfen der Nachkriegszeit auf den Grundpositionen des Antikommunismus bzw. Antisowjetismus, der „Westorientierung“ und des bürgerlichen Parlamentarismus und hatten in der weltpolitischen Konfrontation der zwei Lager eindeutig für das westliche Lager Partei ergriffen. Sie trugen die imperialistische Politik des kalten Krieges mit, traten, wie Kurt Schumacher, sogar als eine Art Vorreiter dieser Politik auf, torpedierten die Chancen für eine gesamtdeutsche Verständigung und die Schaffung einer nationalen Repräsentation und wirkten aktiv an der Bildung des Westzonenstaates mit. Dabei gelang es ihnen zwar, die Arbeiten am Grundgesetz im Sinne der Fixierung des Friedensgebotes sowie sozialer und politischer Rechte, der Verfassungsmäßigkeit des Kampfes um Frieden, Demokratie und sozialen Fortschritt zu beeinflussen, nicht aber nachhaltigen Einfluß auf die reale Entwicklung des entstehenden Staates mit seinem restaurativ-konservativen Grundzug zu erlangen.
Die westdeutsche Arbeiterklasse lehnte in ihrer überwiegenden Mehrheit die Restauration der monopolkapitalistischen Gesellschafts- und Staatsordnung und das konservative Regierungsprogramm, nicht jedoch die Bildung der BRD ab. Sie erwartete von der Bundesrepublik die Verwirklichung von Frieden, Demokratie und sozialem Fortschritt auf deutschem Boden. Der Einfluß reformistischen und bürgerlich-demokratischen Gedankengutes, vor allem aber zunehmend der Totalitarismusdoktrin und der Weltsicht des kalten Krieges bewirkte, daß die friedensgefährdenden Symptome und restaurativen Aspekte der Konstituierung der BRD nicht gesehen oder unterbewertet, verdrängt oder toleriert wurden. Infolge der systematischen antikommunistischen Verteufelung der Entwicklung in der Ostzone, die ihre Wirkung nicht verfehlt hatte, wurde von breiten Kreisen der für die BRD – die den größeren Teil des deutschen Territoriums und der deutschen Bevölkerung einschloß – erhobene Anspruch akzeptiert oder hingenommen, der „deutsche Kernstaat“ zu sein. Die Teilung Deutschlands erschien ihnen als Ergebnis übergeordneter Konstellationen und Zwänge, gegen die anzugehen wenig Erfolg versprach, aber unerwünschte Gefährdungen mit sich bringen konnte. Nach der faschistischen Diktatur, dem zweiten Weltkrieg, den Hungerjahren, politischer Instabilität und Rechtlosigkeit erschienen relative Souveränität, Stabilität, wirtschaftliche Aufwärtsentwicklung, schrittweise Integration in die „westliche Gemeinschaft“, bürgerlich-demokratische Freiheiten und soziale Errungenschaften den meisten Werktätigen als Schritte auf einem Weg, den man bejahen oder doch tolerieren konnte, wenn dabei auch gesellschaftspolitische Grundsatzforderungen und anderes fürs erste auf der Strecke blieben. Dies galt nicht zuletzt für die Einheit der deutschen Nation.
Diese war seit 1945 durch Zonalisierung und Ost-West-Polarisierung ausgehöhlt worden. Eine politische Organisation im nationalen Rahmen gab es seit 1945 nicht mehr, das Nationalbewußtsein weiter Kreise des deutschen Volkes, insbesondere jener, die den 8.Mai einseitig als Niederlage ansahen, befand sich 1945 und danach in einer tiefen Krise; nationaler Nihilismus hatte sich ausgebreitet. Während mit den antifaschistisch-demokratischen Umwälzungen in der Ostzone Nationalbewußtsein, Nationalstolz und Nationalgefühl wiedererweckt und im Kampf um ein friedliches, demokratisches Deutschland bewußt entwickelt wurden, war in den Westzonen das Gegenteil der Fall. Die Politik der Separatstaatsbildung war mit einer Preisgabe des Nationalstaatsgedankens, einer Abwertung der Nation und mit der Propagierung von antisowjetisch ausgerichteten „Abendland-“ und „Europaideen“, des Kosmopolitismus und der „atlantischen Gemeinschaft“ verbunden.
Satirische Zeichnung von Elisabeth Shaw aus „Ulenspiegel“ 2. Februarheft 1949
Unter diesen Umständen wirkten in den Westzonen, als die BRD geschaffen wurde, weder die Idee der Einheit der Nation noch ein Nationalbewußtsein als die integrativen Kräfte, die die Spaltung Deutschlands hätten verhindern oder blockieren können. Soweit nationales Gewissen drückte oder Zweifel nagten, beruhigte man sich mit Lippenbekenntnissen zu einer nebulösen „Wiedervereinigung“.
Die Tatsache, daß die BRD – trotz des restaurativen und konservativen Grundzugs ihres Systems – von der überwiegenden Mehrheit der westzonalen Bevölkerung akzeptiert, toleriert oder hingenommen wurde, hing nicht nur mit Illusionen, unterschiedlichen Beurteilungen und Erwartungen zusammen. Sie war vielmehr in starkem Maße auch auf das historisch Neue zurückzuführen, das mit der BRD ins Leben trat. „Bonn“ war in vielerlei Beziehung nicht „Weimar“. Die BRD befand sich mit den westlichen Siegermächten des zweiten Weltkrieges und ihren westlichen Nachbarn in einem weltpolitischen Lager, und ein Prozeß der „Westintegration“ schritt voran. Das weckte Hoffnungen und Erwartungen neuer Art. Der Weg vom Faschismus zur bürgerlichen Demokratie war – bei allen grundlegenden Defiziten – gegangen worden. Er war verbunden mit der Abwendung vom „preußisch-deutschen Sonderweg“ und mit der Hinwendung zu einer auch gesellschaftspolitischen „Westorientierung“. Der restaurierte staatsmonopolistische Kapitalismus wies andere Strukturen auf und bevorzugte andere Herrschaftsformen als vor 1945; er präsentierte sich in neuen Leitbildern, wie dem von der „sozialen Marktwirtschaft“. Der Übergang zu flexiblen Herrschaftsmethoden begünstigte politische und soziale Kompromisse. Eine erneute Parteienzersplitterung war – mit Hilfe der westalliierten Besatzungsmächte – verhindert worden, und es gab keine mit der Ablehnung der Weimarer Republik durch Adelskaste, führende Militärs, Justiz und breite Kreise des Bürgertums vergleichbare Ablehnung der BRD.
Doch gegenüber all diesen Aspekten blieb gravierend, daß der historische Platz der BRD bei ihrer Gründung vor allem davon bestimmt wurde, daß sie als Produkt der Eskalation des kalten Krieges von seiten des Imperialismus, als integrierender Bestandteil seiner antisowjetischen Politik der Stärke sowie als Instrument der Restauration der wirtschaftlichen, politischen, ideologischen und in der Perspektive militärischen Macht des deutschen Monopolkapitals entstand. Der Faschismus war als Herrschaftssystem und herrschende Ideologie auf dem Wege zur Bundesrepublik beseitigt, aber nicht bewältigt worden. Dem Antifaschismus wurde in der Bundesrepublik nur eine Außenseiter- und zugleich Vorzeigerolle zugebilligt. Die Abrechnung mit dem Faschismus war auf der Strecke geblieben; die „Ehemaligen“ beherrschten Wirtschaft und Staat. Im Traditionsverständnis der bundesrepublikanischen „Eliten“ dominierte Kontinuität, war der Faschismus ein Betriebsunfall, wurde der 8.Mai 1945 als Niederlage empfunden. Aus all dem ergab sich folgerichtig eine antikommunistische, fortschrittsfeindliche Politik nach innen und auch eine friedensgefährdende, gegen die im Gefolge des zweiten Weltkrieges entstandenen Grenzen bzw. Nachkriegsrealitäten gerichtete Politik nach außen, nach Osten.
Die Regierung der UdSSR protestierte am 1. Oktober 1949 in drei gleichlautenden Noten an die Regierungen der USA, Großbritanniens und Frankreichs gegen die Bildung des Westzonenstaates und seiner Separatregierung und legte dar, daß damit die von den Westmächten seit 1946 betriebene Politik der Spaltung Deutschlands vollendet worden sei. Zugleich wurde seitens der Sowjetunion festgestellt:
„Die Sowjetregierung erachtet es für notwendig, auf die außerordentlich ernste Verantwortung aufmerksam zu machen, die die USA-Regierung deswegen trifft, weil die Vereinigten Staaten von Amerika gemeinsam mit Großbritannien und Frankreich eine Deutschlandpolitik betreiben, die zur Bildung der volksfeindlichen Separatregierung in Bonn geführt hat, einer Regierung, die den Beschlüssen der Potsdamer Konferenz über die Demokratisierung und Entmilitarisierung Deutschlands sowie den Deutschland auferlegten Verpflichtungen gegenüber feindlich eingestellt ist, was mit den Interessen des friedliebenden Europas unvereinbar ist.
Zugleich erachtet es die Sowjetregierung für notwendig, folgendes zu erklären: insofern als in Bonn die erwähnte Separatregierung gebildet wurde, ist jetzt in Deutschland eine neue Lage entstanden.“ 153
Die SED und die Nationale Front des demokratischen Deutschland
Die SED und die mit ihr im Demokratischen Block, im Deutschen Volksrat, in der DWK und den anderen Staatsorganen und Vertretungskörperschaften zusammenarbeitenden Parteien, Organisationen und Persönlichkeiten zogen aus der Vollendung der Spaltung Deutschlands nicht den Schluß, ihren Kampf um die demokratische Einheit Deutschlands und die Friedenssicherung auf deutschem Boden einzustellen, sondern konzentrierten ihre Kräfte im Ringen um die Überwindung des nationalen Notstands und um die Behebung des durch die imperialistischen Militärblock- und Kriegspläne hervorgerufenen Friedensnotstandes.
Wilhelm Pieck, Otto Grotewohl, Walter Ulbricht und die anderen Mitglieder des Parteivorstandes der SED waren von tiefer Sorge um das Schicksal der deutschen Nation bewegt und von dem Wunsche beseelt, das deutsche Volk und seine Nachbarvölker vor der Katastrophe eines neuen Krieges auf deutschem Boden zu bewahren. Sie waren bereit, alles zu tun und keine Kräfte zu schonen, um die schwer erkämpften Errungenschaften der antifaschistisch-demokratischen Umgestaltungen fest zu sichern und das unter größten Mühen vollbrachte Aufbauwerk fortzusetzen. Im Bewußtsein seiner Verantwortung vor dem deutschen Volk und dem verpflichtenden Friedensgebot entsprechend, faßte der Parteivorstand der SED am 22. Juli 1949 den Beschluß über die „Schaffung der Nationalen Front des demokratischen Deutschland“.
Das Politbüro des ZK der SED setzte zur Erarbeitung eines Dokuments, in dem das Verhältnis der SED zu dieser Volksbewegung dargelegt werden sollte, eine Kommission ein, die aus 33 Mitgliedern bestand. In seiner Entschließung vom 24. August 1949 über „Die nächsten Aufgaben der Partei“ hob der Parteivorstand als Zielstellung der zu schaffenden breiten Front aller nationalbewußten Deutschen hervor: „Der Kampf um die nationale Unabhängigkeit Deutschlands, für einen Friedensvertrag und Zurückziehung der Besatzungstruppen ist ein Bestandteil der Erhaltung des Friedens in Europa, denn eine langandauernde Besetzung Deutschlands bedeutet eine ständige Kriegsdrohung von seiten der imperialistischen Staaten. Deshalb ist der nationale Kampf des deutschen Volkes um Einheit und gerechten Frieden verbunden mit den Interessen aller friedliebenden Völker.“ 154 Als erste grundlegende Konsequenz dieser Politik für die Entwicklung in der Ostzone wurde herausgearbeitet: „Für die gesamtdeutsche Entwicklung ist die Festigung der demokratischen Ordnung in der Ostzone von großer Bedeutung. Der Hauptinhalt der demokratischen Aufgabe in der Ostzone besteht in der gegenwärtigen Periode in der Konsolidierung der bisherigen fortschrittlichen Errungenschaften. Die weitere Entwicklung muß sich vollziehen durch innerwirtschaftliche Stärkung des volkseigenen Sektors, jedoch nicht auf dem Wege von Enteignungen oder verwaltungsmäßigen Zwangsmaßnahmen.“ 155
In dem von der Kommission des Parteivorstandes ausgearbeiteten Dokument „Die Nationale Front des demokratischen Deutschland und die Sozialistische Einheitspartei Deutschlands“ wurde diese Schlußfolgerung weitergeführt und gefordert: „Das gesamte Öffentliche, wirtschaftliche und politische Leben der Ostzone muß ein überzeugendes Beispiel für die Möglichkeit der breiten Vereinigung aller deutschen Patrioten im Kampf um ein einheitliches Deutschland sein“.156
Das programmatische Dokument der SED zur Arbeit der Nationalen Front
Die SED betrachtete die Ostzone als „Basis der nationalen Befreiungsbewegung in Deutschland“ 157 und erklärte sich im Rahmen der nationalen Front zur „Zusammenarbeit mit allen deutschen Patrioten bereit, darunter auch mit früheren Mitgliedern der Nazipartei, ehemaligen Offizieren, kleineren und mittleren Unternehmern und dem Teil der Großbourgeoisie in Westdeutschland, dem die Interessen Deutschlands am Herzen liegen und der bereit ist, die Bestrebungen des deutschen Volkes zur Wiederherstellung seiner Einheit und Unabhängigkeit zu unterstützen“.158 Die SED stellte die Aufgabe, eine „allgemeine politische Plattform der Nationalen Front des demokratischen Deutschland“ zu entwickeln, „auf deren Grundlage sich alle patriotischen Kräfte für den gemeinsamen Kampf verständigen können“ 159, und unterbreitete hierfür 23 Vorschläge bzw. Forderungen.
Die Weiterentwicklung der Volkskongreßbewegung zur Nationalen Front bzw. die Erarbeitung einer erweiterten politischen Plattform für den nationalen Kampf waren mit einem tiefgreifenden Klärungs-, Lern- und Auseinandersetzungsprozeß in der SED und in den anderen Parteien und Organisationen verbunden. Unter den Mitgliedern der SED gab es zunächst nicht wenige, die aus ihren früheren Erfahrungen mit nationalistischen Umtrieben der herrschenden Klassen heraus einer national motivierten Politik mißtrauisch bzw. verständnislos gegenüberstanden und die politische Bedeutung der nationalen Frage bzw. deren sozialen Inhalt nur ungenügend zu erkennen versuchten. Es gab Auffassungen wie solche, anstelle einer nationalen Front eine internationale Front zu errichten oder daß ein direkter Übergang zum Sozialismus eine nationale Front unnötig machen würde. Großes Widerstreben gab es gegenüber der angestrebten Breite des nationalen Bündnisses. „Wie können wir eine Front mit Unternehmern und ehemaligen Nazis bilden? “ 160 wurde besorgt oder direkt ablehnend gefragt. „Wie kann ich mit dem Unternehmer, meinem Ausbeuter, zusammengehen?“ 161
Von besonderer Brisanz und Tragweite war die Frage nach der politischen Aktivierung und gleichberechtigten Einbeziehung ehemaliger Nazis und Offiziere in die Nationale Front, vor allem aber in die Politik der Festigung und des Ausbaus der antifaschistisch-demokratischen Verhältnisse. Es war politisch nicht vertretbar, aufbauwillige, zum Teil sogar dem sozialen Fortschritt aufgeschlossen gegenüberstehende Kräfte, die mit ihrer Vergangenheit abgerechnet und das auch in ihrem Verhalten bewiesen hatten, weiterhin von verantwortlicher Mitarbeit entsprechend ihren Fähigkeiten auszuschließen. Außerdem entsprach es nicht der marxistisch-leninistischen Weltanschauung, ganze Bevölkerungsgruppen für immer mit einem Stigma zu versehen und damit faktisch zu diskriminieren. Andererseits war zu berücksichtigen, daß es den vom Faschismus Verfolgten und nicht nur ihnen, persönlich nicht leicht fiel, mit ehemaligen Offizieren und Nazis nun Schulter an Schulter zu wirken – eventuell sogar unter deren Leitung.
In Mecklenburg erhielt Hans Warnke vom Landesvorstand der SED den Auftrag, in seiner Eigenschaft als mecklenburgischer Innenminister öffentlich zu erklären, „daß ehemalige Mitglieder der NSDAP, darunter auch solche, die aus leitenden Stellungen entfernt wurden und sich heute vorbehaltlos und aktiv am wirtschaftlichen Aufbau betätigen und in die nationale Front eingereiht haben, entsprechend ihrem Können, ihren Fähigkeiten und ihren Leistungen eingesetzt werden“.162
Angesichts des nationalen und Friedensnotstandes mußte in dieser Frage ein Umbruch erzielt werden. Die antifaschistische Integrität und Autorität des Parteivorstandes der SED ermöglichte das. In Rundfunk und Presse wurde der Standpunkt der SED in dieser Frage offensiv dargelegt, wurden die spezifischen Aspekte der Eingliederung ehemaliger Nazis in die antifaschistisch-demokratischen Verhältnisse im Osten Deutschlands deutlich gemacht.
Auch in den Reihen der mit der SED zusammenarbeitenden Parteien, vor allem der CDU und der LDPD, gab es viele Unklarheiten, Vorbehalte oder Ablehnungen gegenüber der Politik der Nationalen Front. Sie hingen mit Befürchtungen zusammen, daß die Nationale Front das Ende des Blocks bedeuten und damit die Perspektive der Blockparteien gefährden könne. Es bedurfte großer Anstrengungen der Repräsentanten der SED, um im Präsidium des Deutschen Volksrates und im zentralen Blockausschuß der Auffassung zur Annahme zu verhelfen, daß die Gründung eines eigenen Staates mit der Verstärkung des nationalen Kampfes, der Schaffung und Entwicklung der Nationalen Front des demokratischen Deutschland verbunden werden müsse.
In ihrer Politik der Nationalen Front wandte die SED die Erfahrungen der Volksdemokratien, in denen breite nationale Fronten bereits in der Anfangsphase der revolutionären Umwälzung entstanden waren, schöpferisch auf die konkreten Bedingungen an. Dabei trat zunächst die Aufgabe in den Vordergrund, den nationalen Verrat der für die Schaffung der BRD verantwortlichen Mächte und Kräfte zu verdeutlichen, die Unrechtmäßigkeit dieses Staates nachzuweisen, seine Entmündigung durch das Besatzungsstatut und seine Abhängigkeit von den Westmächten anzuprangern sowie seinen Charakter als reaktionär zu entlarven.
Infolge der Schärfe der Auseinandersetzungen und ihrer historischen Tragweite kam es dabei auch zu Überspitzungen und Fehleinschätzungen. In den Vorschlägen der SED für die Plattform der Nationalen Front stand die Forderung an erster Stelle: „1. Wiederherstellung der politischen und wirtschaftlichen Einheit Deutschlands. Beseitigung des Besatzungsstatuts, Liquidierung des separaten westdeutschen Trizonenstaates, Bildung einer gesamtdeutschen Regierung, Wiederherstellung der einheitlichen und unteilbaren deutschen demokratischen Republik. 2. Schnellster Abschluß eines gerechten Friedensvertrages mit Deutschland. Abzug aller Besatzungstruppen …“ 163
Da die Westmächte und die mit ihnen zusammenwirkenden politischen Kräfte der BRD jede Verständigungsregelung in der deutschen Frage ablehnten, kalter Krieg und Alleinvertretungsanmaßung Kontakte und Verhandlungen über eine Vereinigung unmöglich machten, konnte der Kampf zur Überwindung des nationalen Notstandes nur „von unten“, durch die Entfaltung einer breiten Volksbewegung – mit der Ostzone als Ausgangsbastion –, geführt werden. Eine Alternative hierzu gab es nicht. Selbst wenn fraglich war, ob die integrative Kraft der deutschen Nation und des deutschen Nationalbewußtseins in den Westzonen entscheidend zur Wirkung gebracht werden konnten, war die Entfaltung des nationalen Kampfes um Einheit und Frieden unabdingbar und von großer politischer Bedeutung. Auch wenn dieser Kampf nicht zum vollen Erfolg gelangen sollte, war er nicht umsonst, denn er konnte es den imperialistischen Mächten und der Monopolbourgeoisie der BRD auf jeden Fall beträchtlich erschweren, ihre Pläne zur Revision der Ergebnisse des zweiten Weltkrieges zu verwirklichen, er konnte sie zum Taktieren und zu verstärkten Manövern zwingen und damit dazu beitragen, weitere gravierende Entscheidungen gegen die nationalen Interessen des deutschen Volkes hinauszuzögern.
Die Errichtung der Deutschen Demokratischen Republik
Inhaltsverzeichnis
- 1 Die Errichtung der Deutschen Demokratischen Republik
- 1.1 Gute Zweijahrplan-Zwischenbilanz. Neue Grundsätze des Demokratischen Blocks
- 1.2 Die Protestbewegung gegen Spalter und Kriegstreiber und die Vorbereitungen zur Gründung der Deutschen Demokratischen Republik
- 1.3 Die Konstituierung der Provisorischen Volkskammer und die Inkraftsetzung der Verfassung der Deutschen Demokratischen Republik
Gute Zweijahrplan-Zwischenbilanz. Neue Grundsätze des Demokratischen Blocks
Den außerordentlichen Anstrengungen der Arbeiter, Ingenieure und Wissenschaftler, allen voran der Aktivisten, war es zu danken, daß die im Volkswirtschaftsplan für 1949 festgelegten industriellen Aufgaben erfüllt wurden. Zum 31. August 1949 war in der Industrie das Produktionssoll anteilmäßig übererfüllt worden. Bis zu diesem Stichtag waren in der Industrie 67 Prozent des Gesamtplanes zu realisieren. Welcher Stand in den einzelnen Industriezweigen tatsächlich erreicht werden konnte, geht aus der folgenden Übersicht hervor164:

Die Überbietung der Planziele bei der Erzeugung von Roheisen, Rohstahl, Steinkohle, Braunkohlenbriketts, Schwefelsäure, Düngemitteln und Zellwolle ermöglichte eine Produktionssteigerung in allen Industrien und auch die Erweiterung des Außenhandelsvolumens. Der Import von Lebensmitteln konnte erhöht, die Belieferung der Bevölkerung mit Textilien verbessert und parallel zum Neubauernbauprogramm auch in den Städten mit dem Neuaufbau von Häusern begonnen werden. Das für die Beziehungen zwischen volkseigenen und privaten Betrieben entwickelte Vertragssystem begann wirksam zu werden. Schwächen und Mängel bei der Senkung der Selbstkosten in den volkseigenen Betrieben, die hinter dem Plan zurückblieb, sowie Rückstände bei der Erhöhung der Qualität der Produktion, beim Übergang zum Leistungslohn und bei der Erhöhung der Arbeitsproduktivität kritisierend, konnte der Parteivorstand der SED auf seiner 21. (35.) Tagung am 23. und 24. August 1949 – ausgehend von den dominierenden Tendenzen – feststellen: „Die Zeit der Erfolge hat begonnen.“ 165
Der Parteivorstand betonte erneut die Notwendigkeit einer breiten Bündnispolitik und bekräftigte die Fortsetzung der Blockpolitik auf dem Wege der „Konsolidierung der bisherigen fortschrittlichen Errungenschaften“ 166 als der Hauptaufgabe dieser Periode. Er hob die Bedeutung der DWK-Verordnung vom 31. März 1949 und der Förderungsmaßnahmen für die Intelligenz sowie der Nationalpreise hervor und kritisierte Erscheinungen sektiererischen und bürokratischen Verhaltens gegenüber der Intelligenz.
Hinsichtlich der Stärkung der Kampfkraft und der Weiterentwicklung der SED kam es darauf an, „die Arbeit der Partei so zu verbessern, daß sie imstande ist, die führende Rolle der Arbeiterklasse in Staat, Wirtschaft und im kulturellen Leben zu verwirklichen“.167 Dies war zugleich die entscheidende Voraussetzung und Bedingung dafür, die Deutsche Demokratische Republik als Arbeiter-und-Bauern-Staat zu gründen.
Bei der Verwirklichung der Beschlüsse der 1. Parteikonferenz und der staatspolitischen Konferenzen der SED hinsichtlich des klassenmäßigen Ausbaues, der Vereinheitlichung, Qualifizierung und Demokratisierung des Verwaltungsapparates waren beträchtliche Erfolge erreicht worden. Auch in solchen Bereichen wie dem Finanz- und Steuerwesen und der Justiz, wo sich die Durchsetzung der führenden Rolle der Arbeiterklasse – infolge einer besonderen Problemlage – als kompliziert erwiesen hatte, waren deutliche Fortschritte zu verzeichnen. Fast die Hälfte der 1285 Richter und Staatsanwälte waren im Herbst 1949 Absolventen der Volksrichterlehrgänge. Ihrer sozialen Herkunft nach kamen 43 Prozent der Richter und 53 Prozent der Staatsanwälte aus der Arbeiterklasse oder der werktätigen Bauernschaft. 54 Prozent der Richter und 87 Prozent der Staatsanwälte gehörten der SED an. 1949 konnte die Kriminalität bei schweren Verbrechen wie Mord und Raub sowie bei Eigentumsdelikten weiter zurückgedrängt werden; die Zahl der Zivilprozesse stieg jedoch weiter an.
Die Zentrale Kontrollkommission und die Landeskontrollkommissionen gelangten bei der Mehrzahl ihrer Kontrollen zu positiven Einschätzungen der Tätigkeit von Verwaltungsorganen und volkseigenen Betrieben. Dies schloß jedoch nicht aus, daß in einer Reihe von Fällen schwerwiegende Mängel und Verstöße in der Arbeit mit dem Plan, Verletzungen der demokratischen Gesetzlichkeit und der Dienstordnungen, Erscheinungen obrigkeitsstaatlichen Verhaltens, des Bürokratismus und andere Mißstände aufgedeckt wurden. So mußten bei einer Kontrolle der Landeskontrollkommission Brandenburg, die auf Grund von Beschwerden im Kreis Lebus durchgeführt wurde, auf Kreisebene und in zahlreichen Gemeinden schwerwiegende „undemokratische Erscheinungen“, wie Eigenmächtigkeiten und Gesetzesverletzungen durch Bürgermeister, festgestellt werden. Umsiedler waren bei der Bodenverteilung im Zuge der demokratischen Bodenreform unberücksichtigt geblieben oder benachteiligt worden. Ausgehend vom Bericht der Landeskontrollkommission faßte die Landesregierung Brandenburg am 4. Juli 1949 einen Kabinettsbeschluß zur Überwindung der ernsten „Mängel in der Arbeit der Kreisverwaltung des Kreises Lebus, in der Kontrolle, Lenkung und Leitung der Kreisverwaltung gegenüber den Gemeindeverwaltungen und in den Gemeindeverwaltungen selbst“.168 Der Landrat des Kreises Lebus wurde abgesetzt, das Justizministerium beauftragt, für eine schnelle Aburteilung aller Schuldigen zu sorgen, und der Vorsitzende der Landesbodenkommission angewiesen, durch eine neu zu wählende Gemeindebodenkommission der Gemeinde Demnitz unter Einschluß der Umsiedler die dortige ungerechte Bodenverteilung rückgängig zu machen. Die Regierung setzte eine Sonderkommission ein, die die Aufgabe hatte, bis Jahresende eine Überprüfung der Arbeit von Kreis- und Gemeindeverwaltungen durchzuführen. Gemäß dem Kabinettsbeschluß wurden am 9. Juli 1949 unter der Leitung von Innenminister Bernhard Bechler die Vorkommnisse in Lebus auf der Landestagung mit den Landräten und Oberbürgermeistern gründlich ausgewertet und eine Reihe von Maßnahmen festgelegt, um zu gewährleisten, daß künftig nicht mehr „diktatorische, selbstherrliche Bürgermeister“ 169 wichtige Maßnahmen ohne Gemeindevertretung und ohne Mitwirkung der Bevölkerung erledigten.
2. Kongreß der Gesellschaft zum Studium der Kultur der Sowjetunion, seitdem Gesellschaft für Deutsch-Sowjetische Freundschaft, 1. bis 4. Juli 1949, Vordere Reihe v. I. n. r.: Wilhelm Pieck (dahinter Konstantin Simonow und Sergej Tjulpanow), Wladimir Semjonow, Gerhart Eisler, Anna Seghers, Willi Bredel, Jürgen Kuczynski
Auch in bezug auf die Rolle der Gewerkschaften in der politischen Organisation der Ostzone konnten 1949 weitere Erfolge erzielt werden. Gemäß dem Aufruf des Bundesvorstandes des FDGB zum innerbetrieblichen Wettbewerb für das Jahr 1949 beteiligten sich an diesem Wettbewerb über 600000 Werktätige in rund 1700 Betrieben. Zur weiteren Entfaltung und zur Würdigung der Aktivistenbewegung erklärte der Bundesvorstand des FDGB den 13. Oktober, an dem 1948 Adolf Hennecke seine bahnbrechende Tat vollbrachte, zum Tag des Aktivisten. Am II. Weltgewerkschaftskongreß, der vom 29. Juni bis zum 9. Juli 1949 in Mailand stattfand, nahm eine Delegation des FDGB unter Leitung von Herbert Warnke teil.
Vom 1. bis 5.Juni 1949 fand in Leipzig das III. Parlament der FDJ statt. 1977 Delegierte vertraten 608243 FDJler. Anwesend waren außerdem Vertreter des WBDJ, von zwölf ausländischen Jugendorganisationen und aus den Westzonen. Der Vorsitzende der FDJ, Erich Honecker, konnte in seinem Rechenschaftsbericht von großer Einsatzbereitschaft und vielen Initiativen der FDJ bei Schwerpunktaufgaben und an den Brennpunkten des Zweijahresplans berichten. Bedeutende Ergebnisse waren bei der Verwirklichung der Grundrechte der jungen Generation erzielt worden. Mit großer Begeisterung wurde von den Delegierten der Vorschlag aufgenommen, eine Talsperre in Sosa als erstes Jugendobjekt zu errichten. Das Parlament mobilisierte die junge Generation zum Kampf für den Frieden und die demokratische Einheit Deutschlands. Es beschloß die Verfassung der FDJ und wählte einen Zentralrat. Erich Honecker wurde erneut zum Vorsitzenden gewählt.
Im August 1949 nahm eine Delegation der FDJ, der unter anderen 140 Jungaktivisten, 70 Sportler und 110 Angehörige von Kulturgruppen angehörten, an den II. Weltfestspielen der Jugend und Studenten in Budapest teil.
Als ein Ergebnis der in Parteiorganisationen der SED und der anderen Parteien, in den Massenorganisationen, in Betrieben sowie in der Öffentlichkeit in Wort und Schrift geführten beharrlichen Aufklärungsarbeit über die sozialistische Sowjetunion entstanden Voraussetzungen, um das Kampfbündnis zwischen SED und KPdSU zur Freundschaft zwischen dem deutschen und dem Sowjetvolk auszubauen. Einen besonderen Beitrag zu den bedeutungsvollen Prozessen des Umdenkens, die sich in breiten Kreisen der Bevölkerung vollzogen, leistete die Gesellschaft zum Studium der Kultur der Sowjetunion. Ihre Umbenennung in Gesellschaft für deutsch-sowjetische Freundschaft, die auf dem 2. Kongreß der Gesellschaft im Juli 1949 beschlossen wurde, fand zu einem Zeitpunkt statt, an dem auch ihre Entwicklung zur Massenorganisation einsetzte. Allein vom August bis Oktober 1949 traten 240000 neue Mitglieder bei.
Bei dem Bemühen der SED und der progressiven Kräfte in den mit ihr zusammenarbeitenden Parteien um die Festigung der Blockpolitik erlangte die Erarbeitung neuer Grundsätze, auf die sich die Blockparteien im Februar 1949 geeinigt hatten, Bedeutung. Der vom zentralen Blockausschuß dazu eingesetzte Unterausschuß unter Vorsitz von Otto Grotewohl erarbeitete die neuen Richtlinien gemäß den in der Blockerklärung vom 22. Februar 1949 gegebenen Orientierungspunkten. An seiner Arbeit waren Georg Dertinger und Karl Grobbel von der CDU, Karl Hamann und Reinhold Schwarz von der LDPD, Ernst Goldenbaum und Paul Scholz von der DBD, Lothar Bolz und Heinrich Homann von der NDPD sowie Herbert Warnke als Vertreter des FDGB beteiligt. Von seiten der SED nahmen noch Paul Merker und Käthe Kern an den Beratungen teil. Für das Herangehen wurde auf der von Otto Grotewohl vorgeschlagenen Grundlage Einigkeit erzielt, daß man „auf den Potsdamer Beschlüssen fußen und von da aus zu den Warschauer Beschlüssen überleiten muß“.170 Es galt, die Aufgaben für ganz Deutschland und die für die Ostzone organisch miteinander zu verbinden und dabei die Pionierfunktion der in der Ostzone vollzogenen antifaschistisch-demokratischen Umgestaltungen sowie die speziellen Aufgaben beim Ausbau und bei der Festigung der antifaschistisch-demokratischen Verhältnisse und der Durchführung der Wirtschaftsplanung besonders herauszuarbeiten.
Die Verhandlungen verliefen im Geist der Verständigungsbereitschaft und relativer Einmütigkeit. Das war vor allem deshalb möglich, weil sie sich in dem von der Verfassung der Deutschen Demokratischen Republik und der Orientierung der SED auf Festigung der antifaschistisch-demokratischen Verhältnisse abgesteckten Rahmen bewegten. Kontroverse Diskussionen gab es vor allem darüber, ob die grundsätzliche Anerkennung der Oder-Neiße-Grenze mit einschränkenden Hinweisen auf die noch ausstehende Friedenskonferenz zu formulieren sei oder nicht. Die SED konnte hier ihrem konsequenten Standpunkt in Übereinstimmung mit der Erklärung der Warschauer Konferenz zur Anerkennung verhelfen.
Zur Fertigstellung der neuen Blockgrundsätze trugen auch die Auseinandersetzungen und klärenden Diskussionen bei, die auf Initiative der SED im zentralen Blockausschuß im Juni 1949 über die Ergebnisse der Wahlen zum 3. Deutschen Volkskongreß geführt wurden. Otto Grotewohl, Wilhelm Pieck und Wilhelm Koenen traten dabei solchen Auffassungen entgegen, wie sie von Karl Hamann (LDPD) und Hugo Hickmann (CDU) geäußert wurden, die die Nein-Stimmen bagatellisierten. Die Repräsentanten der SED betonten demgegenüber, daß die Ursachen auch in einem offenen Verstoß gegen die Politik der Zusammenarbeit gesehen werden mußten, an dem – wie sie nachwiesen – reaktionäre Kräfte in CDU und LDPD beteiligt waren. Die Vertreter der beiden Parteien wurden aufgefordert, Konsequenzen aus dieser Tatsache zu ziehen. Am 17. Juni 1949 verabschiedete der zentrale Blockausschuß eine Entschließung, die die Beschlüsse des 3. Deutschen Volkskongresses begrüßte und die Parteien verpflichtete, die gemeinsam beschlossene Politik gegen alle feindlichen Elemente zu schützen und diesen gegenüber auch organisatorische Konsequenzen zu ziehen.
Die am 19. August 1949 verabschiedeten „Grundsätze des Demokratischen Blocks“, wie der Block sich nunmehr nannte, enthielten ein Bekenntnis zur Schaffung der demokratischen Einheit Deutschlands auf der Grundlage des Potsdamer Abkommens und gemäß den Beschlüssen der Warschauer Außenministerkonferenz vom Juni 1948. Der Demokratische Block rief angesichts der Politik der Zerreißung Deutschlands durch den Imperialismus zur nationalen Selbsthilfe auf und anerkannte die Volkskongreßbewegung und den Deutschen Volksrat als leitende und organisierende Kraft im Kampf um die demokratische Einheit Deutschlands und den Abschluß eines Friedensvertrages. Er verpflichtete sich, im Geiste der vom 3. Deutschen Volkskongreß bestätigten Verfassung zu arbeiten, und orientierte darauf, „den Kampf für die Stärkung der antifaschistisch-demokratischen Ordnung in der Zone und für die Festigung der demokratischen Reformen zu führen“.171 Die Parteien und Organisationen des Demokratischen Blocks stellten sich die Aufgabe, für die Erfüllung des Volkswirtschaftsplans, die Entfaltung der breitesten Masseninitiative und für eine Erhöhung der Wachsamkeit gegenüber allen antidemokratischen und friedensfeindlichen Umtrieben zu wirken.
Der Demokratische Block bekannte sich zur Freundschaft mit der Sowjetunion, mit den Ländern der Volksdemokratie und mit allen anderen friedliebenden Völkern, zum Ausbau der Wirtschaftsbeziehungen mit der Sowjetunion und den volksdemokratischen Staaten und zur Oder-Neiße-Grenze. In den organisatorischen Grundsätzen wurde die gleichberechtigte Aufnahme von DBD, NDPD und FDGB festgelegt. Alle fünf Parteien und der FDGB verpflichteten sich zu einer gemeinsamen Politik unter Zurückweisung aller Spaltungsbestrebungen und garantierten eine einheitliche Zusammenarbeit auf allen Ebenen, vom zentralen Blockausschuß bis zu den Blockausschüssen auf lokaler Ebene. Am Prinzip der Gleichberechtigung aller fünf Parteien und des FDGB und der notwendigen Einstimmigkeit für verbindliche Beschlüsse wurde festgehalten.
Die neuen Blockgrundsätze reflektierten sehr stark die Erfordernisse des nationalen und Friedenskampfes und fixierten eine politische Plattform, die dem erreichten Entwicklungsstand und der Verständigungsmöglichkeit zwischen den Blockparteien entsprach.
Die neuen Grundsätze der Blockpolitik festigten den Demokratischen Block auf allen Ebenen und begründeten die Perspektive der weiteren Zusammenarbeit, der Fortführung des breiten sozialen und politischen Bündnisses bei der Schaffung und Entwicklung des deutschen demokratischen Friedensstaates – obwohl diese Frage in den Diskussionen um die Blockgrundsätze noch keine Rolle gespielt hatte.
Die Einstimmigkeit hinsichtlich der Blockgrundsätze bedeutete keine Einmütigkeit in allen anstehenden Fragen. Zwischen der SED und den anderen Blockparteien bestanden zum Teil tiefgreifende Meinungsverschiedenheiten fort, vor allem hinsichtlich der Weiterführung des revolutionären Prozesses und des Charakters der zukünftigen Staats- und Gesellschaftsordnung. Weder der politische Führungsanspruch der SED im Namen der Arbeiterklasse noch die sozialistische Perspektive waren unbestritten. Doch brachen sich im Zuge der Zusammenarbeit auf neuer Grundlage in den Blockparteien – vor allem in der CDU und der LDPD, aber auch in der NDPD und der DBD – tiefgreifende politische Wandlungs- und ideologische Klärungsprozesse Bahn. Deren Verlauf war nicht zuletzt auch davon gekennzeichnet, daß immer mehr Funktionäre und Mitglieder dieser Parteien erkannten, daß es gegenüber der monopolkapitalistischen BRD nicht beliebig viele, sondern letztlich nur die Alternative in Richtung Volksstaat und gesellschaftlicher Fortschritt gab, und deshalb ihren Willen bekräftigten, weiterhin an der Seite der Arbeiterklasse zu wirken und die enge Zusammenarbeit mit der SED fortzusetzen.
Die SED bemühte sich im Rahmen ihrer nationalen und Bündnispolitik beharrlich darum, auch eine gute Zusammenarbeit mit den Kirchen zu entwickeln, diese für die Mitarbeit beim Neuaufbau, in der Volkskongreßbewegung und für die Friedensbewegung zu gewinnen. Maßgebende Kirchenführer nahmen jedoch 1948/49 eine zunehmend militante antikommunistische Haltung ein, orientierten sich auf die Westmächte und den Westzonenstaat und untergruben damit die guten Anfänge der Zusammenarbeit nach der Befreiung vom Faschismus. Bischof Otto Dibelius stachelte Christen zum Widerstand gegen die Volksmacht auf. In der Volkskongreßbewegung und der Nationalen Front mitarbeitende Theologen und Pfarrer wurden diffamiert und disziplinarisch verfolgt. Die Kirchenleitungen wiesen den Wunsch des Deutschen Volksrates zurück, die Friedenskundgebungen zum 1. September 1949 durch Glockengeläut zu unterstützen. Dennoch gelang es reaktionären Kirchenkreisen nicht, in den christlich gesinnten Bevölkerungskreisen eine Massenbasis gegen die Nationale Front und gegen den entstehenden Arbeiter-und-Bauern-Staat zu schaffen. Die umsichtige Bündnis- und Kirchenpolitik der SED trug wesentlich dazu bei, daß solche Bestrebungen durchkreuzt wurden.
Die Protestbewegung gegen Spalter und Kriegstreiber und die Vorbereitungen zur Gründung der Deutschen Demokratischen Republik
Der Deutsche Volksrat rief auf seiner 8. Tagung im Juli 1949 das deutsche Volk auf, anläßlich des 10. Jahrestages der Entfesselung des zweiten Weltkrieges durch das faschistische Deutschland in machtvollen Kundgebungen am 1. September 1949 seinen Friedenswillen zu demonstrieren und seinen Protest gegen erneute Kriegspläne und Friedensgefährdungen zum Ausdruck zu bringen. Während in den Westzonen entsprechende Initiativen im Kesseltreiben des kalten Krieges und in der hektischen Betriebsamkeit, den Westzonenstaat zurechtzuzimmern, erstickt wurden, folgten dem Aufruf in der Ostzone rund 6 Millionen Menschen. Mit beeindruckenden Kundgebungen demonstrierten sie ihre Entschlossenheit, gegen die imperialistische Aggressionspolitik, für Frieden und Völkerfreundschaft, für die Freundschaft insbesondere zur Sowjetunion einzutreten. Hierin widerspiegelte sich, daß es der SED gelungen war, weitere, bisher nicht erfaßte Kreise der Bevölkerung für ihre Politik einer breiten nationalen Front zu gewinnen.
Protestkundgebung gegen die Spaltung Deutschlands in Berlin, 1. September 1949
Die Bildung des westzonalen Separatstaates stieß bei der Mehrheit der Bevölkerung der Ostzone auf heftige Ablehnung. Nachdem die politischen Parteien der Ostzone – um auch nicht die geringsten eventuell noch bestehenden Möglichkeiten zu verbauen – die in Antwort darauf notwendigen Entscheidungen und Maßnahmen hinausgezögert hatten, mußte nun entschlossen und zügig gehandelt werden. Nach der Wahl Konrad Adenauers zum Bundeskanzler skizzierte am 15. September 1949 der Vorsitzende der SED, Wilhelm Pieck, in einem Arbeitspapier die „Kurzfristige Prozedur für die Regierungsbildung“.172 Darin war vorgesehen, nach sofort beginnender intensiver politischpropagandistischer Vorbereitung und öffentlicher Diskussion Anfang Oktober 1949 eine Parteivorstandssitzung einzuberufen, die den Plan zur Bildung einer provisorischen Regierung beschließen und dem Politbüro die Vollmacht erteilen sollte, mit den anderen Parteien Verhandlungen über die Zusammensetzung der Regierung zu führen. Als nächste Schritte sah das Papier eine Besprechung mit den Vorsitzenden der anderen Parteien und eine gemeinsame Sitzung des Demokratischen Blocks und des Präsidiums des Deutschen Volksrates und schließlich die 9. Volksratstagung vor, auf der sich der Volksrat zur Provisorischen Volkskammer erklären und diese der Verfassung der Deutschen Demokratischen Republik Rechtskraft verleihen sollte.
Vom 16. bis 28. September 1949 berieten Wilhelm Pieck, Otto Grotewohl, Walter Ulbricht und Fred Oelßner in Moskau mit Mitgliedern des Politbüros der KPdSU(B) die im Zusammenhang mit der Gründung der Deutschen Demokratischen Republik notwendigen Maßnahmen und deren Konsequenzen.
Die SED verurteilte in öffentlichen Erklärungen aufs schärfste die Bildung der BRD. Sie wies darauf hin, daß hinter der bürgerlich-parlamentarischen Fassade der BRD wieder jene Klassenkräfte die Herrschaft ausüben, „die 1933 Hitler zur Macht gebracht haben“ und die versuchen, „die Macht des deutschen Imperialismus wiederherzustellen“.173 Die SED geißelte die Bildung der BRD und die Spaltung Deutschlands als nationalen Verrat. Sie rief zur Entfaltung einer breiten Protestbewegung gegen die damit verbundenen Gefahren für den Frieden, für die Einheit der deutschen Nation und für die Wahrnehmung der Chancen zur Schaffung eines souveränen deutschen demokratischen Friedensstaates auf. Presse und Rundfunk trugen dazu bei, daß sich eine Massenbewegung entwickelte. In öffentlichen Kundgebungen und Betriebsversammlungen artikulierten sich heftiger Protest, Zorn und Enttäuschung sowie der Wille, die geschichtliche Wende im Osten Deutschlands unumkehrbar zu machen, staatlich fest zu verankern, den Frieden wirksam zu sichern und den beschrittenen Weg der Demokratie und des gesellschaftlichen Fortschritts fortzusetzen.
Im Unterschied zur Konstituierung des westzonalen Separatstaates erfolgte die der Deutschen Demokratischen Republik unter Einbeziehung breitester Kreise des Volkes. Mit großer Spannung sahen nicht nur die Mitglieder der SED der für den 4.Oktober 1949 einberufenen 22. (36.) Tagung des Parteivorstandes der SED entgegen.
Am Vormittag dieses Tages, einem Dienstag, trafen in Berlin, im „Zentralhaus der Einheit“, Lothringer Str.1 (heute Institut für Marxismus-Leninismus beim ZK der SED, Wilhelm-Pieck-Str.1), die Mitglieder des Parteivorstandes der SED, der zu dieser Zeit 63 Mitglieder umfaßte, zu ihrer Tagung zusammen. Die Atmosphäre in dem nicht allzu großen, langgestreckten Tagungsraum war erwartungsvoll, ja spannungsgeladen. Entscheidungen von historischer Tragweite standen an.
Zum ersten Punkt der Tagesordnung ergriff Franz Dahlem das Wort und erstattete Bericht über die Tätigkeit der Kommission zur Ausarbeitung des programmatischen Dokuments „Die Nationale Front des demokratischen Deutschland und die Sozialistische Einheitspartei Deutschlands“, das – da eine gründliche Arbeit geleistet worden war – ohne Aussprache verabschiedet werden konnte. Damit stand fest, daß die SED nach der Schaffung der BRD den Kampf um Friedenssicherung auf deutschem Boden und um die demokratische Einheit Deutschlands an der Spitze aller deutschen Patrioten verstärkt fortsetzen werde. Doch das allein konnte nicht die Antwort auf die anstehenden Probleme sein. Es mußte mehr geschehen. Deshalb galt das Hauptinteresse der Anwesenden dem zweiten Tagesordnungspunkt. Er lautete kurz, aber inhaltsschwer: „Staatliche Maßnahmen.“ 174 Eindringlich charakterisierte der Referent Wilhelm Pieck den nationalen Notstand, den Friedensnotstand, die dem deutschen Volk durch die Politik des Imperialismus drohenden Gefahren. Tiefe Sorge und nationales Verantwortungsbewußtsein sprachen aus seinen Ausführungen zur Erläuterung nach Bildung des Westzonenstaates notwendigen Entscheidungen. „Es ist oft davon gesprochen und oft darauf angetippt worden, ob man nicht eine Ostregierung schaffen müsse. Wir haben bisher, wenn solche Anregungen an uns herankamen, immer darauf hingewiesen, daß wir zunächst abwarten müssen, was sich im separaten Weststaat vollziehen wird … Wir haben uns lange überlegt, ob wir mit einem Vorschlag zur Bildung einer Regierung der Deutschen Demokratischen Republik hervortreten sollen.“ 175 Nunmehr aber sei die Lage „so ernst, daß wir um diesen Schritt nicht mehr herumkommen können“. Es sei jetzt unbedingt notwendig, „eine Kampfbasis … zu schaffen, die es den feindlichen Mächten unmöglich machen soll, ihre Pläne durchzuführen und das deutsche Volk erneut in einen Krieg hineinzutreiben“.176 Der deutsche demokratische Friedensstaat müsse unter Führung der Arbeiterklasse dort, wo die Bedingungen für ihn durch restlose Beseitigung von Faschismus und Militarismus und demokratischen Neuaufbau geschaffen wurden, errichtet werden.
Beide aufs engste miteinander verbundene Aufgaben, der nationale und Friedenskampf und die Schaffung und Entwicklung des deutschen Friedensstaates als Arbeiter-und-Bauern-Staat, setzten als Grundbedingung des Erfolges voraus, ein enges Bündnis mit der Sowjetunion und den anderen sozialistischen Staaten herzustellen und systematisch zu festigen. „Das Leben und die Zukunft des deutschen Volkes erfordern die enge und unverbrüchliche Freundschaft des deutschen Volkes mit der Sowjetunion und den Ländern der Volksdemokratie“, wurde dazu in der Entschließung zur Nationalen Front hervorgehoben.177
Der Parteivorstand beauftragte das Politbüro, mit den anderen Blockparteien über die Bildung einer provisorischen Regierung zu verhandeln, und beschloß: „Der Parteivorstand schlägt Genossen Wilhelm Pieck als Präsidenten der Deutschen Demokratischen Republik und Genossen Otto Grotewohl als Ministerpräsidenten vor.“ 178
Nachdem sich die Mitglieder des Parteivorstandes der SED damit geschlossen hinter die von Wilhelm Pieck unterbreiteten Vorschläge zur unmittelbaren Vorbereitung der Konstituierung der Deutschen Demokratischen Republik gestellt hatten, galt es nunmehr, die gesamte Partei für die Verwirklichung der gefaßten Beschlüsse zu mobilisieren.
Auch die Mehrheit derjenigen, die an der Seite der Arbeiterklasse, im sozialen und politischen Bündnis mit ihr umgestaltet und aufgebaut hatten, drängten darauf, das gemeinsame Werk mit der Gründung der Deutschen Demokratischen Republik fest zu verankern.
Die Gespräche der SED mit den anderen Parteien zeitigten daher Übereinstimmung im Grundsätzlichen. Schließlich konnte auch eine Einigung über den Anteil jeder Partei an der Regierung erzielt werden. Allerdings wurden von einigen Politikern der CDU und der LDPD Bedenken zu Wegen und Verfahrensfragen – vor allem hinsichtlich des Termins für die ersten Volkskammerwahlen und die Umbildung des Deutschen Volksrates zur Provisorischen Volkskammer – angemeldet. Dahinter verbargen sich auch Versuche, den Einfluß der SED zurückzudrängen und eine Entwicklung analog der in den volksdemokratischen Staaten zu verhindern. Doch konnten sich diese Politiker dem auch von Mitgliedern ihrer Parteien und von den Werktätigen in vielfacher Weise artikulierten Gebot, an der Seite der SED voranzuschreiten, nicht entziehen. Auf der gemeinsamen Sitzung des zentralen Blockausschusses mit dem Präsidium des Deutschen Volksrates am 5. Oktober 1949 kam es – nach zum Teil heftigen Diskussionen – zu einstimmig gefaßten Beschlüssen. Gegenüber Auffassungen, die in den Diskussionen zutage getreten waren, präzisierte Wilhelm Pieck, daß es nicht um „eine Regierung Gesamtdeutschlands, sondern um eine Regierung der deutschen demokratischen Republik“, zugleich aber auch darum gehe, „daß sich in Deutschland ein Zentrum bildet, das wirklich auf die Verteidigung der elementarsten Rechte des deutschen Volkes eingestellt ist, auf die Verhinderung eines neuen Krieges … Dieses Zentrum kann unter den gegebenen Verhältnissen in Deutschland nur in unserer Zone geschaffen werden.“ 179
Die Konstituierung der Provisorischen Volkskammer und die Inkraftsetzung der Verfassung der Deutschen Demokratischen Republik
Am Freitag, dem 7.Oktober 1949, sollte der Deutsche Volksrat, der insgesamt 330 Mitglieder umfaßte, im Gebäude der DWK in der Leipziger Straße in Berlin zu seiner 9. und letzten Tagung zusammenkommen. Der Beginn der Tagung war auf 12 Uhr festgelegt worden, um auch den Mitgliedern, die aus weit entfernten Orten anreisen mußten, das rechtzeitige Eintreffen zu ermöglichen. Gegen 10 Uhr trafen die ersten Mitglieder des Volksrates im Tagungsgebäude ein. Junge Pioniere und FDJler begrüßten die Eintreffenden an der Tür des Sitzungssaales mit Blumen. Mitarbeiter des „Augenzeugen“, der DEFA-Wochenschau, bauten Scheinwerfer und Kameras im Sitzungssaal auf. In- und ausländische Journalisten versammelten sich. Es war kein Geheimnis, worum es ging. In seiner Ausgabe vom 7. Oktober 1949 hatte das „Neue Deutschland“ es angekündigt: „Tag der Geburt der Deutschen Demokratischen Republik. Die Welt blickt auf Berlin.“
Mit einiger Verspätung, um 12.44 Uhr, eröffnete Wilhelm Pieck, der mit seiner Person sechs Jahrzehnte des Kampfes der revolutionären deutschen Arbeiterbewegung gegen Imperialismus, Faschismus und Krieg, für einen fortschrittlichen, demokratischen deutschen Friedensstaat verkörperte, als einer der Vorsitzenden des Präsidiums des Deutschen Volksrates feierlich die Tagung.
Als ersten Tagungsordnungspunkt verlas er das Manifest „Die Nationale Front des demokratischen Deutschland“. Dieses vom Deutschen Volksrat auf der Grundlage der Vorschläge des Parteivorstandes der SED erarbeitete Dokument wurde nach kurzer Diskussion einstimmig und mit starkem Beifall angenommen.
Punkt 2 der Tagesordnung lautete: „Stellungnahme zur politischen Lage und Beratung der zu ergreifenden Maßnahmen“. Als entscheidende Schlußfolgerung aus der auf deutschem Boden entstandenen Lage, die er in einprägsamen Worten darlegte, nannte Wilhelm Pieck die Gründung der Deutschen Demokratischen Republik. „So grotesk es klingen mag“, stellte er fest, „der Volksrat steht vor der Erfüllung der ihm gestellten Aufgaben, indem er sich dem Namen nach auflöst und in eine höhere Form des Kampfes für Einheit und gerechten Frieden übergeht, in die Bildung einer provisorischen Volkskammer für die Deutsche Demokratische Republik. Dieser Volkskammer steht die hohe nationale Aufgabe zu, eine provisorische Regierung der Deutschen Demokratischen Republik zu schaffen.“ 180
Nach gründlicher Diskussion wurde dies einstimmig beschlossen. Der Deutsche Volksrat konstituierte sich unter minutenlangem Beifall seiner Mitglieder als Provisorische Volkskammer, und diese nahm die Gesetze über die Verfassung der Deutschen Demokratischen Republik und über die Provisorische Regierung an. Eine Entscheidung von historischer Tragweite war gefallen.
Die Deutsche Demokratische Republik, der deutsche, antifaschistische, dem Frieden verpflichtete und den Fortschritt verkörpernde Arbeiter-und-Bauern-Staat, war errichtet. Berlin wurde seine Hauptstadt. Die Ergebnisse der 1945 in einem Teil Deutschlands eingeleiteten geschichtlichen Wende und des demokratischen Neuaufbaus fanden ihre staatliche Verankerung.
Infolge der Spaltung Deutschlands durch den Imperialismus und der Bildung der monopolkapitalistischen BRD konnte der antifaschistisch-demokratische, fortschrittliche deutsche Friedensstaat nur auf einem Teil des deutschen Territoriums – dem gegenüber der BRD ökonomisch weniger entwickelten – errichtet werden. Dieser Umstand und die sich aus der Spaltung Deutschlands für die DDR langfristig ergebenden Aus- und Folgewirkungen belasteten den deutschen Arbeiter-und-Bauern-Staat mit einer schweren Hypothek. Dennoch krönte die Gründung der DDR die seit 1945 vollzogene geschichtliche Wende im Leben des deutschen Volkes und machte sie unumkehrbar, erstand auf deutschem Boden an der Seite der Sowjetunion und der anderen sozialistischen Länder ein Friedensbollwerk gegenüber allen Versuchen des Imperialismus, die Ergebnisse des zweiten Weltkrieges zu revidieren, hielt mit der DDR – weit in die Zukunft weisend – das Zeitalter des Sozialismus auf deutschem Boden Einzug.
Konstituierung des Deutschen Volksrates zur Provisorischen Volkskammer der DDR unter Vorsitz von Wilhelm Pieck, 7. Oktober 1949, In der ersten Reihe des Präsidiums v. r. n. l.: Walter Ulbricht, Wilhelmine Schirmer-Pröscher, Lothar Bolz, Otto Nuschke, Wilhelm Pieck, Hermann Kastner, Ernst Goldenbaum, Magdalene Stark-Wintersieg, Otto Grotewohl, Wilhelm Koenen; in der zweiten Reihe v. r. n. 1.: Elli Schmidt, Hans Reingruber, Vinzenz Müller, Käthe Kern, Herbert Warnke, Friedrich Ebert, Theodor Brugsch, Bernhard Göring, Erhard Hübener, Friedel Malter, Paul Merker
Das neue Deutschland, das die DDR verkörperte, hob sich deutlich von der Bundesrepublik Deutschland ab, die sich als „Kernstaat“ des wiederzuerrichtenden Deutschen Reiches verstand. Die Unterschiede zwischen diesen beiden Deutschlands waren grundlegend, die Abgrenzung beider voneinander bereits bei ihrer Entstehung tiefgreifend.
Die geschichtliche Wende beinhaltete Bruch und zugleich Fortsetzung – Bruch mit dem faschistischen, militaristischen, imperialistischen, reaktionären und volksfeindlichen Erbe und mit allen daran geknüpften Traditionen; Bewahrung, „Aufhebung“ und Wandlung des humanistischen, wirklich demokratischen und progressiven Erbes der deutschen Geschichte und Fortführung aller entsprechenden, insbesondere der proletarisch-revolutionären Traditionen. Der deutsche Arbeiter-und-Bauern-Staat ging unmittelbar aus den unter Hegemonie der Arbeiterklasse vollzogenen antiimperialistisch-demokratischen Umwälzungen und dem Ringen um die Errichtung eines deutschen demokratischen Friedensstaates hervor. Aber ohne den antifaschistischen Widerstandskampf, ohne Novemberrevolution und Gründung der KPD, ohne den über hundertjährigen Kampf der revolutionären deutschen Arbeiterbewegung wäre seine Errichtung nicht möglich gewesen. Weltgeschichtlich stand diese in der Entwicklungslinie, der von der Pariser Kommune über die Große Sozialistische Oktoberrevolution zur Befreiungsmission der sozialistischen Sowjetunion im zweiten Weltkrieg und schließlich zur Entstehung des Weltsystems sozialistischer Staaten führte.
Die DDR entstand gemäß dem Vermächtnis der antifaschistischen Widerstandskämpfer aus den Reihen der deutschen Arbeiterklasse und des deutschen Volkes, im Sinne des Kampfes der Völker der Anti-Hitler-Koalition und in Übereinstimmung mit den Beschlüssen der Konferenzen von Jalta und Potsdam. Mit dem ersten deutschen Arbeiter-und-Bauern-Staat wurde ein neues Kapitel der deutschen Geschichte aufgeschlagen.




