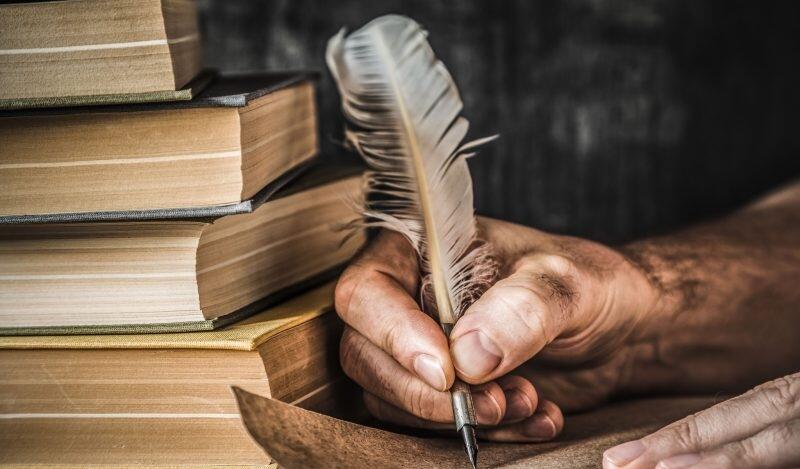Nach dreijährigen Verhandlungen haben sich die Delegierten des Zwischenstaatlichen Verhandlungsgremiums ( INB ) auf den Text des Pandemie-Übereinkommens geeinigt , der nun Ende Mai 2025 bei der 78. Weltgesundheitsversammlung (WHA) zur Abstimmung steht. Dieser Text kommt, nachdem die Verhandlungen aufgrund anhaltender Meinungsverschiedenheiten über geistiges Eigentum und Technologietransfers (Artikel 11), den Zugang zu „pandemiebezogenen Gesundheitsprodukten“ (Artikel 12) und One Health um ein weiteres Jahr verlängert worden waren.
Nachdem die Verhandlungen im April 2025 in einer Reihe von 24-Stunden-Sitzungen in letzter Minute ausgeweitet worden waren, wurde ein Entwurf genehmigt. Viele Länder meinten, sie seien durch Verhandlungen so weit gekommen, wie sie konnten, und es sei nun an der Zeit, ihn zur Abstimmung zu bringen.
Der neue Entwurf des Pandemie-Abkommens enthält mehrere interessante Elemente. So sieht das Pandemie-Abkommen vor, dass teilnehmende Hersteller (noch zu bestimmende) der WHO 20 % ihrer jeweiligen Arzneimittelproduktion zur Verfügung stellen, die Hälfte als Spende und die andere Hälfte zu erschwinglichen Preisen (ebenfalls zu bestimmen). Es wird erwartet, dass die WHO und andere internationale Partner diese und weitere Ressourcen für die Verteilung bündeln (im Rahmen eines noch zu bestimmenden, verbesserten COVAX -ähnlichen Mechanismus). Darüber hinaus soll ein noch relativ undefinierter „Koordinierender Finanzmechanismus“ (CFM) eingerichtet werden, um die Umsetzung des Pandemie-Abkommens und der geänderten Internationalen Gesundheitsvorschriften (IGV) zu unterstützen und im Falle einer Pandemie zusätzliche Finanzmittel an Entwicklungsländer auszuzahlen.
Diese Verpflichtungen bauen auf den Änderungen der IGV auf, die im September 2025 in Kraft treten und den Generaldirektor der WHO ermächtigen, eine „Pandemie-Notlage“ auszurufen. Dies stellt eine Verschärfung der internationalen Gesundheitsnotlage (PHEIC) dar, wobei eine „Pandemie-Notlage“ nun die höchste Alarmstufe darstellt und eine Vielzahl nationaler und internationaler Reaktionen auslösen soll. Die PHEIC wurde seit 2005 achtmal ausgerufen, unter anderem wegen des anhaltenden Mpocken-Ausbruchs in Zentralafrika, und es besteht weiterhin Unklarheit darüber, ob ein Ausbruch wie Mpocken nun auch als Pandemie-Notlage gelten würde. Das Pandemie-Übereinkommen definiert nun auch die ersten einigermaßen greifbaren Auswirkungen der Ausrufung einer Pandemie-Notlage, obwohl diese auslösenden Auswirkungen derzeit am deutlichsten bei der Mobilisierung „pandemierelevanter Gesundheitsprodukte“ zu erkennen sind.
Im Großen und Ganzen liest sich der Text so, wie man es erwarten würde, wenn Diplomaten aus fast 200 Ländern jahrelang jeden Satz verhandelt und geprüft hätten. Obwohl sich die Vereinigten Staaten und Argentinien Anfang des Jahres aus diesen Verhandlungen zurückzogen, musste das Dokument dennoch die vielfältigen und oft widersprüchlichen Interessen der Delegierten aus Russland und der Ukraine, dem Iran und Israel, Indien und Pakistan berücksichtigen; ganz zu schweigen von den Mitgliedern der Afrika-Gruppe, die das Pandemie-Abkommen größtenteils als einen schlechten Deal für Afrika betrachteten (siehe unten). Das Ergebnis sind daher 30 Seiten voller vager Absichtserklärungen, oft mit Verweisen auf die Wahrung der nationalen Souveränität versehen, um den Widerstand zu neutralisieren. So wie es aussieht, hat das „Abkommen“ vor allem symbolische Bedeutung, da ein Scheitern einer Einigung für alle Beteiligten peinlich gewesen wäre.
Es wäre jedoch kleinlich, nicht zu verstehen, dass das Pandemie-Übereinkommen die „Pandemieprävention, -vorsorge und -bekämpfung“ als definitiven „Raum“ globalen politischen Handelns konsolidiert, für den bereits zahlreiche neue Institutionen und Finanzierungsquellen geschaffen wurden. Seine mögliche Verabschiedung in internationales Recht ist im globalen Gesundheitsbereich ungewöhnlich und stellt erst das zweite Mal dar, dass ein solcher globaler Gesundheitspakt geschaffen wurde (das Rahmenübereinkommen der WHO zur Eindämmung des Tabakgebrauchs war das erste). Es hat das Potenzial, erhebliche Ressourcen und politische Maßnahmen zu mobilisieren.
So hatten sich beispielsweise nach Schätzungen des Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) die Ausgaben für die Vorbereitung auf künftige Pandemien zwischen 2009 und 2019 bereits mehr als vervierfacht, bevor die Covid-19-Pandemie das Thema unmissverständlich in die internationale „Hochpolitik“ rückte. Im Abkommen verpflichten sich die Regierungen, diese Mittel für Pandemieprävention, -vorsorge und -reaktion „beizubehalten oder zu erhöhen“ und Mechanismen zu ihrer Umsetzung zu unterstützen. Wie REPPARE an anderer Stelle berichtet, belaufen sich die beantragten Mittel für die Pandemievorsorge auf 31,1 Milliarden US-Dollar pro Jahr (zum Vergleich: etwa das Achtfache der weltweiten Ausgaben für Malaria). Davon müssen 26,4 Milliarden US-Dollar aus Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen (LMICs) kommen, während 10,5 Milliarden US-Dollar an neuer Entwicklungshilfe (ODA) aufgebracht werden müssten. Vermutlich bevorzugt die WHO die Verteilung dieser ODA über den noch zu definierenden CFM.
Impfgerechtigkeit
Das erklärte Leitprinzip des Pandemie-Abkommens ist „Gerechtigkeit “. Dieser Fokus wird maßgeblich von der WHO und assoziierten Philanthropen, NGOs, wissenschaftlichen Beratern sowie mehreren LMICs (insbesondere in Afrika) vorangetrieben, die einen Mangel an Gerechtigkeit, vor allem an „Impfstoffgerechtigkeit“, als Hauptversagen der Covid-19-Maßnahmen ansehen. Vertreter ärmerer Länder, aber auch wichtige Geber, kritisieren den ungleichen Zugang zu Impfstoffen gegen SARS-CoV-2 als zentrales Versagen der Covid-19-Maßnahmen und als Grund für die erhöhte Covid-19-Sterblichkeit. Dieser ungleiche Zugang wird als „Impfstoffnationalismus“ bezeichnet und bezieht sich auf die Hortung von Covid-19-Impfstoffen in Ländern mit hohem Einkommen (HICs) während der Pandemie, wodurch die Impfstoffverfügbarkeit in LMICs eingeschränkt wurde. Das Weltwirtschaftsforum beispielsweise behauptet , eine gerechtere Verteilung der Impfstoffe hätte über eine Million Menschenleben gerettet.
Während in Europa genügend Covid-Impfstoffdosen bestellt wurden, um die gesamte Bevölkerung vom Säugling bis zum Senioren mehr als dreimal zu immunisieren , und diese nun vernichtet werden , blieb vielen afrikanischen Ländern der Zugang verwehrt. Tatsächlich erhielten Entwicklungsländer erst Monate, nachdem reichere Länder bereits vollständig geimpft waren, große Mengen an Coronavirus-Impfstoffen. Selbst nachdem die Impfung in den meisten HIC-Ländern im Sommer 2021 flächendeckend verfügbar war, waren in Ländern mit niedrigem Einkommen weniger als 2 % geimpft, viele davon mit chinesischen Impfstoffen, die westliche Länder als minderwertig erachteten und daher nicht für eine Reisegenehmigung in Frage kamen.
Die Befürworter des Pandemie-Übereinkommens stellen den Erfolg der allgemeinen Impfung trotz ihrer begrenzten und rasch nachlassenden Schutzwirkung und der zahlreichen berichteten Nebenwirkungen nicht in Frage. Doch selbst wenn man davon ausgeht, dass Coronavirus-Impfstoffe sicher und wirksam sind, bleiben globale Vergleiche der Impfraten unsinnig. In den Hochrisikogebieten (HICs) betrafen die meisten Covid-19-Todesfälle Menschen über 80 Jahre, was auf die Notwendigkeit kontextspezifischer Interventionen bei den am stärksten gefährdeten Personen hindeutet.
In den meisten Ländern mit niedrigem Einkommen (LICs) macht diese Risikogruppe nur einen verschwindend geringen Teil der Bevölkerung aus. In Afrika beispielsweise liegt das Durchschnittsalter bei 19 Jahren, was ein völlig anderes Pandemierisiko- und Reaktionsprofil ergibt. Eine Metaanalyse von Bluttests von Bergeri et al. deutet zudem darauf hin, dass die meisten Afrikaner Mitte 2021 nach einer Infektion bereits eine Immunität gegen SARS-CoV-2 besaßen. Trotz dieser Variablen wurden die Impfstoffhersteller ermutigt, Impfstoffe in Massen für die weltweite Einführung zu produzieren, erhielten Notfallzulassungen, wurden von der Haftung befreit, konnten von Vorabkaufverpflichtungen profitieren und auf Kosten der Steuerzahler Rekordgewinne erzielen.
Wie bereits berichtet , droht der Einsatz großer Ressourcen für die Pandemievorsorge, insbesondere für teure Überwachung, Diagnostik, Forschung und Entwicklung sowie die Herstellung biomedizinischer Gegenmaßnahmen, hohe Opportunitätskosten zu verursachen, da viele LMICs mit anderen, dringlicheren und zerstörerischeren Krankheitslasten konfrontiert sind. Dies wurde von vielen afrikanischen Ländern während der Verhandlungen zum Pandemieabkommen zumindest implizit anerkannt. Viele widersetzten sich der Aufnahme von One Health in das Abkommen mit der Begründung, es sei unfinanzierbar und habe in ihren nationalen strategischen Gesundheitsplänen keine Priorität.
Um einen afrikanischen Delegierten beim INB zu paraphrasieren: „Wir haben Schwierigkeiten, eine koordinierte Überwachung innerhalb des Gesundheitssektors zu erreichen, geschweige denn eine integrierte Überwachung über alle Sektoren hinweg.“ Diese Sorge deutet nicht nur auf die Notwendigkeit lokaler Strategien hin, um eine effiziente Nutzung knapper Ressourcen zu gewährleisten, sondern auch auf die Notwendigkeit von Strategien, die den kontextualisierten Bedarf besser erfassen, um mehr Wirksamkeit und echte Gesundheitsgerechtigkeit zu erreichen, nicht nur „Produktgerechtigkeit“.
Doch selbst wenn Produktgerechtigkeit in bestimmten Fällen ein erwünschtes und gerechtfertigtes Ergebnis ist, enthält das Pandemie-Übereinkommen keine Garantie dafür, da arme Länder ohne eigene Produktionskapazitäten in der Praxis immer das Schlusslicht bilden werden. Obwohl das „Pathogen Access and Benefit System“ (PABS) in Artikel 12 des Pandemie-Übereinkommens die Produktgerechtigkeit verbessern soll, ist es vernünftig, von wohlhabenden Ländern zu erwarten, dass sie ihren eigenen Bedarf decken, bevor sie größere Mengen den LICs oder der WHO zur Verteilung zur Verfügung stellen (wodurch diese auf Spenden angewiesen bleiben – was sich während COVAX als problematisch erwies). Daher ist schwer zu erkennen, was das Pandemie-Übereinkommen in dieser Hinsicht verbessert hat, abgesehen von der Kodifizierung äußerst lockerer normativer Verpflichtungen zur Verbesserung des gerechten Zugangs zu Pandemieprodukten – ein Bereich, in dem die Länder bereits weitgehend Einigkeit erzielen.
Das Pandemie-Abkommen fordert zudem mehr Transparenz bei Verträgen zwischen Ländern und Herstellern. Diese Maßnahme gilt als Mechanismus, der grassierenden Impfstoffnationalismus und Profitgier aufdecken kann, allerdings nur „soweit angemessen“ und „im Einklang mit nationalen Vorschriften“. Daher ist fraglich, ob solch fadenscheinige Formulierungen EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen davon abgehalten hätten, Milliardengeschäfte mit dem Pfizer-Chef über geheime SMS abzuschließen, oder ob andere Länder ihre eigenen bilateralen Vorkaufs- und Vorratsaktivitäten hätten durchführen können.
Natürlich waren sich die Verhandlungsführer der LMIC-Länder im INB all dessen bewusst, weshalb sich die Konfliktlinie in den Verhandlungen zum Pandemie-Abkommen hauptsächlich auf Fragen des geistigen Eigentums und des Technologietransfers konzentrierte. Entwicklungsländer wollen im Wesentlichen nicht auf Almosen angewiesen sein und Impfstoffe und Therapeutika selbst produzieren, ohne teure Lizenzgebühren an die Pharmariesen des Nordens zahlen zu müssen. Der Norden hingegen hält an seinen Verpflichtungen zum Schutz geistigen Eigentums, wie sie in TRIPS und TRIPS-Plus festgelegt sind , fest und betrachtet diese Rechtsmechanismen als wichtigen Schutz für seine Pharmaindustrie.
Als „Kompromiss“ enthält das Pandemie-Abkommen Bestimmungen für eine „geografisch diversifizierte lokale Produktion“ von Pandemieprodukten und eine engere internationale Zusammenarbeit in Forschung und Entwicklung sowie vereinfachte Lizenzierungsverfahren, die den Technologietransfer sicherstellen sollen. Der Wortlaut des Pandemie-Abkommens ist jedoch unspezifisch, und die EU bestand darauf, der Technologietransfer-Klausel in letzter Minute Fußnoten hinzuzufügen , um sicherzustellen, dass diese nur „wie einvernehmlich vereinbart“ in Kraft treten. Somit wirkt das Pandemie-Abkommen wie eine Verfestigung des „Business as usual“.
Überwachung und One Health
Während die Befürworter des Pandemie-Abkommens einen Mangel an „Gerechtigkeit“ als Hauptversagen der Covid-19- Reaktion ansehen , wird auch eine „mangelnde Vorbereitung“ als Ursache für das Auftreten und die anschließende globale Verbreitung des neuen Coronavirus angesehen. Das Ziel, die „existenzielle Bedrohung“ durch neu auftretende Infektionskrankheiten zu beseitigen, ist das vorherrschende Ziel im politischen Vokabular und wird vom High Level Independent Panel der G20 , der Weltbank , der WHO , dem Elders‘ Proposal for Action und dem Global Preparedness Monitoring Board unterstützt . Wie wir bereits an anderer Stelle argumentiert haben, basieren diese Einschätzungen größtenteils auf schwachen Beweisen , problematischen Methoden , der Überbewertung politischer Überlegenheit gegenüber Fachwissen und vereinfachten Modellen , und trotzdem blieben sie unbestreitbare tragende Säulen der INB-Verhandlungen.
Als Reaktion auf künftige Zoonosen fordert das Pandemie-Übereinkommen einen „One Health“-Ansatz. Grundsätzlich spiegelt One Health die selbstverständliche Tatsache wider, dass die Gesundheit von Mensch, Tier und Umwelt eng miteinander verbunden sind. In der Praxis erfordert One Health jedoch die gezielte Überwachung von Boden, Wasser, Haus- und Nutztieren, um mögliche Auswirkungen auf den Menschen zu identifizieren. Wie oben hervorgehoben, erfordert die Umsetzung von One Health integrierte Systeme über alle Sektoren hinweg mit hochentwickelten Laborkapazitäten, Prozessen, Informationssystemen und geschultem Personal. Infolgedessen schätzt die Weltbank die Kosten für die Umsetzung von One Health auf rund 11 Milliarden US-Dollar pro Jahr , zusätzlich zu den 31,1 Milliarden US-Dollar, die derzeit für die Finanzierung der IGV und des Pandemie-Übereinkommens veranschlagt werden.
Da immer mehr Labore nach Krankheitserregern und ihren Mutationen suchen, ist garantiert, dass auch mehr gefunden werden. Angesichts der aktuellen Praxis übermäßig sicherheitsorientierter, reflexartiger Risikobewertungen ist absehbar, dass weitere Entdeckungen als „hochriskant“ eingestuft werden, obwohl der Mensch seit Jahrhunderten ohne größere Zwischenfälle mit vielen dieser Krankheitserreger koexistiert und das Risiko einer geografischen Verbreitung gering ist (z. B. Reaktionen auf Mpocken ). Die Logik des Pandemie-Abkommens besteht darin, dass auf der Grundlage genomischer Fortschritte schnell „pandemiebezogene Gesundheitsprodukte“ entwickelt und über das „WHO Pathogen Access and Benefit-Sharing System“ (PABS) verteilt werden können.
Dies ist aus mindestens drei Gründen beunruhigend. Erstens werden enorme Ressourcen in die Bekämpfung dieser gering belastenden potenziellen Risiken gesteckt, während alltägliche Killer wie Malaria weiterhin nur unzureichende Maßnahmen ergreifen werden. Zweitens wird dieser Aspekt des Pandemie-Abkommens zweifellos eine Eigendynamik entwickeln, da neue Bedrohungswahrnehmungen eine immer stärkere Überwachung rechtfertigen, die in einem sich selbst verstärkenden Rückschritt der Versicherheitlichung und Über-Biomedizinalisierung noch mehr potenzielle Bedrohungen aufdecken wird. Schließlich findet sich im Pandemie-Abkommen an keiner Stelle die Erwähnung der Tatsache, dass weiterhin gefährliche Gain-of-Function-Forschung betrieben wird, um die im Rahmen von PABS erwarteten „Pandemievorteile“ zu erzielen, obwohl die Verpflichtungen zur Biosicherheit am Rande erwähnt werden.
Dies deutet darauf hin, dass sich die mit dem Pandemie-Übereinkommen verbundenen Risikobewertungen ausschließlich auf natürliche Zoonosen-Übertragungsereignisse konzentrieren und einen Risikobereich ignorieren, der möglicherweise tatsächlich für die schlimmste Pandemie der letzten 100 Jahre verantwortlich war. Daher ist die jüngste Covid-19-Pandemie im Hinblick auf die Pandemievorbereitung und -prävention für das Pandemie-Übereinkommen wahrscheinlich irrelevant.
Infodemien
Die Katastrophen der Covid-19-Maßnahmen haben das Vertrauen in die WHO und andere öffentliche Gesundheitsinstitutionen untergraben. Dies äußerte sich in einer deutlichen Skepsis gegenüber der Pandemievorsorge. Hunderttausende Menschen unterzeichneten beispielsweise Petitionen, die vor dem Machtkampf der WHO zur Untergrabung nationaler Souveränität warnten. Diese Botschaften entstanden vor allem, nachdem die vorgeschlagenen Änderungen der IGV in Umlauf kamen. Diese enthielten ursprünglich Formulierungen, die es der WHO erlaubten, während einer Pandemie verbindliche Empfehlungen an nationale Regierungen abzugeben. Letztendlich wurden diese Pläne nicht umgesetzt.
Die Verfasser des Pandemie-Übereinkommens scheinen diese Bedenken geteilt zu haben. Artikel 24.2 besagt in ungewöhnlich klaren Worten: „Das WHO-Pandemie-Übereinkommen ist nicht so auszulegen, als ob es dem WHO-Sekretariat, einschließlich des WHO-Generaldirektors, die Befugnis erteilt, die nationalen und/oder innerstaatlichen Gesetze oder Richtlinien einer Vertragspartei anzuordnen, anzuordnen, zu ändern oder anderweitig vorzuschreiben oder die Vertragsparteien zu bestimmten Maßnahmen zu verpflichten oder anderweitig zu verpflichten, wie etwa das Verbot oder die Annahme von Reisen, die Verhängung von Impfvorschriften oder therapeutischen oder diagnostischen Maßnahmen oder die Umsetzung von Ausgangssperren.“
In der Praxis ist diese Klausel wirkungslos, da es keine Möglichkeit gibt, die in Artikel 24.2 ausgeschlossenen Auslegungen zu erreichen, da die WHO schlichtweg nicht die rechtliche Befugnis hat, die Einhaltung der Vorschriften zu erzwingen. Was nicht-pharmazeutische Maßnahmen betrifft, verpflichten sich die Unterzeichner des Pandemie-Abkommens lediglich, deren Wirksamkeit und Einhaltung zu erforschen. Dies umfasst nicht nur epidemiologische Untersuchungen, sondern auch „die Nutzung der Sozial- und Verhaltenswissenschaften, der Risikokommunikation und des gesellschaftlichen Engagements“.
Darüber hinaus vereinbaren die Staaten, „Maßnahmen zur Stärkung der wissenschaftlichen Erkenntnisse, der öffentlichen Gesundheit und der Pandemiekompetenz der Bevölkerung“ zu ergreifen. Hier ist nichts verbindlich oder konkretisiert, sodass den Ländern ausreichend Spielraum bleibt, selbst zu bestimmen, wie und in welchem Umfang nicht-pharmazeutische Maßnahmen (im Guten wie im Schlechten) eingesetzt werden sollen. Es geht lediglich darum, (noch einmal) schriftlich festzuhalten, was die Staaten bereits tun – eine wohl sinnlose Übung.
Dennoch dürften Verweise auf die Verhaltenswissenschaften bei WHO-Kritikern Misstrauen auslösen. Insbesondere diejenigen, die sich über die Covid-Reaktion Sorgen machen, erinnern sich daran, wie Verhaltensforscher der britischen Regierung rieten, den Menschen das Gefühl zu geben, „ ausreichend persönlich bedroht“ zu sein, und wie der britische Gesundheitsminister Matt Hancock WhatsApp-Chats darüber teilte, wie er die Ankündigung einer neuen Variante „inszenieren“ wolle, um „allen Angst einzujagen“. Obwohl es Aufgabe der Gesundheitsbehörden ist, Empfehlungen zur Orientierung der Öffentlichkeit herauszugeben, gibt es ehrlichere und effektivere Methoden, dies zu tun. Andernfalls untergräbt der öffentliche Eindruck von Unaufrichtigkeit das Vertrauen, was laut Befürwortern des Pandemie-Abkommens für eine wirksame Pandemie-Reaktion entscheidend ist.
In gewisser Weise ist der explizite Ausschluss von von der WHO verhängten Lockdowns oder Impfvorschriften ein hervorragendes Beispiel für das, was die WHO als „Infodemie-Management“ bezeichnet. Im WHO-Handbuch „Epidemiemanagement“ wird eine Infodemie definiert als „eine Überfülle an Informationen, ob zutreffend oder nicht, im digitalen und physischen Raum, die ein akutes Gesundheitsereignis wie einen Ausbruch oder eine Epidemie begleitet“. Das Infodemie-Management hat es auch in die überarbeiteten IGV geschafft, wo „Risikokommunikation, einschließlich der Bekämpfung von Fehl- und Desinformation“, als Kernkompetenz der öffentlichen Gesundheit definiert wird.
Es ist verständlich, dass Kritiker des Infodemie-Managements die „Bekämpfung von Fehlinformationen“ als Euphemismus für Zensur verstehen, insbesondere angesichts der Tatsache, dass Wissenschaftler, die sich während der Covid-Pandemie gegen die gängigen Narrative aussprachen, an den Rand gedrängt und „gecancelt“ wurden. Das erste Prinzip des Infodemie-Managements, das in „Managing Epidemics“ hervorgehoben wird, ist jedoch, „auf Bedenken zu hören“. Dies scheint das Pandemie-Abkommen getan zu haben, indem es proaktiv Lockdowns ausschloss, die ohnehin nicht rechtlich verhängt werden könnten. Während der „Nullentwurf“ vor drei Jahren noch vorsah, dass von den Ländern erwartet wird, Fehlinformationen zu „bekämpfen“, wird dies heute nur noch in der Präambel erwähnt, wo der rechtzeitige Informationsaustausch die Entstehung von Fehlinformationen verhindern soll.
Dennoch gibt die Sprache rund um Infodemien Anlass zu zahlreichen Bedenken, die unbeantwortet bleiben und einer eingehenderen Betrachtung bedürfen.
Erstens sind die Kriterien, nach denen Informationen als korrekt beurteilt werden sollen, und wer sie beurteilt, unklar. Dies lässt zwar den Prozess undefiniert und ermöglicht es den Ländern, ihre eigenen Kontrollmechanismen zu entwickeln, bietet aber auch Raum für Missbrauch. Es ist durchaus denkbar, dass einige Länder (mit Unterstützung der WHO) abweichende Meinungen unter dem Deckmantel der Infodemie-Bekämpfung zum Schweigen bringen. Es ist auch nicht ausgeschlossen, dass es zu einer schleichenden Ausweitung der Mission kommt, bei der auch nicht gesundheitsbezogene Informationen unter dem Vorwand der „Wahrung von Frieden und Sicherheit“ während eines Gesundheits- oder sonstigen Notfalls kontrolliert werden.
Zweitens besteht die ernste Gefahr, dass durch schlechtes Informationsmanagement unbeabsichtigt gute wissenschaftliche Erkenntnisse ausgeschlossen werden und so die öffentliche Gesundheit insgesamt gefährdet wird. Wie während der Covid-Pandemie zu beobachten war, verbreiteten sich Botschaften, die behaupteten, die Wissenschaft sei sich einig, und wurden oft dazu genutzt, glaubwürdige wissenschaftliche Erkenntnisse zu diskreditieren.
Drittens liegt der Logik von Infodemien die unterschwellige Annahme zugrunde, dass Gesundheitsbehörden und ihre Partner korrekt handeln, ihre Politik stets ausschließlich auf den besten verfügbaren Erkenntnissen beruht, frei von Interessenkonflikten ist, Informationen dieser Behörden weder gefiltert noch verfälscht werden und die Menschen von Behörden keine Begründung durch immanente Kritik oder Selbstreflexion erwarten sollten. Offensichtlich sind öffentliche Gesundheitseinrichtungen wie jede andere menschliche Institution denselben potenziellen Vorurteilen und Fallstricken unterworfen.
Die Zukunft von Pandemien und dieses Abkommen
Wenham und Potluru von der London School of Economics schätzen, dass die langwierigen Verhandlungen über das Pandemie-Abkommen bis Mai 2024 bereits über 200 Millionen Dollar gekostet haben. Natürlich ist dies nur ein Bruchteil der öffentlichen Ausgaben für die Vorbereitung auf hypothetische zukünftige Pandemien. Die Höhe der ODA, die WHO, Weltbank und G20 jährlich fordern, entspräche etwa dem Fünf- bis Zehnfachen der jährlichen Ausgaben für die Bekämpfung der Tuberkulose – einer Krankheit, an der laut WHO-Angaben in den letzten fünf Jahren etwa so viele Menschen gestorben sind wie an Covid-19, und zwar in einem viel niedrigeren Durchschnittsalter (was einen höheren Verlust an Lebensjahren bedeutet).
Obwohl die jährlichen Entwicklungshilfezahlungen von 10,5 Milliarden US-Dollar für Pandemieprävention, -vorsorge und -bekämpfung unwahrscheinlich sind, wäre selbst eine vorsichtigere Erhöhung mit Opportunitätskosten verbunden. Zudem kommen diese finanziellen Forderungen zu einem Wendepunkt in der globalen Gesundheitspolitik, da die Entwicklungshilfe im Gesundheitswesen (DAH) durch gravierende Unterbrechungen und Kürzungen in den USA, Großbritannien, Europa und Japan massiv unter Druck steht. Die zunehmende Knappheit erfordert daher eine bessere Nutzung der Gesundheitsfinanzierung, nicht einfach nur mehr vom Alten.
Darüber hinaus sind, wie REPPARE gezeigt hat , die alarmierenden Aussagen von WHO, Weltbank und G20 zum Pandemierisiko empirisch nicht fundiert. Das macht die gesamte Grundlage des Pandemie-Abkommens fragwürdig. So spricht die Weltbank von Millionen von jährlichen Todesfällen durch Zoonosen, obwohl diese Zahl im halben Jahrhundert vor der Covid-19-Pandemie, hochgerechnet auf die heutige Weltbevölkerung, weniger als 400.000 pro Jahr betrug, von denen 95 % auf HIV zurückzuführen sind. Dass heute viel mehr neue Erreger gefunden werden als noch vor wenigen Jahrzehnten, ist nicht unbedingt ein Hinweis auf ein erhöhtes Risiko, sondern vielmehr die Folge eines gestiegenen Forschungsinteresses und vor allem des Einsatzes moderner Diagnostik- und Meldeverfahren.
In vielerlei Hinsicht ist das Pandemie-Abkommen nur ein Aushängeschild einer neuen Pandemie-Industrie, die in den letzten fünf Jahren bereits an Dynamik gewonnen hat. Dazu gehören beispielsweise Projekte zur Erregerüberwachung, für die der 2021 bei der Weltbank eingerichtete Pandemie-Fonds bereits 2,1 Milliarden Dollar an Geberzusagen erhalten und für die Umsetzung (bei Einrechnung der Zusätzlichkeit) fast sieben Milliarden Dollar eingeworben hat. 2021 wurde in Berlin der WHO-Pandemie-Hub eröffnet, der Daten und biologisches Material aus aller Welt als Frühwarnsystem für Pandemien zusammenführt. In Kapstadt will der WHO-mRNA-Hub den internationalen Technologietransfer fördern.
Und die 100-Tage-Mission , die vor allem von der öffentlich-privaten Partnerschaft CEPI vorangetrieben wird, zielt darauf ab, sicherzustellen, dass bei der nächsten Pandemie innerhalb von nur 100 Tagen Impfstoffe verfügbar sind. Dies erfordert nicht nur erhebliche Investitionen in Forschung und Entwicklung sowie Produktionsanlagen, sondern auch eine weitere Beschleunigung klinischer Studien und der Notfallzulassung, was potenzielle Risiken für die Impfstoffsicherheit birgt.
Um das komplexe Ökosystem verschiedener Pandemieinitiativen zu koordinieren, müssen die Unterzeichner des Pandemie-Übereinkommens gesamtgesellschaftliche Pandemiepläne entwickeln, die im Falle einer echten Krise vermutlich ignoriert werden, wie dies bei den bestehenden Plänen im Jahr 2020 der Fall war. Darüber hinaus wird von ihnen erwartet, dass sie der Konferenz der Vertragsparteien über das Sekretariat regelmäßig über ihre Umsetzung des WHO-Pandemie-Übereinkommens Bericht erstatten. Das WHO-Sekretariat wiederum veröffentlicht Leitlinien, Empfehlungen und andere unverbindliche Maßnahmen. Dies deutet darauf hin, dass das Pandemie-Übereinkommen globale Normen setzen und deren Einhaltung durch die üblichen Mechanismen des Nudging, der öffentlichen Bekanntmachung und der Beschämung sowie durch vom CFM oder durch andere Entwicklungskredite der Weltbank auferlegte Konditionalitäten anstreben wird. Im letzteren Fall könnten die im Rahmen der Konferenz der Vertragsparteien getroffenen politischen Entscheidungen für einkommensschwache Länder einen stärkeren Zwang ausüben.
Die Bedeutung dieser neuen globalen Pandemie-Bürokratie sollte jedoch nicht überschätzt werden, und die Wirksamkeit des Pandemie-Abkommens ist nicht unmittelbar ersichtlich. Schließlich ist es nur eines in einer langen Liste von Abkommen der Vereinten Nationen, von denen nur wenige, wie die Klimakonferenz oder der Atomwaffensperrvertrag, größere Aufmerksamkeit erhalten. Daher ist es möglich, dass sowohl die Konferenz der Vertragsparteien als auch das Pandemie-Abkommen politisch inaktiv werden.
Was diese gemäßigte Sichtweise jedoch dämpft, ist eine wesentliche Ähnlichkeit zwischen den drei genannten Politikbereichen. Atomwaffen, Klimawandel und Pandemien werden ständig als „existenzielle Bedrohung“ dargestellt, die die Medienberichterstattung, die daraus resultierende politische Motivation und anhaltende Investitionen antreibt. Im Falle des Pandemierisikos zeichnen die offiziellen Narrative eine apokalyptische Vision von immer häufigeren Pandemien ( z. B. alle 20 bis 50 Jahre), mit immer schwerwiegenderen Folgen (durchschnittlich 2,5 Millionen Tote pro Jahr) und immer höheren wirtschaftlichen Kosten (z. B. 14 bis 21 Billionen US-Dollar pro Pandemie, wenn nicht investiert wird ). Daher ist zu erwarten, dass das Pandemie-Abkommen aufgrund ständiger Angst und Eigeninteressen weiterhin einen hohen politischen Stellenwert und steigender Investitionen genießen wird.
Sollte der Entwurf des Pandemie-Abkommens auf der 78. Weltgesundheitskonferenz (WHA) angenommen und anschließend von den erforderlichen 60 Ländern ratifiziert werden, wird seine Wirksamkeit maßgeblich davon abhängen, wie die verschiedenen rechtlichen Verpflichtungen, Governance-Prozesse, Finanzinstrumente und Partnerverpflichtungen definiert und auf der Konferenz der Vertragsparteien (COP) politisch umgesetzt werden. In vielerlei Hinsicht haben die Verfasser des Abkommens die schwierigsten und umstrittensten Meinungsverschiedenheiten lediglich auf die lange Bank geschoben, in der Hoffnung, dass auf der COP ein Konsens gefunden wird.
Hier könnten Vergleiche und Gegenüberstellungen zwischen der Klima-COP und der Pandemie-COP dabei helfen, einige nützliche Erkenntnisse darüber zu gewinnen, welche politischen Folgen das Pandemie-Abkommen haben könnte.
Beide sind zu Industriezweigen geworden, an denen Regierungen und Unternehmen erhebliche Eigeninteressen haben. Beide nutzen Angst, um politische und finanzpolitische Maßnahmen zu motivieren, und beide verlassen sich in hohem Maße auf die natürliche Neigung der Medien, Angst zu verbreiten und Ausnahmezustände als dominierende Narrative zu rechtfertigen.