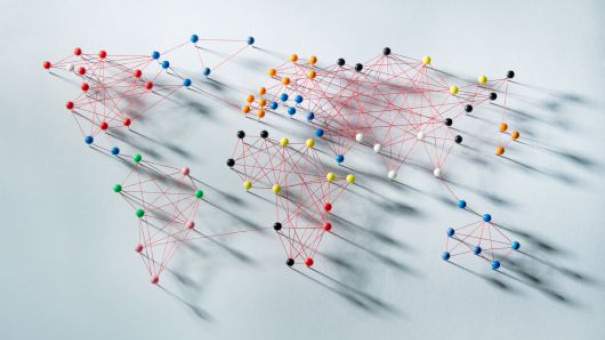Der Begriff Strategie ist eines der am häufigsten verwendeten Wörter in der modernen Sprache. Sie kennen ihn vielleicht aus der Unternehmenssprache: lange, jargonbeladene, klischeehafte Leitbilder oder Visionsdokumente, meist ohne wirkliche Bedeutung, in denen Ihre Schule, Hochschule, Gemeinde, Universität, Ihr Arbeitgeber, Ihr Versorgungsunternehmen, Ihr Supermarkt – oder wer auch immer – ihre hochtrabenden und oft unerreichbaren Ziele propagiert oder einfach nur das, was sie bereits tun, mit blumiger Wohlfühlrhetorik verschleiert.[i] Der Begriff Strategie wird stets so eingesetzt, dass er autoritär und weitsichtig klingt und den Eindruck vermittelt, die Verantwortlichen wüssten, was sie tun (obwohl dies oft nicht der Fall ist).[ii]
Die Vorstellung, dass „Strategie“ nur von äußerst versierten Menschen in anspruchsvollen Positionen verstanden oder umgesetzt werden kann, während „normale“ Menschen sich fügen und den für sie erstellten „strategischen Plan“ umsetzen sollten, ist eines der am weitesten verbreiteten Missverständnisse. „Strategie“ als Quelle von Mysterien und Elitemacht ist ein hartnäckiger Mythos, den ich als selbsternannter Strategietheoretiker stets zerstreuen möchte.
Der strategische Fahrplan
Die erste Aufgabe dieser Analyse besteht darin, aufzuzeigen, dass die Grundlagen der Strategie nicht kompliziert sind, da wir alle auf einer intuitiven Ebene strategische Praktiker sind. Es geht darum , effektiv zu sein , d. h. gewünschte Ziele zu erreichen. So einfach es auch sein mag, Strategie auf individueller Ebene zu verstehen, wie ich in einem anderen Artikel für diese Zeitschrift dargelegt habe, ist die Umsetzung der Grundlagen in die Praxis schwierig, insbesondere wenn die Strategie über den Bereich des persönlichen Fortschritts hinausgeht.[iii]
Der Aufsatz skizziert, wie sich Strategie als Methode zur Erforschung von Effektivität entwickelt hat und zeigt, dass sie nicht, wie viele glauben, untrennbar mit Krieg verbunden ist, sondern sich auf Lebensentscheidungen im Allgemeinen bezieht. So einfach das Konzept der Strategie auch sein mag, erläutert dieser Artikel die praktischen Herausforderungen bei der Bewertung des Effektivitätsbegriffs. Er zeigt, wie Theoretiker die Lehren aus dem Kalten Krieg und dem Vietnamkrieg reflektierten, die besonders lehrreich für die Schaffung einer kohärenten intellektuellen Grundlage für die Entwicklung einer Disziplin der strategischen Analyse waren.
Die Grundlage einer guten strategischen Analyse, so argumentiert dieser Artikel, besteht darin, sich die Mühe zu machen, die eigene Umgebung und die Faktoren zu verstehen, die die Entscheidungsprozesse von einem selbst, seinen Verbündeten und seinen Gegnern beeinflussen. Er schlägt vor, diese Anstrengungen in sechs Grundprinzipien der strategischen Analyse zu bündeln, die als Leitfaden und Einstieg für Anfänger dienen können, um zu versierteren Strategen zu werden. Abschließend werden einige Beobachtungen darüber dargelegt, was es letztlich bedeutet, strategisch effektiv zu sein, und insbesondere betont, dass Strategie ein universelles und nie endendes intellektuelles Unterfangen ist.
Es ist nicht kompliziert
Strategie ist weder kompliziert noch das Vorrecht einer klösterlichen Clique von Eingeweihten, die auf unerklärliche Weise Einblick in die Welt der strategischen Angelegenheiten gewonnen haben. Es gibt Menschen wie mich, die Strategie beruflich studieren und behaupten, sich auf strategische Angelegenheiten zu spezialisieren. Zwar mag es Denkergemeinschaften geben, die sich als „Strategen“ bezeichnen, sowie Institute und Verbände, die vorgeben, sich auf Strategie zu spezialisieren, doch strenggenommen gibt es weder eine „Gilde“ von Strategen noch einen klar definierten Strategenberuf. Darüber hinaus gibt es weder eine Ausbildung noch einen narrensicheren Leitfaden, der Sie zum Strategen qualifiziert oder Sie darin verbessert.
Dennoch ist Strategie als Konzept im Grunde leicht verständlich. Der Grund dafür ist, dass Strategie universell ist. Sie umgibt uns überall. Tatsächlich ist Strategie, sowohl in der Konzeption als auch in der Praxis, zutiefst persönlich. Strategie dreht sich um Sie.
Man kann es sich so vorstellen, dass wir alle bis zu einem gewissen Grad strategisch denken können. Wir alle treffen täglich Entscheidungen, große und kleine, und wägen dabei Kosten und Nutzen verschiedener Vorgehensweisen ab. Oftmals finden solche Abwägungen auf der Ebene des Alltäglichen statt. Unsere Entscheidungen sind daher meist intuitiv oder sogar unbewusst, sei es die Wahl unserer Kleidung nach dem Aufstehen, der Weg zur Arbeit, um dem Verkehr zu entgehen, oder die Frage, wie wir unser monatliches Budget bis zum nächsten Zahltag ausgleichen.
Wir Individuen denken und handeln auf unzählige Arten – viel zu viele, um sie alle aufzuzählen – fast jeden Moment unseres wachen Lebens strategisch. Anders ausgedrückt: Menschen sind durchaus in der Lage, strategisch über ihr eigenes Leben nachzudenken. Wer das nicht kann, verliert wahrscheinlich sehr schnell die Orientierung in der Welt.
Strategie ist überall um Sie herum
Strategie ist daher allgegenwärtig. Sie ist überall. Und wir alle, die wir als bewusste Erwachsene agieren, verhalten uns auf eine Weise, die als „strategisch“ ausgelegt werden könnte: Das heißt, wir denken, schätzen und bewerten, wie wir Dinge erreichen können, die für uns von Bedeutung sind. In dieser Hinsicht kann Strategie als Prozess als ein äußerst pragmatisches Unterfangen betrachtet werden: Wir wollen unsere Ziele erreichen, unser Wohlbefinden maximieren und unsere Ziele erreichen.
Da Individuen stets in Kollektiven agieren – Familien, Clans, Nachbarschaften, ethnischen und religiösen Gemeinschaften usw. –, können wir erkennen, wie sich Strategie von der Mikroebene des Individuums zur Makroebene des Kollektivs entwickelt, sei es im sozialen, unternehmerischen oder staatlichen Bereich. Auch größere soziale Gruppierungen verfolgen gemeinsame Ziele und agieren daher als strategische Akteure.[iv]
Um es klar zu sagen: Das bedeutet nicht, dass Menschen dazu befähigt sind, auf kollektiver Ebene strategisch zu denken, beispielsweise in der nationalen Politik. Die vielen schwerwiegenden politischen Fehler, die man im Laufe der Geschichte erlebt hat, belegen, dass die Abwägung hochkomplexer Fragen und die Umsetzung effektiver und angemessener Maßnahmen nur allzu anfällig für menschliche Schwächen und Fehlkalkulationen sind.
Die Fähigkeit, auf nationaler Ebene strategisch zu denken oder zu visualisieren, was oft den Mut erfordert, schwierige Entscheidungen zu treffen, ist selten. Um es noch einmal zu wiederholen: Auf individueller Ebene sind die meisten Menschen in der Lage, im Einklang mit ihren eigenen Interessen „strategisch“ zu handeln. Insofern sind die Grundprinzipien der Strategie einfach und nachvollziehbar. Ihre Umsetzung auf anderen Ebenen als der individuellen Weiterentwicklung dürfte jedoch immer schwierig sein.
Um das Wesentliche dessen, was es bedeutet, auf individueller oder kollektiver Ebene „strategisch“ zu sein, auf den Punkt zu bringen, würde ich sagen : effektiv sein , d. h. die Fähigkeit, gewünschte Ziele zu erreichen. Effektivität, also das Ausmaß, in dem ein gewünschtes Ergebnis erreicht werden kann, ist der Prozess, den die strategische Theorie in einem kohärenten Rahmen zu erfassen und zu analysieren versucht.
Was bedeutet es, effektiv zu sein?
Ziel dieses kurzen Essays ist es, darüber nachzudenken, was Effektivität bedeutet, zu zeigen, wie sie systematisch verstanden und analysiert werden kann und wie dieser Verständnisprozess die Grundlage der strategischen Theorie bildet. Ziel ist es, zu beleuchten, was die strategische Theorie als Ansatz zur Untersuchung sozialer Phänomene beinhaltet. Anhand von Beispielen aus Krieg, Politik und dem Leben im Allgemeinen soll verdeutlicht werden, dass Strategie ein universelles Konzept ist, das sich auf alles anwenden lässt – von der Staatspolitik über die Wirtschaft bis hin zu persönlichen Entscheidungen.
Ziel ist es vor allem zu zeigen, dass die strategische Theorie eine Methode ist, effektive Entscheidungen zu verstehen . Der Inhalt von Entscheidungen, insbesondere wenn es um Fragen der Ausübung militärischer Macht oder der nationalen Politik geht, kann natürlich komplex und umstritten sein. Die Anwendung der strategischen Theorie zielt jedoch darauf ab, den Verständnisprozess zu vereinfachen, nicht ihn zu verkomplizieren.
Strategie entmystifizieren
Die Entmystifizierung der Strategie ist daher die erste Aufgabe des Strategietheoretikers. Am einfachsten gelingt dies, indem man zunächst den Ursprung des Wortes „Strategie“ identifiziert. Sprachlich leitet sich „Strategie“ vom altgriechischen Wort „strategos“ ab, was wörtlich „der Feldherr“ bedeutet. Der Begriff hat in dieser Hinsicht eindeutig militärische Ursprünge und wird üblicherweise als „Kunst des Feldherrn“ interpretiert, um die Geschicklichkeit zu beschreiben, mit der ein Kommandant seine Truppen einsetzt, um in der Schlacht den Sieg zu erringen.[v]
Das zeitlose Wesen der Strategie als Mittel zum „Sieg“ im Krieg ist jedoch tief im menschlichen Wesen verankert. Ob es uns gefällt oder nicht, im Wettbewerb mit anderen das zu erreichen, was man sich vorgenommen hat, ist ein universelles Streben. Daher ist das Prinzip des „Sieges“ in Kriegen und im Leben – also der Erfolg dessen, was man sich vorgenommen hat, oft im Wettbewerb mit anderen – eine Idee, die Zeit und Raum überdauert und auf zahlreiche Bereiche menschlichen Handelns anwendbar ist.
Strategie hat also tatsächlich militärische Ursprünge und bezieht sich auf „Gewinnen“. Wie jedoch betont wurde, ist der Begriff der Strategie als reines Konzept – die Verknüpfung von Mitteln und Zwecken, um Ziele zu erreichen – viel umfassender als Krieg und die Ausübung militärischer Macht. Hier möchte ich darlegen, warum Strategie, über ihre sprachlichen Ursprünge hinaus, in der Vorstellung der Menschen oft mit Krieg und nicht mit Lebensentscheidungen im Allgemeinen in Verbindung gebracht wird.
Warum wird Strategie mit Krieg in Verbindung gebracht, obwohl sie nicht zwangsläufig zum Krieg gehört?
Strategie wird mit Krieg, genauer gesagt mit dem physischen Zusammenstoß organisierter Streitkräfte, assoziiert, da die Ergebnisse im Krieg meist leichter zu beobachten und zu bewerten sind als in anderen Lebensbereichen. Die Entscheidungen und Konsequenzen im Krieg stellen sich oft als klare, binäre Kategorien dar: Leben und Tod; Sieg und Niederlage, Erfolg und Misserfolg. Daher sind die Kriterien für die Beobachtung oder Messung der Effektivität oft klarer. Dasselbe lässt sich nicht unbedingt von anderen Lebensbereichen behaupten, in denen die Unterscheidung zwischen einem erfolgreichen und einem nicht erfolgreichen Ergebnis diskutabel ist.
Dennoch gibt es Parallelen zwischen Leben, Wirtschaft und Krieg. Die Herausforderung in jedem der vielen Bereiche menschlichen Verhaltens – sei es im Leben, in der Wirtschaft, in der Politik oder im Krieg – besteht darin, dass es den Menschen oft nicht gelingt, Erfolg (oder „Gewinnen“) klar und messbar zu definieren, um eine objektive Erfolgsbewertung zu ermöglichen. Kein Bereich, auch nicht der Krieg, weist zwangsläufig klarere Kriterien auf als ein anderer; entscheidend ist, wie wir diese Kriterien definieren (oder nicht definieren).
Ein anschauliches Beispiel hierfür sind unterschiedliche Erziehungsansätze. Kindererziehung ist für jeden eine Herausforderung, und es gibt sicherlich kein „Regelwerk“, aber es gibt verschiedene Stile oder Strategien, die in Betracht gezogen werden können. Ein Erziehungsstil könnte Disziplin, Regeln und das Setzen von Grenzen betonen. Das Ziel der Eltern könnte darin bestehen, sicherzustellen, dass das Kind mit einem starken Moralempfinden, einer klaren Orientierung und der Fähigkeit zur Selbstorganisation aufwächst. Die Kehrseite davon könnte jedoch sein, dass das Kind, weit entfernt von der Vermittlung dieser Werte, als Erwachsener mit Gefühlen der Unsicherheit, Unterdrückung und Ablehnung gegenüber seiner Erziehung heranwächst.
Umgekehrt könnte ein liberalerer Erziehungsstil eine freiere und weniger regelgebundene Erziehung fördern, um die Entwicklung und Selbstentfaltung des Kindes zu fördern. Die mögliche Kehrseite besteht darin, dass das Kind ohne ausreichende Selbstbeherrschung aufwächst oder seine Lebensziele nicht mehr im Blick hat. In der Folge könnte es sogar beginnen, seinen Eltern gegenüber Abneigung zu entwickeln.[vi]
Natürlich, so vermutet man, denken die meisten Eltern nicht bewusst über verschiedene Strategien nach. Wie Steve Leonard treffend bemerkt: „Eltern können sich für eine strategische Kindererziehung entscheiden, tun es aber in der Regel nicht. Bis sie klug genug sind, zu verstehen, wie die Dinge funktionieren, sind ihre Kinder bereits Erwachsene, die für die Therapie bezahlen.“[vii]
Der Punkt ist jedoch, dass unterschiedliche Ansätze oder Stile, wenn sie nur intuitiv umgesetzt werden, die Abwägung schwieriger, oft widersprüchlicher Entscheidungen erfordern, deren letztendliches Ergebnis im Hinblick auf Erfolg oder Misserfolg schwerer zu beurteilen ist. Das ist der Stoff, aus dem die „Strategie“ des Alltagslebens besteht. Unterschiedliche Vorgehensweisen erfordern subjektive Entscheidungen, die von unterschiedlichen Wertesystemen, unterschiedlichen Weltanschauungen und unterschiedlichen Analyseformen von Richtig und Falsch bzw. „Gut“ und „Böse“ bestimmt werden. Das Leben ist ständig in Grautönen. Wirksam zu sein, ist, nun ja, kompliziert! Geben Sie mir im Vergleich dazu jeden Krieg zum Studium.
Kompetenz, Optimierung, Effizienz, rationales Handeln und Leistung
Der Punkt ist, dass Effektivität im Leben das Abwägen von Entscheidungen und möglichen Konsequenzen erfordert. Oft gibt es keinen eindeutigen richtigen oder falschen Weg.[viii] Strategische Theorie befasst sich daher mit der Frage, was Effektivität in stark kontingenten Situationen bedeutet. Doch was bedeutet „Effektivität“?
- Bedeutet es Kompetenz : über Fähigkeiten, Fertigkeiten, Wissen und Fachkenntnisse zu verfügen?
- Bedeutet es, optimale Ergebnisse erzielen zu können : die Fähigkeit, die günstigste, das Interesse maximierende Situation zu erreichen?
- Bedeutet es Effizienz : das Erreichen von Zielen mit einem Minimum an Aufwand und Ressourcen?
- Bedeutet es rationale Entscheidungen : Entscheidungen auf der Grundlage objektiver Vernunft und Logik treffen?
- Bedeutet es Leistung : die Erfüllung einer Aufgabe auf hohem Niveau?
Oder ist es alles das oben Genannte? Ach ja, und lässt sich das überhaupt objektiv messen?
Hmm… also…? Solche Fragen beschäftigen selbsternannte Strategietheoretiker, meist aus den Bereichen Wirtschaftswissenschaften und Politikwissenschaft, seit Jahrzehnten. Eine Mischung aus Theorie, Reflexion und Erfahrung führte tendenziell zu einer allgemeinen Schlussfolgerung, die wenig überraschend sein dürfte: Es ist ein Trugschluss, sich von einigen oder allen der oben genannten Faktoren beeinflussen zu lassen. Die Kriterien Kompetenz, Optimierung, Effizienz, rationales Handeln und Leistung können kein objektives Maß für Effektivität liefern, geschweige denn vorhersagen, wer mit seiner gewählten Strategie Erfolg haben wird.
Das Problem der Theoriebildung im Kalten Krieg
Amerikanische Theoretiker versuchten dennoch, ein solches Kriterium zu entwickeln. Während des Kalten Krieges nutzten Theoretiker der nuklearen Abschreckung – vielleicht die ersten und zweifellos einige der herausragendsten Vertreter einer Disziplin der strategischen Theorie – die aus Mathematik und Ökonomie importierte Spieltheorie, um optimale Ergebnisse und Verhaltensweisen zu modellieren. Dies erforderte ein hohes Maß an abstrakter Theoriebildung und Modellierung.[ix] Die Anwendung der rationalen, akteursbasierten Spieltheorie in dieser Zeit offenbarte jedoch ihre Grenzen als Erklärungs- und Vorhersageinstrument.
Das Problem war: Der Kernpunkt der nuklearen Abschreckung bestand darin, niemals Atomwaffen einzusetzen. Was war also das Kriterium für Wirksamkeit? Die Antwort: sie nicht einzusetzen. Aber man kann nicht wirklich etwas Negatives beweisen. Man kann nicht eindeutig belegen, warum jemand etwas nicht getan hat. Nach dem Ende des Kalten Krieges 1990 konnte man zwar zu dem Schluss kommen, man habe sein grundlegendes Ziel, einen nuklearen Holocaust zu verhindern, erreicht, aber das lieferte keine messbaren Kriterien für Wirksamkeit. Warum?
Nun, zunächst einmal ist der Beweis einer Verneinung konzeptionell nicht falsifizierbar, doch die umfassendere empirische Wahrheit ist, dass abstrakte Theorien die unendlich vielfältige Komplexität menschlichen Verhaltens nicht berücksichtigen. Menschen werden von Problemen und Sorgen motiviert, die nicht immer oder nicht einmal primär einer materiellen Kosten-Nutzen-Analyse unterliegen. Ihre Vorstellung von „Rationalität“ oder einem optimalen Ergebnis entspricht nicht unbedingt der Vorstellung eines anderen. Ihre Kosten-Nutzen-Analyse kann völlig individuell sein und von Ihren eigenen subjektiven Werten und Erfahrungen hinsichtlich dessen, was sinnvoll und wichtig ist, geprägt sein. Daher kann Ihre Wertschätzung dessen, was es bedeutet, in der Welt effektiv zu sein, stark von der anderer abweichen.
Den Amerikanern wird eine Lektion erteilt
Das ist also ein Problem für diagnostisch denkende Theoretiker: Effektivität lässt sich nicht anhand objektiver wissenschaftlicher Kriterien präzise messen. Und woher wissen wir das? Weil die US-Politiker im Vietnamkrieg diesbezüglich eine ernüchternde Lektion erhielten. Damals kämpften die Amerikaner mit dem Plan, dem nordvietnamesischen Regime eine „rationale“ Kosten-Nutzen-Analyse aufzuzwingen. Ziel war es, Nordvietnam mehr Leid zuzufügen, als die Amerikaner für verkraftbar hielten, insbesondere durch massive Luftangriffe und den Einsatz enormer Feuerkraft am Boden. Nordvietnam verfolgte jedoch völlig andere moralische und praktische Überlegungen als die Amerikaner. Präsident Ho Chi Minh brachte dies auf den Punkt, als er gegenüber einem US-Diplomaten sagte: „Sie werden zehn von uns töten, wir werden einen von Ihnen töten, aber am Ende werden Sie es erst einmal leid sein.“[x]
Mit anderen Worten: Die Nordvietnamesen kämpften nach einem diametral entgegengesetzten strategischen Kalkül. Für die Amerikaner bedeutete „Effektivität“, dem Norden durch massiven Einsatz von Feuerkraft „inakzeptable“ Kosten aufzuerlegen. Die USA argumentierten mit einer Kosten-Nutzen-Analyse, die für sie nachvollziehbar war, die Nordvietnamesen jedoch nicht überzeugte. Warum? Weil die nordvietnamesischen Kommunisten nicht dasselbe Wertesystem teilten wie die Amerikaner. Das Regime in Hanoi war bereit, im Streben nach Vereinigung und nationaler Unabhängigkeit enorme Kosten zu tragen. Für diese Werte und Ziele waren viele Vietnamesen bereit, alles zu opfern.
Harte Arbeit leisten
Normalerweise hasse ich Klischees, aber Sun Tzus alte Weisheit, dass man „in hundert Schlachten niemals besiegt wird, wenn man den Feind und sich selbst kennt“, trifft genau zu.[xi] Die Amerikaner bemühten sich nicht, ihren Gegner zu verstehen. Sie versuchten nicht, den nationalistischen Reiz des vietnamesischen Kommunismus zu verstehen.
Nicht nur die Amerikaner haben die kontroverse Sichtweise nicht richtig verstanden. Es ist ein fast überall verbreitetes Versagen. Hätte man sich beispielsweise ernsthaft mit den geostrategischen Befindlichkeiten Russlands in der Ukraine auseinandergesetzt, hätte Europa die aktuelle Krise auf dem Kontinent möglicherweise verhindern können (wie bereits mehrere bedeutende strategische Denker von Henry Kissinger bis John Mearsheimer betont haben).[xii]
Und genau darum geht es in der strategischen Theorie. Sie ist kein Mysterium. Es geht darum, sich anzustrengen, um seine Stärken, seine Grenzen, seine Gegner und seine Verbündeten zu verstehen. Vor allem aber geht es darum, die eigene Situation zu verstehen. Denken Sie daran: Strategie dreht sich um Sie und Ihre Ziele. Ihre Ziele hängen jedoch oft von den Entscheidungen und Handlungen anderer ab, die Sie beeinflussen müssen, um Ihre Wünsche zu erreichen. Das bedeutet nicht, egozentrisch oder narzisstisch zu sein. Effektiv zu sein – ein guter Stratege zu sein – sollte ein Gegenmittel gegen solche Schwächen sein, denn letztlich lehrt Sie die strategische Theorie, nicht intellektuell faul zu sein.
Aber das ist natürlich leichter gesagt als getan. Deshalb scheitern so viele politische Maßnahmen. Es mag kein Mysterium sein, aber die harte Arbeit ist für viele ein Widerspruch. Es ist nicht unbedingt komplex, kann aber kompliziert werden, insbesondere wenn sich Umfang und Ausmaß der Strategie weiterentwickeln. Die Grundformel ändert sich nicht, aber die Anzahl der Variablen in der Gleichung steigt exponentiell an. Und das macht es kompliziert. Hier entwickelt sich Strategie auch von der Wissenschaft zur Kunst – ein wirklich herausragender Stratege ist jemand, der diese Variablen erkennt und ihre Wechselwirkung spürt.
Wie man nicht faul ist: Was ist strategische Theorie?
Auch wenn die Praxis effektiver Strategien in vielen politischen Kreisen aufgrund des Traumas des Vietnamkriegs zumindest theoretisch noch immer schwer fassbar ist, begann sich in der wissenschaftlichen Analyse ein fundierteres und ausgewogeneres Verständnis der Bewertung von Effektivität herauszubilden. Daher lässt sich sagen, dass sich in der Folgezeit eine „Disziplin“ der strategischen Theorie herausbildete, die auf sechs Grundprinzipien basierte. Auf diesen sechs Prinzipien lässt sich ein systematisches Verständnis der Untersuchung strategischer Fragen aufbauen.
Bevor wir diese sechs Prinzipien erläutern, definieren wir kurz, was wir in diesem Zusammenhang unter einer „Theorie“ verstehen. Ein wissenschaftliches Theorieverständnis besagt, dass eine Hypothese experimentellen Tests standhalten kann, um reproduzierbare Ergebnisse zu liefern und so eine ungefähre Wahrheit über einen bestimmten Sachverhalt zu erreichen. Strategische Theorie kann zwar nicht diese Vorhersagegenauigkeit erreichen, stellt aber eine Theorie im weiteren Sinne dar, da sie eine Reihe von Aussagen aufstellt, die bestimmte Fakten oder Phänomene erklären und anschließend einer genauen Prüfung und Analyse unterzogen werden können. In diesem Sinne ist strategische Theorie weniger eine harte „Theorie“ oder ein Regelwerk als vielmehr eine Reihe zielgerichteter Annahmen, die klären sollen, was effektives Denken und Handeln in der Welt bedeutet.[xiii] Diese lassen sich wie folgt zusammenfassen:
- Die Lehre von Wegen, Zwecken und Mitteln : Die strategische Theorie befasst sich mit der Art und Weise, wie verfügbare Mittel eingesetzt werden können, um ein gewünschtes Ziel zu erreichen. Wie Michael Howard es formulierte, ist Strategie der „Einsatz verfügbarer Ressourcen zur Erreichung eines Ziels“.[xiv] Der Begriff Ressourcen (die „Mittel“) bezieht sich hier nicht nur auf die materiellen Elemente der Macht (z. B. wirtschaftliche Stärke, Anzahl der Soldaten und Waffen, technologische Leistungsfähigkeit usw.), sondern auch auf die vielen immateriellen Elemente, die einen Entscheidungsträger beeinflussen können, wie z. B. die Begeisterung der Bevölkerung für eine Sache und die Bereitschaft der Bevölkerung, bestimmte Vorgehensweisen zur Erreichung oder Verteidigung bestimmter Ziele und Werte zu unterstützen.
- Interdependente Entscheidungsfindung : Dabei wird davon ausgegangen, dass die Entscheidungsfindung in gewissem Maße durch die Existenz eines oder mehrerer vorsätzlicher Gegner oder allgemein anderer Akteure beeinflusst wird, die ebenfalls entschlossen ihre eigenen Werte und Interessen verfolgen, die Ihren eigenen entgegenstehen können. Diese Annahme bedeutet, dass Entscheidungsfindung nicht an einem festen Wirksamkeitsmaßstab gemessen werden kann, sondern anhand der Reaktionen, die Ihre Handlungen von einem Gegner erwarten lassen. Effektive Entscheidungsfindung hängt daher von der Berücksichtigung der Entscheidungen und Handlungen anderer ab, mit denen Sie möglicherweise im Konflikt stehen.
- Einheitliche Akteure : Strategische Theoretiker beschäftigen sich mit „einheitlichen“ Akteuren, seien es Staaten, substaatliche Einheiten oder andere soziale Gruppierungen. Obwohl alle sozialen Akteure aus Individuen und anderen Kollektiven bestehen (z. B. Streitkräfte, öffentliche Verwaltung, soziale Klassen usw.), geht die strategische Theorie davon aus, dass die Entscheidung zum Handeln Ausdruck eines kollektiven Willens ist. Daher untersucht die strategische Theorie in erster Linie die Wahlmöglichkeiten solcher Akteure und bewertet die Zusammensetzung ihrer Entscheidungsfindung. Sie verfolgt den Gedankengang, den ein sozialer Akteur bei der Verfolgung seiner erklärten Ziele mit den von ihm gewählten Mitteln verfolgt.
- Wertesysteme verstehen : Die Bewertung von Entscheidungen erfordert den Versuch, das Wertesystem eines sozialen Akteurs zu verstehen – also seine Sicht auf die Welt, seine Denkweise über seine eigenen Motivationen und Präferenzen. Die strategische Theorie interessiert sich in diesem Zusammenhang dafür, wie Akteure ihre Interessen im Lichte ihrer „Werte“ konstruieren, die wahrscheinlich von unterschiedlichsten historischen und sozialen Einflüssen beeinflusst werden. Strategische Theoretiker beschäftigen sich daher damit, wie Wertesysteme das Verständnis nationaler Ziele (im Falle eines Staates) sowie die Entscheidungen und Mittel, die dieser zu seiner Erreichung einsetzt, prägen.
- Rationalität : Die strategische Theorie geht davon aus, dass sich der Akteur rational und gemäß seinem eigenen Wertesystem verhält, d. h., dass sein Handeln mit der Erreichung seiner angestrebten Ziele vereinbar ist. Dies stellt, wohlgemerkt, keine Überstülpung einer rationalen Akteursmodellierung dar. Sie setzt auch nicht voraus, dass der Akteur perfekt effizient agiert oder dass seine Entscheidungen automatisch zum Erfolg führen. Sie geht jedoch davon aus, dass die Entscheidungen des Akteurs nach einer für den betreffenden Akteur sinnvollen Kosten-Nutzen-Analyse getroffen werden, die zu einer Handlungswahl führt, die die Erreichung eines angestrebten Ziels im Einklang mit seinem eigenen Wertesystem optimiert.
- Moralische Neutralität : Um ethnozentrische Bewertungen, d. h. die Beurteilung anderer nach den eigenen Werten, zu vermeiden, interessiert sich die strategische Theorie nicht für die moralische Gültigkeit der Ziele, Wege und Mittel eines Akteurs. Die Bewertung der Wirksamkeit der Entscheidungsfindung eines Akteurs beschränkt sich hauptsächlich darauf, wie gut die gewählten Mittel zur Erreichung der gesetzten Ziele eingesetzt werden. Dies gilt für alle Mittel und Wege, einschließlich der Anwendung gewalttätiger Methoden, die ausschließlich instrumentell betrachtet werden. Diese Annahme ist eine notwendige Voraussetzung für eine objektive Erkenntnisgewinnung und um zu vermeiden, dass der Versuch, soziales Handeln zu beschreiben und zu verstehen, mit normativen Urteilen vermischt wird, die unweigerlich jeden Versuch einer objektiven Analyse untergraben.
Ein Einstiegspunkt
Diese sechs Grundannahmen bieten eine praktikable Möglichkeit, über das Konzept der Effektivität nachzudenken. Sie beinhalten so wenige Postulate wie möglich, und der Leser kann erkennen, wie Konzepte wie Kompetenz, Rationalität, Optimierung, Effizienz und Leistung qualifiziert dargestellt werden, basierend auf dem Verständnis des individuellen Selbstverständnisses eines Akteurs. Die so präsentierten Annahmen der strategischen Theorie helfen dem Analytiker, situative Verzerrungen zu vermeiden und bieten eine sparsame Möglichkeit, soziales Verhalten zu untersuchen, insbesondere in Umgebungen, in denen soziale Akteure versuchen, ihre Interessen und Werte gegen die Interessen anderer Akteure durchzusetzen.
Diese Annahmen eröffnen lediglich einen Zugang zu einem viel breiteren Fragenkomplex, dem sich Strategiewissenschaftler naturgemäß widmen. So zum Beispiel: Wie gewinnt man Einblick in das Wertesystem eines anderen? Woher weiß man, ob ein Akteur eine Kosten-Nutzen-Analyse durchgeführt hat? Wie lässt sich feststellen, ob ein Akteur sein Potenzial mit den von ihm gewählten Mitteln maximiert hat? Wie jede Untersuchungsmethode kann die strategische Theorie komplexer und problematisierter werden. Ihre grundlegenden Prinzipien bieten jedoch eine einfache und unkomplizierte Methode zur Analyse des Wie, Warum und Zwecks der Arbeit sozialer Akteure, um die von ihnen gesetzten Ziele zu erreichen.
Fazit: Am Ende gibt es kein Ende
Um zu verstehen, wie Menschen – individuell oder kollektiv – versuchen, in der Welt erfolgreich und effektiv zu sein, versucht die strategische Theorie lediglich, das implizite menschliche Verhalten explizit zu machen. Zu diesem Zweck und unter Berücksichtigung jüngster Ereignisse (z. B. des Scheiterns westlicher außenpolitischer Interventionen in Afghanistan, Irak, Libyen und Syrien, überraschender politischer Ereignisse wie Großbritanniens Entscheidung, die EU zu verlassen, der Wahl Donald Trumps zum US-Präsidenten und der unverhältnismäßigen und wirtschaftlich schädlichen politischen Reaktionen während der Covid-19-Pandemie)[xv] haben einige der nachdenklichsten und interessantesten Auseinandersetzungen mit der strategischen Theorie versucht, fundierte Schlussfolgerungen über soziales und politisches Verhalten zu ziehen. Vor diesem Hintergrund möchte ich den Lesern abschließend fünf allgemeine Erkenntnisse aus dieser kurzen Diskussion mitgeben:
- Effektivität lässt sich nicht exakt messen, aber anhand eines unumstößlichen Kriteriums bewerten: Haben Sie Ihre Ziele erreicht? Diese Aussage unterliegt zwar Nuancen und Abgrenzungen, ist aber ein objektiver Erfolgsindikator. Haben Sie erreicht, was Sie sich vorgenommen haben? Wenn die Antwort ja lautet, dann haben Sie definitiv effektiv gearbeitet.
- Effektivität – das Erreichen Ihrer Ziele – lässt sich auf gutes Urteilsvermögen reduzieren, d. h. das Treffen guter Entscheidungen in den jeweiligen Situationen. Dies wirft natürlich die kompliziertere Frage auf, ob gutes Urteilsvermögen erlernbar oder angeboren ist. Es deutet jedoch auf die besondere Fähigkeit hin, Probleme so zu erkennen und zu bewerten, dass Sie Ihre Ziele erreichen, jedoch zu einem akzeptablen Preis, wie auch immer dieser definiert sein mag.
- Nicht-materielle Werte sind oft viel wichtiger als materielle. Traditionen, Identität, Bräuche und Gemeinschaft, wie die Amerikaner in Vietnam erlebten und wie die politischen Eliten sie immer wieder neu entdecken, werden höher bewertet als weltliche Belange. Folglich sind Kosten-Nutzen-Argumente, die auf reinem Eigeninteresse, Predigten oder Angst basieren, zumindest langfristig zum Scheitern verurteilt. Anders ausgedrückt: Geld und Angst, so attraktiv und wirkungsvoll sie auch sein mögen, erkaufen weder Loyalität noch gewinnen sie die Überzeugung derer, die man für sich gewinnen will.
- Sie gewinnen gegen Ihr eigenes Wertesystem. Der Begriff „Gewinnen“ ist nicht unbedingt objektiv. Laut der Strategietheorie ist die wichtigste Überlegung, was Ihnen wichtig ist.[xvi] Wenn Sie sich Ihrem Wertesystem angepasst oder im Vergleich dazu etwas erreicht haben – wenn Sie das, was Ihnen wichtig ist, verteidigt, gefördert oder aufrechterhalten haben – dann waren Sie erfolgreich, unabhängig von der Meinung anderer .
- Selbst wenn Sie erfolgreich waren und das erreicht haben, was Ihnen gemäß Ihren eigenen Werten wichtig ist, sollten Sie sich bewusst sein, dass strategischer Erfolg meist nur vorläufig und vorübergehend ist. Strategie dreht sich um das Leben, und das Leben entwickelt sich ständig weiter. Das Leben ist ein ewiger Kampf. Wie Carl von Clausewitz bemerkte, ist der Ausgang eines Krieges nie endgültig[xvii], und Strategie geht, wie das Leben selbst, immer weiter. Sie endet nie.
[ii] Siehe ebenda.
[iii] MLR Smith, „Warum Strategie einfach, aber (gleichzeitig) schwierig ist: Eine kurze Studie über die Komplexität der Eskalation“, Military Strategy Magazine (ursprünglich Infinity Journal), Vol. 5, Nr. 4 (2017), S. 10–13.
[iv] Bruce D. Henderson, „The Origin of Strategy“, Harvard Business Review, November-Dezember 1989, verfügbar unter: https://hbr.org/1989/11/the-origin-of-strategy .
[v] Siehe Mithun Sridharan, „Origins: How Did Strategy Evolve Through History“, Think Insights, Juni 2022, verfügbar unter: https://thinkinsights.net/strategy/origins-of-strategy/ .
[vi] Siehe zum Beispiel Sarah Naish, The AZ of Survival Strategies for Therapeutic Parents: From Chaos to Cake (London: Jessica Kingsley/Hachette, 2022).
[vii] Ich danke Steve Leaonard für seine aufschlussreichen und wirkungsvollen Kommentare, 6. August 2022.
[viii] Siehe Thomas Schelling, Choice and Consequence: Perspectives of an Errant Economist (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1980).
[ix] Fred Kaplan, The Wizards of Armageddon (New York: Simon & Schuster, 1983).
[x] James M. Lyndsay, „The Vietnam War in Forty Quotes“, Council on Foreign Relations, 30. April 2015, verfügbar unter: https://www.cfr.org/blog/vietnam-war-forty-quotes .
[xi] „Sun Tzu’s Art of War“, verfügbar unter https://suntzusaid.com/book/3/18 .
[xii] MLR Smith und Niall McCrae, „Straight from the Freezer: The Cold War in Ukraine“, Daily Sceptic, 21. April 2022, unter: https://dailysceptic.org/2022/04/21/straight-from-the-freezer-the-cold-war-in-ukraine/ .
[xiii] Siehe John Garnett, „Strategic Studies and Its Assumptions“, in John Baylis, Ken Booth, John Garnett und Phil Williams, Contemporary Strategy: Theories and Policies (London: Croom Helm, 1975), S. 3–21.
[xiv] Michael Howard, The Causes of War (London: Counterpoint, 1983), S. 86.
[xv] MLR Smith, „Setting the Strategic Cat Among the Policy Pigeons: The Problems and Paradoxes of Western Intervention Strategy“, Studies in Conflict and Terrorism, online veröffentlicht am 23. Mai 2021, verfügbar unter: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/1057610X.2021.1903669 , S. 1-5.
[xvi] Thomas Schelling, The Strategy of Conflict (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1960, S. 4-5)
[xvii] Carl von Clausewitz, Vom Kriege (übers. und hg. von Michael Howard und Peter Paret), (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1986), S. 80.